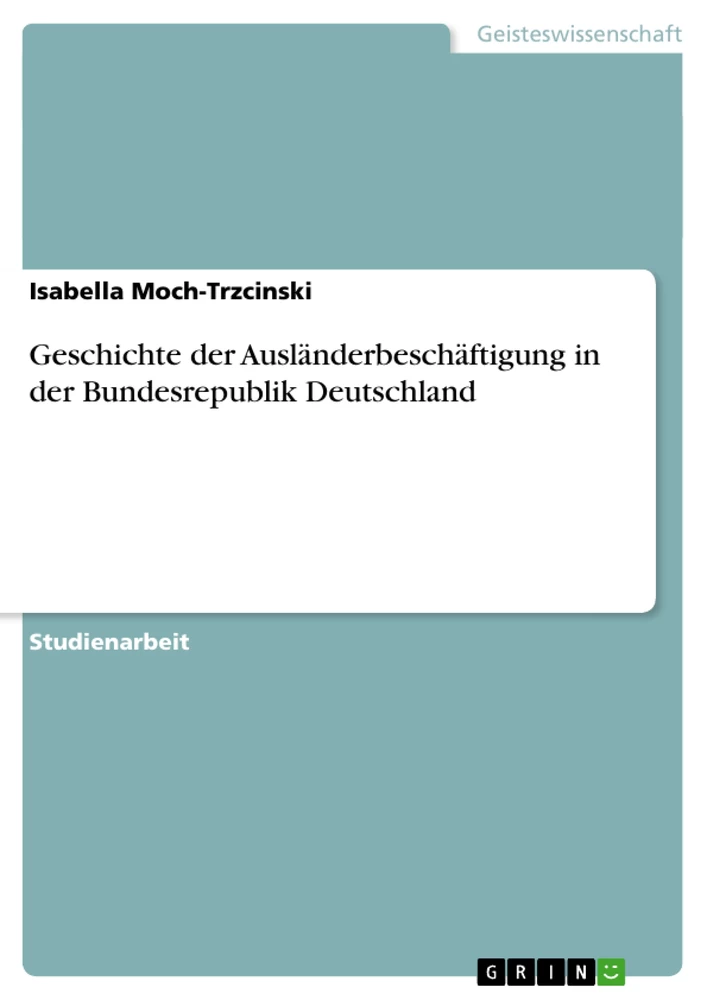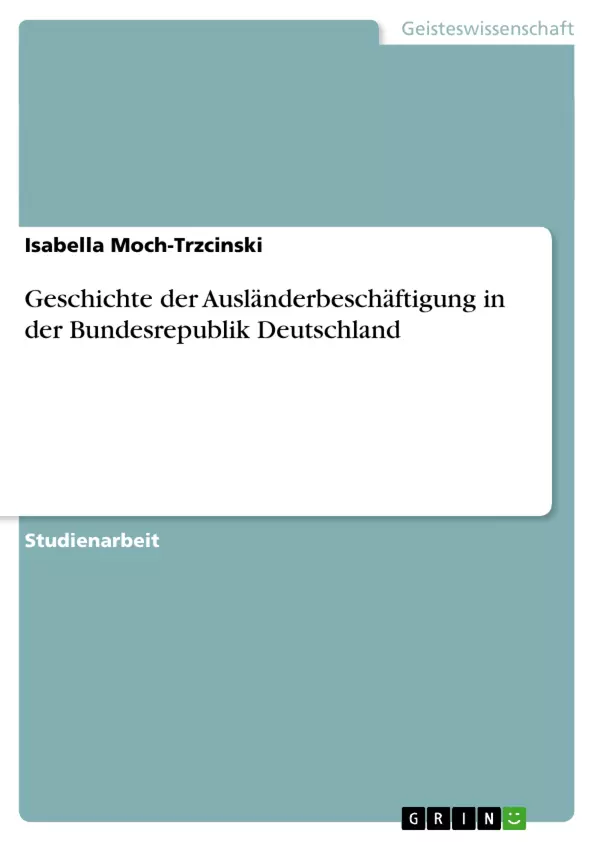Das Thema Ausländerbeschäftigung ist relativ neu in der Geschichte, weil das Wort „Ausländer“ erst im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Bildung moderner Nationalstaaten entstand. Bis dahin gab es nur „Fremde“, die keine Rechte besaßen und auf den Schutz des Königs angewiesen waren. Die wirtschaftlichen Umbrüche und expandierende Industrie (die ständig neue Arbeitskräfte benötigte) sowie Entstehung des Deutschen Reiches haben einen Wandel verursacht. So wurden (laut Art.3 der Reichsverfassung) Angehörige der einzelnen Unterzeichnerstaaten auf dem ganzen Reichsgebiet als Inländer definiert, um den freien Fluß der Arbeitskräfte zu ermöglichen (Gün/Damm 1994).
Am Ende des 19. Jahrhunderts haben sich vier große Industriestandorte in Ruhrgebiet, Oberschlesien, Mittelsachsen und Berlin herausgebildet. Besonders interessant erscheint in diesem Kontext die Geschichte der Ruhrpolen, die als „Türken von gestern“ (Gün/Damm 1994, S. 24) bezeichnet werden können. Sie kamen aus dem preußischen Teil des Kongreß-Polens als deutsche Staatsangehörige und genossen offiziell gleiche Rechte wie alle anderen Deutschen. In der Realität war aber das Verhältnis zwischen den Einheimischen und den Immigranten sehr stark durch Vorurteile geprägt. Diese Vorurteile in Verbindung mit der untergeordneten Stellung auf dem Arbeitsmarkt sowie einem starken Germanisierungsdruck haben dazu geführt, dass die Ruhrpolen in Quasi-Gettos als Außenseiter gelebt haben und eine eigene Subkultur entwickelt haben. Die dadurch entstehenden Integrations- und Assimilationsprobleme waren im Prinzip auf Vorurteile der einheimischen Bevölkerung zurückzuführen (Braun/Hillebrand 1994).
Während des ersten Weltkrieges wurden Fremdarbeiter vor allem in der Landwirtschaft und Rüstungsindustrie tätig; sie erhielten den Status der Zivilgefangenen. Nach dem ersten Weltkrieg wurden trotz hoher Arbeitslosigkeit Leute in der Landwirtschaft benötigt; auch in der NS-Zeit wurde der Trend fortgesetzt, wobei wieder waren es vor allem polnische Landarbeiter. Während des zweites Weltkrieges wurden sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft Zwangsarbeiter eingesetzt (Gün/Damm1994). Dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte ist aber ein Thema für sich und wird aus Platzmangel im Rahmen meiner Arbeit nicht behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtlicher Überblick
- Anwerbeverträge und Ausländerbeschäftigung
- Gastarbeiterpolitik zwischen Rotation und Integration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Geschichte der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei werden die historischen Entwicklungen, Anwerbeverträge und die daraus resultierende Gastarbeiterpolitik sowie die Herausforderungen der Integration untersucht.
- Die Entstehung des Begriffs „Ausländer“ und die Bedeutung von Einwanderung für den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands
- Die Rolle von Anwerbeverträgen in der Nachkriegszeit und die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Die Gastarbeiterpolitik zwischen den Zielen der Rotation und der Integration und die Herausforderungen der Anpassung und des Zusammenlebens verschiedener Kulturen
- Die soziale und politische Integration von Migranten und die Problematik der „Überfremdung“
- Die Situation der Türken als einer der größten Migrantengruppen in Deutschland und ihre Herausforderungen bei der Integration
Zusammenfassung der Kapitel
1. Geschichtlicher Überblick
Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Ausländer“ im Zusammenhang mit der Bildung moderner Nationalstaaten und den wirtschaftlichen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts. Es stellt die Rolle von Einwanderung für die Industrialisierung Deutschlands heraus, insbesondere am Beispiel der Ruhrpolen, und analysiert die Herausforderungen der Integration und Assimilation von Migranten.
2. Anwerbeverträge und Ausländerbeschäftigung
Dieses Kapitel widmet sich der Phase der Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland in den 1950er und 1960er Jahren. Es beschreibt die Gründe für die Anwerbung, die Bedingungen der Anwerbeverträge und die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Zudem werden die Perspektiven von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Gewerkschaften beleuchtet.
3. Gastarbeiterpolitik zwischen Rotation und Integration
Das Kapitel analysiert die Gastarbeiterpolitik der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren. Es behandelt die Spannungen zwischen den Zielen der Rotation und der Integration von Migranten, die Herausforderungen des Familiennachzugs und die Reaktionen der deutschen Gesellschaft auf die wachsende Zahl von Ausländern.
Schlüsselwörter
Ausländerbeschäftigung, Gastarbeiterpolitik, Anwerbeverträge, Integration, Assimilation, Überfremdung, Ruhrpolen, Türken, Familiennachzug, Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Kultur, Sprache, Religion, Gesellschaft, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wann entstand der Begriff „Ausländer“ in Deutschland?
Der Begriff entstand erst im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Bildung moderner Nationalstaaten. Zuvor sprach man lediglich von „Fremden“.
Wer waren die sogenannten „Ruhrpolen“?
Ruhrpolen waren Migranten aus dem preußischen Teil Polens, die Ende des 19. Jahrhunderts in die Industriegebiete des Ruhrgebiets zogen. Obwohl sie deutsche Staatsangehörige waren, lebten sie oft in Quasi-Gettos und waren Vorurteilen ausgesetzt.
Was war das Ziel der Anwerbeverträge in den 1950er und 60er Jahren?
Ziel war es, den Arbeitskräftemangel während des Wirtschaftswunders auszugleichen. Es wurden Verträge mit Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei geschlossen.
Was bedeutet „Gastarbeiterpolitik zwischen Rotation und Integration“?
Ursprünglich war vorgesehen, dass Arbeiter nach einiger Zeit in ihre Heimat zurückkehren (Rotationsprinzip). Tatsächlich blieben viele dauerhaft, was die Politik vor die Herausforderung der sozialen Integration stellte.
Welche Rolle spielt der Familiennachzug in der Migrationsgeschichte?
Der Familiennachzug in den 1970er Jahren veränderte die Struktur der Zuwanderung grundlegend: Aus temporären Arbeitskräften wurden dauerhafte Einwohner, was neue Anforderungen an Wohnraum, Schulen und Sozialpolitik stellte.
- Quote paper
- Isabella Moch-Trzcinski (Author), 2000, Geschichte der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29527