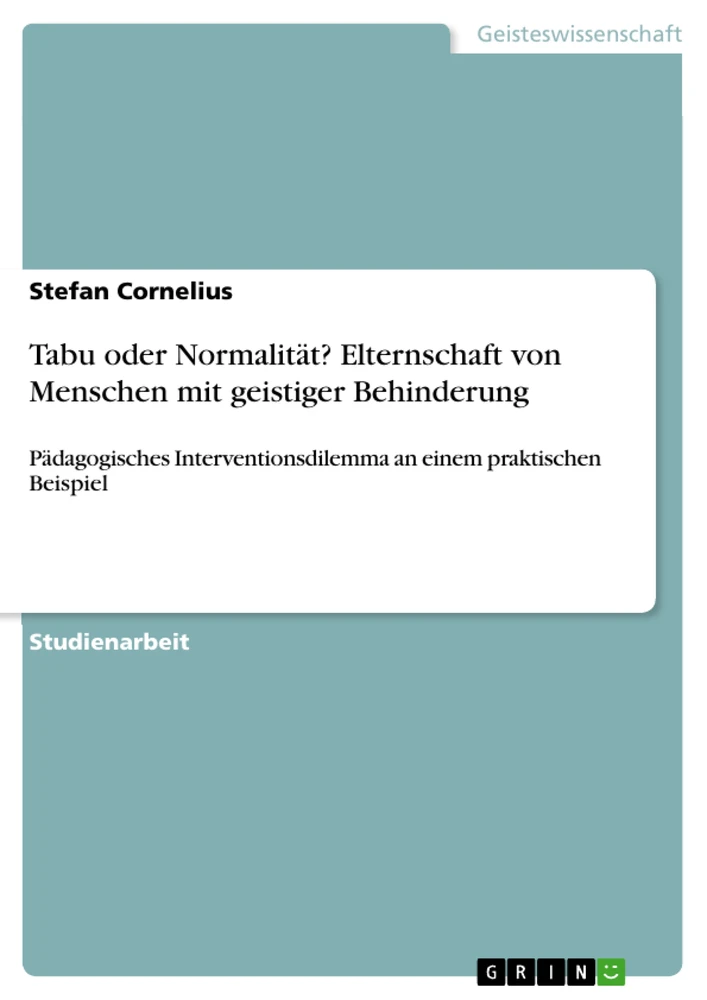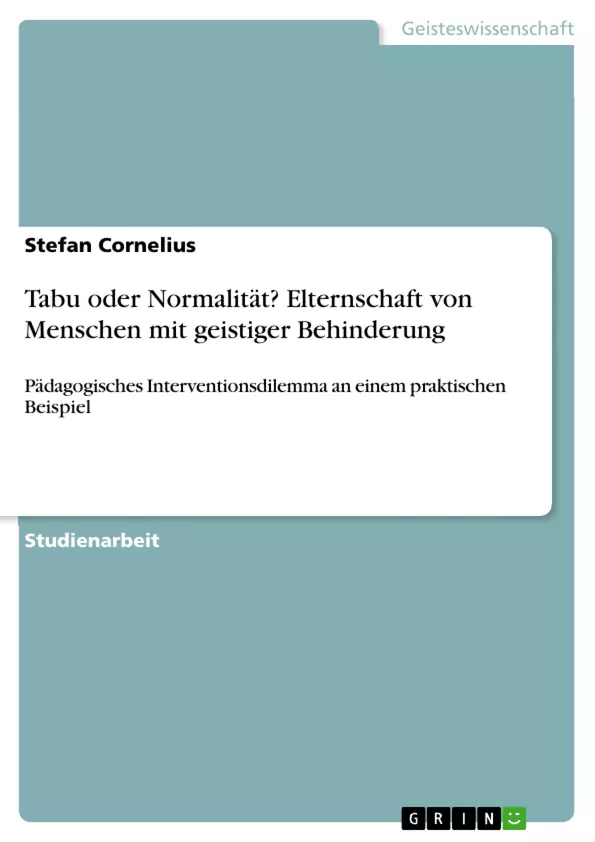Pädagogisches Handeln steht immer in Zusammenhang mit ethischen Fragen. Soll ich etwas tun oder lassen? Welche Gründe sprechen für das Handeln bzw. für das Nicht-Handeln? Das pädagogische Handeln wird bestimmt durch den eigenen Werte und Normenhorizont; nicht selten unreflektiert, aber meistens legitimiert durch eine Art pädagogischen Ethos.
Jeder Pädagoge hat seine eigene Haltung von Richtig und Falsch. Er rechtfertigt durch sein Menschenbild das Handeln und beeinflusst damit den Entwicklungsprozess seines Klienten. Man könnte sagen Pädagogisches Handeln ist immer auch ethisches Handeln (vgl. Dederich, 2001, S.15). Die Frage nach der prinzipiellen Legitimation von Erziehung unter dem Aspekt subjektiver Normengeleitetheit ist im Spannungsfeld von Abhängigkeit und Autonomie, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung gerade in der Behindertenpädagogik entfacht. Auf welcher ethisch argumentativen Grundlage werden Entscheidungen begründet? In einer auf Pluralismus und Heterogenität ausgelegten Gesellschaft ist die Frage nach einem ethischen Fundament in der Behindertenpädagogik von großer Bedeutung.
Viele Reformen Behindertenhilfe betreffender Gesetze (Grundgesetz, Betreuungsrecht, Wohn- und Teilhabegesetz, Antidiskriminierungsgesetz, UN Behindertenrechtskonvention um die wichtigsten zu nennen) haben die rechtliche Grundlage für diese Pluralität geschaffen. Noch vor weniger als 20 Jahren zum Beispiel galt sexueller Kontakt zwischen Menschen mit Behinderung als moralisch verwerflich. Heute haben sich diese moralischen Grundlagen verändert. Es gibt viele Ansätze gelebter Sexualität zwischen Menschen mit geistiger Behinderung, auf Fachtagen werden moderne Konzepte partnerschaftlichen Wohnens vorgestellt und in Einrichtungen sind Paarwohnungen und „richtige“ Hochzeiten keine Seltenheit mehr.
Zu einer überdauernden Partnerschaft gehört auch das Thema Kinder. Ich kenne kein Paar aus meiner beruflichen Praxis, das nach einiger Zeit nicht auch einen Kinderwunsch äußert. Orientiert an diesen Einzelfällen, mit Blick auf den konkreten Menschen, habe ich eine Elternschaft stets kritisch beurteilt.
In dieser Portfolioarbeit geht es um das Dilemma zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung einer eigenen Familienplanung für Menschen mit geistiger Behinderung (am Beispiel von Janine) und dem Unbehagen eines Teams mit dem Impuls dagegen pädagogisch intervenieren zu müssen. Erkenne ich den Wunsch des anderen an, oder gibt es gute Gründe der Ausgrenzung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mein Ethischer Kontext zum Thema
- Die Methode der hermeneutischen Fallbesprechung
- Die Vorbereitung
- Schritt 1: Analyse der problematischen Situation
- Schritt 2: Ethischer Kontext
- Schritt 3: Verschiedene Szenarien
- Schritt 4: Argumentationen Pro und Kontra
- Schritt 5: Weiteres Vorgehen
- Auswertung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Portfolioarbeit befasst sich mit dem Dilemma zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung einer eigenen Familienplanung für Menschen mit geistiger Behinderung und dem Unbehagen eines Teams mit dem Impuls dagegen pädagogisch intervenieren zu müssen. Am Beispiel von J. wird die Frage aufgeworfen, ob der Wunsch des Einzelnen nach Elternschaft anerkannt werden sollte oder ob es gute Gründe für eine Ausgrenzung gibt. Die Arbeit analysiert die Spannung zwischen dem pädagogischen Auftrag, der auf Autonomie und Selbstbestimmung ausgerichtet ist, und den eigenen Vorstellungen und Werten der Fachkräfte.
- Recht auf Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Ethische Aspekte der pädagogischen Intervention
- Elternschaft und Kinderwunsch bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Konflikt zwischen pädagogischem Auftrag und persönlichen Werten
- Hermeneutische Fallbesprechung als Methode zur Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die ethischen Fragen im pädagogischen Handeln dar, insbesondere im Kontext der Behindertenpädagogik. Der Abschnitt "Mein Ethischer Kontext zum Thema" beleuchtet die Entwicklung der eigenen Haltung des Autors im Laufe seiner beruflichen Praxis und identifiziert die Bedenken, die ihn in Bezug auf Elternschaft behinderter Menschen bisher geleitet haben. Kapitel 3 widmet sich der Methode der hermeneutischen Fallbesprechung und beschreibt die einzelnen Schritte des Prozesses, die zur Analyse der konkreten Situation, zum Etablieren des ethischen Kontextes und zur Entwicklung von verschiedenen Szenarien führen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und pädagogischer Intervention, insbesondere im Kontext von Elternschaft bei Menschen mit geistiger Behinderung. Zentrale Themen sind das Recht auf Selbstbestimmung, ethische Aspekte der pädagogischen Arbeit, Kinderwunsch und Elternschaft, Konfliktlösung durch hermeneutische Fallbesprechung und die Auseinandersetzung mit eigenen Werten und Haltungen im pädagogischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Dürfen Menschen mit geistiger Behinderung Eltern werden?
Rechtlich ist das Recht auf Familienplanung durch Gesetze wie die UN-Behindertenrechtskonvention geschützt, pädagogisch wirft es jedoch komplexe ethische Fragen auf.
Welches Dilemma entsteht für pädagogische Fachkräfte?
Es besteht ein Spannungsfeld zwischen der Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung und der Sorge um das Wohl des Kindes sowie der Überforderung der Eltern.
Was ist eine hermeneutische Fallbesprechung?
Es ist eine Methode zur ethischen Entscheidungsfindung, bei der eine konkrete Situation (z. B. der Kinderwunsch einer Klientin) im Team multiperspektivisch analysiert wird.
Wie hat sich die Sicht auf die Sexualität behinderter Menschen gewandelt?
Noch vor Jahrzehnten galt sie oft als Tabu; heute sind Partnerschaften, Paarwohnungen und Hochzeiten in Einrichtungen zunehmend Normalität.
Warum wird Elternschaft bei geistiger Behinderung oft kritisch gesehen?
Bedenken betreffen oft die Erziehungskompetenz, die notwendige Unterstützung durch Dritte und die langfristige Verantwortung für die kindliche Entwicklung.
- Arbeit zitieren
- Stefan Cornelius (Autor:in), 2015, Tabu oder Normalität? Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295327