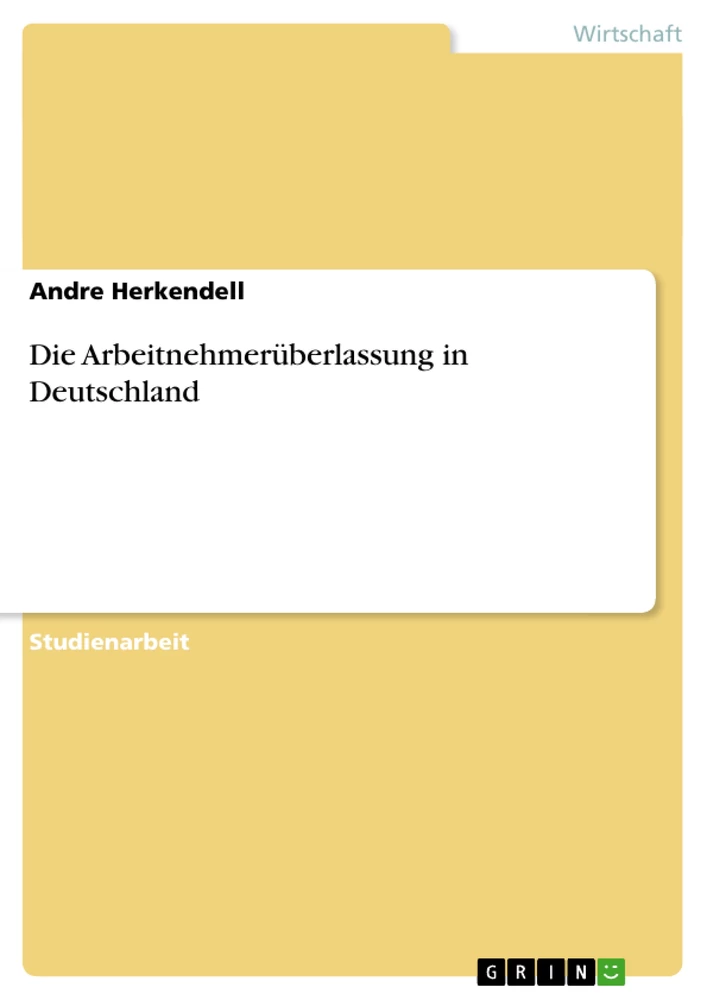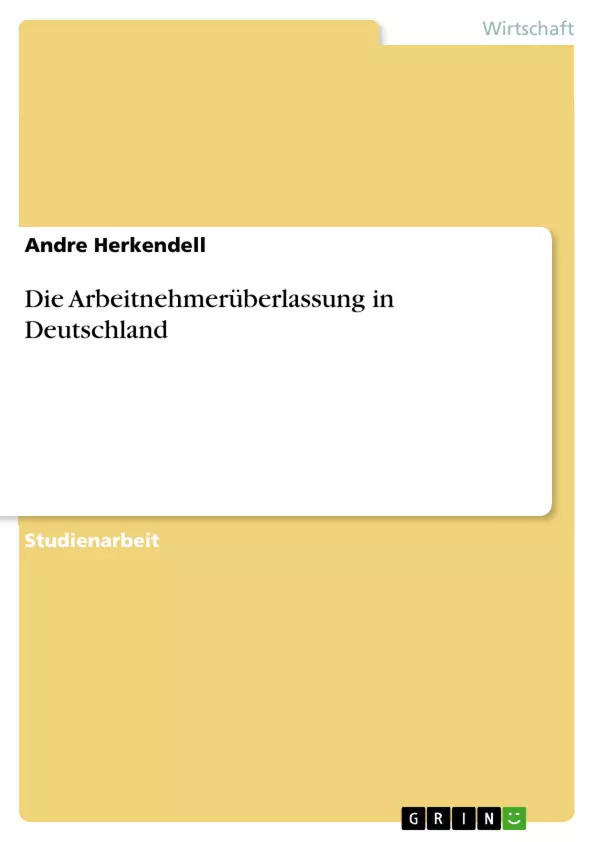In einem normalen Arbeitsverhältnis sind die Rollen klar verteilt: Während der Arbeitnehmer seine Dienste nach Weisungen des Arbeitgebers zu erbringen hat, ist dieser zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
Bei der Arbeitnehmerüberlassung wird ein Dritter mit in das Arbeitsverhältnis einbezogen. Somit entsteht ein Dreiecksverhältnis.
Gegenstand dieser Hausarbeit soll die Darstellung der recht-lichen Beziehungen zwischen den Beteiligten und der Besonderheiten der zugrunde liegenden Verträge sein. Vorher werden jedoch die Grundstrukturen der Arbeitnehmerüberlassung geklärt und es soll auf gewerberechtliche Aspekte eingegangen werden, die von großer Bedeutung sind, da ohne die Erteilung einer Erlaubnis die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung verboten ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundstrukturen der Arbeitnehmerüberlassung
- I. Begriffe
- II. Gewerbsmäßige und nichtgewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung
- III. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- 1. Der räumliche Geltungsbereich
- 2. Der gegenständliche Geltungsbereich
- IV. Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung zum Werkvertrag
- V. Abgrenzung zur Arbeitsvermittlung
- C. Gewerbliche Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung
- I. Erlaubnispflicht
- II. Erteilung der Erlaubnis
- III. Versagungsgründe des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AÜG
- IV. Versagungsgründe bei grenzüberschreitender gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung gemäß § 3 Abs. 2 bis 5 AÜG
- V. Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis
- VI. Anzeige- und Auskunftspflichten des Verleihers
- VII. Statistische Meldungen
- D. Rechtsbeziehungen bei gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung
- I. Rechtliche Beziehungen zwischen Verleiher und Entleiher
- II. Rechtliche Beziehungen zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer
- III. Rechtliche Beziehungen zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer
- IV. Arbeitnehmerüberlassung und Betriebsverfassungsrecht
- E. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Semesterarbeit untersucht die Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland. Ziel ist es, die grundlegenden Strukturen, rechtlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Aspekte dieses Arbeitsmodells darzustellen. Die Arbeit beleuchtet die Beziehungen zwischen den beteiligten Parteien (Verleiher, Entleiher, Leiharbeitnehmer) und analysiert die relevanten Rechtsnormen.
- Rechtliche Grundlagen der Arbeitnehmerüberlassung
- Beziehungen zwischen Verleiher, Entleiher und Leiharbeitnehmer
- Gewerbliche Aspekte und Erlaubnispflicht
- Wirtschaftliche Bedeutung der Arbeitnehmerüberlassung
- Arbeitnehmerüberlassung und Betriebsverfassungsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses einführende Kapitel liefert einen Überblick über die Thematik der Arbeitnehmerüberlassung und deren wirtschaftliche Bedeutung. Es werden die Gründe für die steigende Popularität dieses Beschäftigungsmodells skizziert und die zentrale Forschungsfrage formuliert: Stellt Leiharbeit ein Risiko oder eine Chance für den Arbeitnehmer dar? Die Einleitung schafft den Kontext für die detailliertere Analyse der folgenden Kapitel.
B. Grundstrukturen der Arbeitnehmerüberlassung: Dieses Kapitel legt die fundamentalen Begriffe und Strukturen der Arbeitnehmerüberlassung dar. Es differenziert zwischen gewerbsmäßiger und nichtgewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung und erläutert das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) in seinen wesentlichen Bestandteilen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung vom Werkvertrag und der Arbeitsvermittlung gewidmet. Die Kapitelteil behandelt die rechtlichen Grundlagen und definiert die Kernbegriffe, um ein solides Fundament für das Verständnis der folgenden Kapitel zu schaffen.
C. Gewerbliche Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die gewerberechtlichen Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung. Es analysiert die Erlaubnispflicht, die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis, sowie die Versagungsgründe. Das Kapitel beschreibt detailliert die Anforderungen an die Verleiher, die Meldepflichten und die rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen. Die Ausführungen gehen über die reine Darstellung der gesetzlichen Bestimmungen hinaus und erläutern deren praktische Relevanz und Anwendung.
D. Rechtsbeziehungen bei gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung: In diesem Kapitel werden die rechtlichen Beziehungen zwischen den drei beteiligten Parteien – Verleiher, Entleiher und Leiharbeitnehmer – detailliert untersucht. Es analysiert die jeweiligen Verträge (Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, Arbeitsvertrag) und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten. Schwerpunkte bilden die Leistungspflichten der Vertragspartner, die Beendigung der Vertragsverhältnisse, und die Haftung im Falle von Sozialversicherungsbeiträgen. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle des Betriebsverfassungsrechts im Kontext der Arbeitnehmerüberlassung.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), Verleiher, Entleiher, Leiharbeitnehmer, Arbeitsvertrag, Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, Erlaubnispflicht, Gewerberecht, Rechtsbeziehungen, Betriebsverfassungsrecht, wirtschaftliche Bedeutung, Risiko, Chance.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Semesterarbeit: Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Semesterarbeit?
Die Semesterarbeit untersucht die Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland. Sie beleuchtet die grundlegenden Strukturen, rechtlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Aspekte dieses Arbeitsmodells und analysiert die Beziehungen zwischen Verleiher, Entleiher und Leiharbeitnehmer sowie die relevanten Rechtsnormen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: Rechtliche Grundlagen der Arbeitnehmerüberlassung, Beziehungen zwischen den beteiligten Parteien (Verleiher, Entleiher, Leiharbeitnehmer), gewerbliche Aspekte und Erlaubnispflicht, wirtschaftliche Bedeutung der Arbeitnehmerüberlassung und die Rolle des Betriebsverfassungsrechts.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: A. Einleitung: Überblick über die Thematik und die Forschungsfrage (Stellt Leiharbeit ein Risiko oder eine Chance für den Arbeitnehmer dar?). B. Grundstrukturen der Arbeitnehmerüberlassung: Definitionen, Abgrenzung zu Werkvertrag und Arbeitsvermittlung, Erläuterung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). C. Gewerbliche Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung: Erlaubnispflicht, Erteilung und Versagung der Erlaubnis, Meldepflichten. D. Rechtsbeziehungen bei gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung: Detaillierte Analyse der rechtlichen Beziehungen zwischen Verleiher, Entleiher und Leiharbeitnehmer, inklusive Vertragsverhältnisse und Haftung. E. Ausblick: (Inhalt nicht im Detail beschrieben).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Darstellung der grundlegenden Strukturen, rechtlichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland. Die Beziehungen zwischen den beteiligten Parteien werden analysiert, und die relevanten Rechtsnormen werden erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), Verleiher, Entleiher, Leiharbeitnehmer, Arbeitsvertrag, Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, Erlaubnispflicht, Gewerberecht, Rechtsbeziehungen, Betriebsverfassungsrecht, wirtschaftliche Bedeutung, Risiko, Chance.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in die Kapitel A. Einleitung, B. Grundstrukturen der Arbeitnehmerüberlassung (mit Unterpunkten zu Begriffen, gewerbsmäßiger/nichtgewerbsmäßiger Überlassung, AÜG, Abgrenzung zu Werkvertrag und Arbeitsvermittlung), C. Gewerbliche Aspekte der Arbeitnehmerüberlassung (mit Unterpunkten zu Erlaubnispflicht, Erteilung, Versagungsgründe, Meldepflichten etc.), D. Rechtsbeziehungen bei gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung (mit Unterpunkten zu den Beziehungen zwischen den beteiligten Parteien und Betriebsverfassungsrecht) und E. Ausblick.
- Quote paper
- Andre Herkendell (Author), 2004, Die Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29547