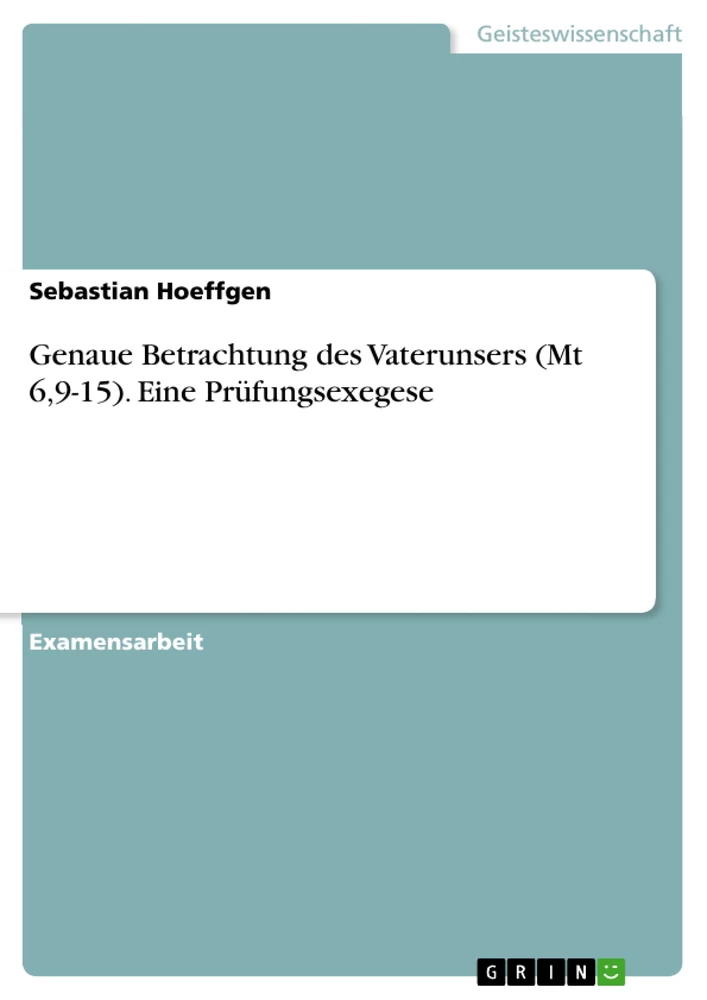Die Verse aus Matthäus 6,9-15 gehören wohl ohne Übertreibung zu den bekanntesten Texten der gesamten
christlichen Bibel und haben eine enorme Wirkungsgeschichte (gehabt). Das sogenannte „Vaterunser“ ist
auch heute noch Menschen aus allen Schichten (in der westlichen Welt) mehr oder weniger geläufig, selbst
dort, wo man sich vom Christentum oder der Religion im Allgemeinen distanziert hat.
Das Gebet, das den Jüngern Jesu von ihm selbst als Mustergebet gelehrt wurde, hat seinen Platz in der Mitte
der Bergpredigt und wird deshalb zu Recht ihr Zentrum genannt. Unzählige Generationen von Christen nutzten
dieses Gebet als Ausdruck ihrer Frömmigkeit, wurden davon angesprochen und zum Leben aus dem Glauben
inspiriert und selbst wenn ganze Kirchen sich spalteten galt den unterschiedlichen christlichen Denominationen
das Vaterunser als gemeimes und unzerstörbares Gut.
Trotz oder gerade wegen der Bekanntheit des Textes, ist es nicht selten der Fall, dass die genaue Beachtung von
einzelnen Worten oder ganzen Sätzen nicht mehr so genau erfolgt. Die Aufgabe sorgfältiger Auslegung ist es des.
halb, den Sinn der gesprochenen Worte genau zu erheben. Was sollte von Anfang an mit diesem Gebet ausgesagt
werden? Welche Bedeutung liegt den einzelnen Begriffen zu Grunde, mit denen Gott angerufen wird?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einleitungsfragen
- 2.1. Literaturgattung
- 2.2. Verfasser
- 2.2.1. Exkurs: Die synoptische Frage
- 2.2.2. Argumente für und gegen den Apostel Matthäus als Verfasser
- 2.3. Abfassungsort – und Zeit
- 2.4. Empfänger & Zielsetzung
- 2.5. Charakteristische Merkmale und Besonderheiten
- 2.6. Textart und heilsgeschichtliche Einordnung
- 2.7. Textzusammenhang
- 2.7.1. Weiterer Kontext
- 2.7.2. Engerer Kontext
- 3. Exegese von Mt 6,9-15
- 3.1. Textthema und Gedankengang
- 3.2. Einzelexegese
- 3.2.1. V.9
- Exkurs: Gott als Vater
- 3.2.2. V.10
- Exkurs: Die Königsherrschaft Gottes im AT
- 3.2.3. V.11
- 3.2.4. V.12
- 3.2.5. V.13
- Exkurs: Schlussdoxologie
- 3.2.6. V.14
- 3.2.7. V.15
- 4. Zusammenfassende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Matthäus 6,9-15, das Vaterunser, mit dem Ziel, den ursprünglichen Sinn des Gebets und die Bedeutung der einzelnen Begriffe zu ergründen. Die Exegese betrachtet den Text im Kontext der Bergpredigt und des gesamten Matthäusevangeliums.
- Literarische Gattung und Verfasserfrage des Matthäusevangeliums
- Kontextualisierung des Vaterunsers innerhalb der Bergpredigt
- Einzelne Verse des Vaterunsers und deren Bedeutung
- Heilsgeschichtliche Einordnung des Textes
- Rezeption und Wirkungsgeschichte des Vaterunsers
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Bekanntheit und Relevanz des Vaterunsers, trotz dessen oft oberflächlicher Behandlung. Sie begründet die Notwendigkeit einer genauen exegetischen Untersuchung, um den ursprünglichen Sinn des Gebets zu verstehen und seine Bedeutung für verschiedene Generationen von Christen herauszuarbeiten. Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz, der eine Textgliederung, Einzelexegese und die Berücksichtigung textlicher, literarischer und historischer Fragen umfasst.
2. Einleitungsfragen: Dieses Kapitel behandelt grundlegende Fragen zur Interpretation des Matthäusevangeliums und des Vaterunsers. Es untersucht die literarische Gattung des Evangeliums, diskutiert die Verfasserfrage und beleuchtet die Abfassungszeit und den Abfassungsort. Der Empfängerkreis und die Zielsetzung des Evangeliums werden ebenso analysiert wie charakteristische Merkmale. Ein Abschnitt widmet sich der synoptischen Frage, indem die Abhängigkeitsverhältnisse der synoptischen Evangelien untersucht werden. Schließlich werden heilsgeschichtliche Einordnung und der Textzusammenhang betrachtet. Die Frage der literarischen Gattung des Evangeliums wird tiefgründig untersucht, wobei die ursprüngliche Bedeutung von „Evangelium“ als „frohe Botschaft“ herausgearbeitet wird.
3. Exegese von Mt 6,9-15: Dieser Abschnitt beinhaltet die detaillierte exegetische Untersuchung des Vaterunsers (Mt 6,9-15). Er beginnt mit der Bestimmung des Textthemas und des Gedankengangs. Die Einzelexegese analysiert jeden Vers einzeln, indem sie grammatikalische, sprachliche und theologische Aspekte untersucht. Exkurse zu spezifischen Themen wie „Gott als Vater“ und „Die Königsherrschaft Gottes im AT“ vertiefen das Verständnis einzelner Passagen. Die Analyse jedes Verses bietet detaillierte Erklärungen und verweist auf relevante Parallelen im Alten Testament und im Kontext der Bergpredigt. Die Kapitel 3.2.1 bis 3.2.7 untersuchen die einzelnen Verse des Vaterunsers. Jedes Kapitel analysiert den jeweiligen Vers im Detail.
Schlüsselwörter
Vaterunser, Matthäusevangelium, Bergpredigt, Exegese, Neues Testament, Literaturgattung, Verfasserfrage, Heilsgeschichte, Gott, Königsherrschaft Gottes, Gebet, Synoptische Evangelien, Textinterpretation.
Häufig gestellte Fragen zum Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 9-15 (Vaterunser)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Matthäus 6,9-15, das Vaterunser, mit dem Ziel, den ursprünglichen Sinn des Gebets und die Bedeutung der einzelnen Begriffe zu ergründen. Die Exegese betrachtet den Text im Kontext der Bergpredigt und des gesamten Matthäusevangeliums.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Literarische Gattung und Verfasserfrage des Matthäusevangeliums, Kontextualisierung des Vaterunsers innerhalb der Bergpredigt, Einzelne Verse des Vaterunsers und deren Bedeutung, Heilsgeschichtliche Einordnung des Textes und die Rezeption und Wirkungsgeschichte des Vaterunsers.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Einleitungsfragen (inkl. der synoptischen Frage und der Verfasserfrage des Matthäus Evangeliums), die Exegese von Mt 6,9-15 (mit Einzelexegesen der einzelnen Verse und Exkursen zu relevanten Themen wie „Gott als Vater“ und „Die Königsherrschaft Gottes im AT“) und eine zusammenfassende Betrachtung. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Bekanntheit und Relevanz des Vaterunsers trotz dessen oft oberflächlicher Behandlung. Sie begründet die Notwendigkeit einer genauen exegetischen Untersuchung, um den ursprünglichen Sinn des Gebets zu verstehen und seine Bedeutung für verschiedene Generationen von Christen herauszuarbeiten. Der methodische Ansatz der Arbeit wird skizziert.
Was sind die „Einleitungsfragen“?
Dieses Kapitel behandelt grundlegende Fragen zur Interpretation des Matthäusevangeliums und des Vaterunsers. Es untersucht die literarische Gattung des Evangeliums, diskutiert die Verfasserfrage und beleuchtet die Abfassungszeit und den Abfassungsort. Der Empfängerkreis und die Zielsetzung des Evangeliums werden ebenso analysiert wie charakteristische Merkmale. Es widmet sich der synoptischen Frage und betrachtet die heilsgeschichtliche Einordnung und den Textzusammenhang.
Wie wird die Exegese von Mt 6,9-15 durchgeführt?
Dieser Abschnitt beinhaltet die detaillierte exegetische Untersuchung des Vaterunsers (Mt 6,9-15). Er beginnt mit der Bestimmung des Textthemas und des Gedankengangs. Die Einzelexegese analysiert jeden Vers einzeln, indem sie grammatikalische, sprachliche und theologische Aspekte untersucht. Exkurse zu spezifischen Themen vertiefen das Verständnis einzelner Passagen. Die Analyse jedes Verses bietet detaillierte Erklärungen und verweist auf relevante Parallelen im Alten Testament und im Kontext der Bergpredigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Vaterunser, Matthäusevangelium, Bergpredigt, Exegese, Neues Testament, Literaturgattung, Verfasserfrage, Heilsgeschichte, Gott, Königsherrschaft Gottes, Gebet, Synoptische Evangelien, Textinterpretation.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Exegese, die eine Textgliederung, Einzelexegese und die Berücksichtigung textlicher, literarischer und historischer Fragen umfasst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Matthäus Evangelium auf strukturierte und professionelle Weise.
- Citar trabajo
- Sebastian Hoeffgen (Autor), 2012, Genaue Betrachtung des Vaterunsers (Mt 6,9-15). Eine Prüfungsexegese, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295652