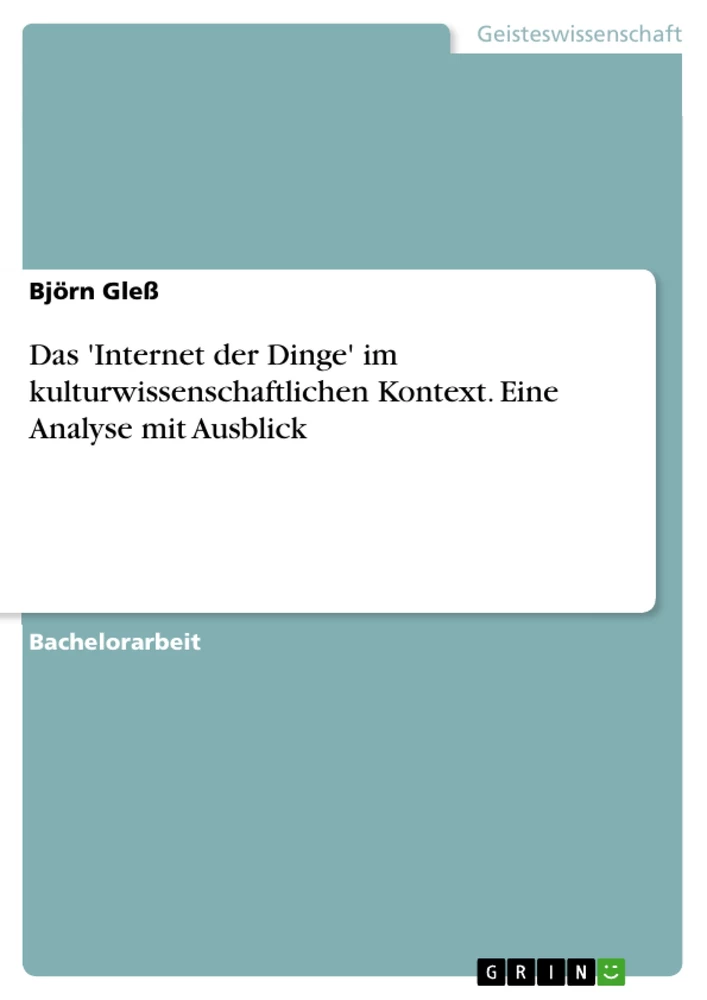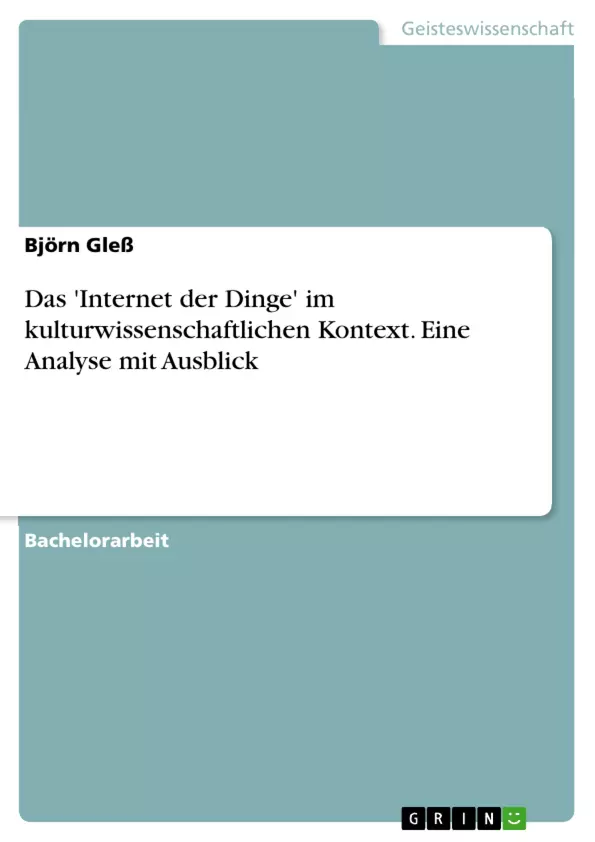Künstliche Intelligenz und damit auch ,intelligente Dinge‘, wie es die Pioniere des ,Internet der Dinge‘ versprechen, sind nicht mehr reißerische Thesen von Technikfanatikern und Science-Fiction Autoren, sondern haben bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts Eingang in die Wissenschaft gefunden. Doch was passiert mit den Fähigkeiten, die der Mensch einmal entwickelte, schulte und anwendete um sich in fremder Umgebung zurechtzufinden? Nur eine der spannenden Fragen, die mich bei der Bearbeitung dieses Themas begleitet haben.
Konkrete Antworten auf Fragen wie diese, werden in dieser Arbeit nicht zu finden sein. Vielmehr soll versucht werden, die Überlegungen und Konzepte zu einem ,Internet der Dinge‘ vor kulturwissenschaftlichem Hintergrund zu untersuchen. Dazu ist es notwendig nach einer kurzen Skizze der technischen Voraussetzungen und des heutigen Standes der Technik, das Konzept in seine Einzelteile zu zerlegen und diese Einzelteile mit soziohistorischem Abgleich zu analysieren.
Zielführend ist eine Betrachtung des ,Internet der Dinge‘ im Kontext sozialwissenschaftlicher Überlegungen, die es seit Ende des 19. und schließlich im weiteren Verlaufe des 20. Jahrhunderts gab. Eine Verknüpfung des im Vergleich eher jungen technologischen Konzepts mit Klassikern der Kulturwissenschaft wie Max Weber, Georg Simmel und Niklas Luhmann scheint auch im Hinblick auf die Subjekt-Objekt Terminologie vielversprechend.
Untersucht werden soll inwieweit sich die gesellschaftstheoretischen Konstrukte jener Vordenker auf das jetzige Aufeinandertreffen von Individuum und künstlicher Intelligenz in gesellschaftlichem Rahmen übertragen lassen. Haben wir es vielleicht sogar mit einer Umkehrung der Subjekt-Objekt-Beziehung zu tun, wenn wir die fortschreitende Ermächtigung technischer Geräte und künstlicher Intelligenz etwas weiter spinnen? Sind klar getrennte Begriffe wie Subjekt und Objekt überhaupt noch haltbar in der Beschreibung relativer Verhältnisse zwischen Mensch und Computer?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen und Fremdwortverzeichnis
- Fremdsprachliche Kurzzusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Das Internet der Dinge
- 2.1 Mark Weiser und Kevin Ashton als Wegbereiter
- 2.2 RFID technische Voraussetzungen
- 2.3 Stand der Technik heute
- 3. Kulturwissenschaftliche Einbettung
- 3.1 Klassiker
- 3.1.1 Georg Simmel und der Exkurs zu Frank Schirrmacher
- 3.1.2 Max Weber und der Exkurs zu Jeremy Rifkin
- 3.1.3 Niklas Luhmann und die Systemtheorie
- 3.2 Subjekt - Objekt Betrachtungen: Andreas Reckwitz und die ANT
- 3.1 Klassiker
- 4. Abschließende Betrachtung: Entzauberung oder Verzauberung der Welt?
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des „Internet der Dinge“ (IoT) und seiner Bedeutung im kulturwissenschaftlichen Kontext. Sie untersucht die historischen Wurzeln des IoT, seine technischen Voraussetzungen und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dabei werden drei wichtige Theoretiker der deutschen Soziologie – Georg Simmel, Max Weber und Niklas Luhmann – herangezogen, um die Relevanz des IoT für die moderne Gesellschaft zu beleuchten. Darüber hinaus wird die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt im Kontext des IoT mithilfe der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) analysiert.
- Die historischen Wurzeln des „Internet der Dinge“
- Die technischen Voraussetzungen des „Internet der Dinge“
- Die Auswirkungen des „Internet der Dinge“ auf die Gesellschaft
- Die Relevanz des „Internet der Dinge“ im Kontext der Soziologie
- Die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt im Kontext des „Internet der Dinge“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des „Internet der Dinge“ vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung im Kontext der heutigen Informationsgesellschaft. Kapitel 2 beleuchtet die historischen Wurzeln des IoT und die technischen Voraussetzungen seiner Realisierung. Kapitel 3 betrachtet das IoT aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive und analysiert die Relevanz der Theorien von Georg Simmel, Max Weber und Niklas Luhmann für das Verständnis des IoT. Kapitel 4 untersucht die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt im Kontext des IoT und beleuchtet die Bedeutung der Akteur-Netzwerk-Theorie. Kapitel 5 bietet eine abschließende Betrachtung des IoT und diskutiert die möglichen Folgen der Digitalisierung für die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Internet der Dinge, Ubiquitous Computing, Continuous Computing, RFID, Akteur-Netzwerk-Theorie, Georg Simmel, Max Weber, Niklas Luhmann, Digitalisierung, Informationsgesellschaft, Gesellschaft, Kulturwissenschaften, Soziologie, Subjekt, Objekt, Technologie, Kommunikation, Vernetzung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Internet der Dinge“ (IoT)?
Es beschreibt die Vernetzung von physischen Objekten mit dem Internet, sodass diese „intelligent“ interagieren können.
Welche kulturwissenschaftlichen Theoretiker werden herangezogen?
Die Arbeit verknüpft das technologische Konzept mit Klassikern wie Max Weber, Georg Simmel und Niklas Luhmann.
Verändert das IoT die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die fortschreitende Ermächtigung technischer Geräte zu einer Umkehrung oder Auflösung der klassischen Subjekt-Objekt-Beziehung führt.
Welche Rolle spielt die RFID-Technik?
RFID gilt als eine der technischen Grundvoraussetzungen für die Identifikation und Vernetzung von Dingen im IoT.
Wer waren die Wegbereiter des Internet der Dinge?
Mark Weiser (Ubiquitous Computing) und Kevin Ashton gelten als wichtige Pioniere dieses Konzepts.
- Quote paper
- Björn Gleß (Author), 2015, Das 'Internet der Dinge' im kulturwissenschaftlichen Kontext. Eine Analyse mit Ausblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295712