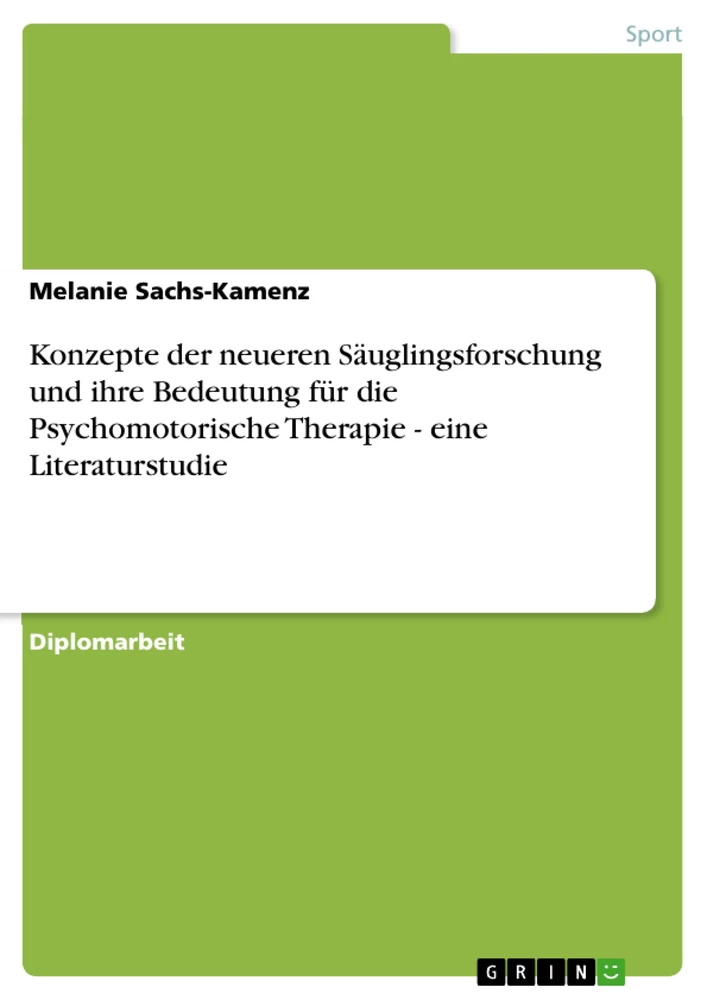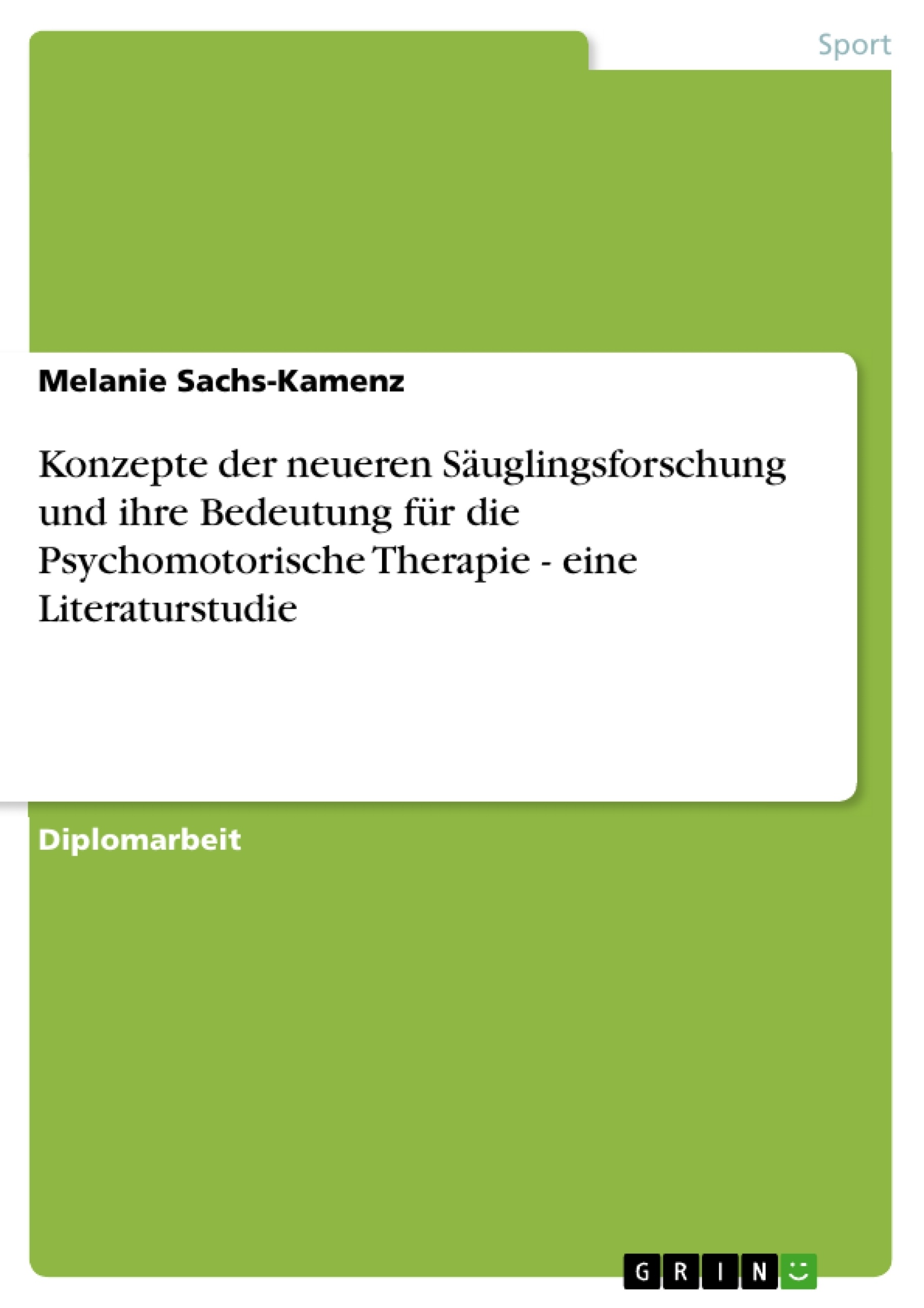EINLEITUNG
Menschliche Bewegung ist ohne die Beteiligung hintergründig ablaufender psychischer und gefühlsmäßiger Prozesse nicht denkbar. Wahrnehmung und Bewegung werden von ZIMMER (1989, 95) als unmittelbar miteinander verbunden betrachtet und motorische Aktivitäten und Sinneseindrücke als funktionelle Einheit
verstanden.
Die Psyche, in der griechischen Mythologie eine Gestalt von vollendeter Schönheit, ist untrennbar mit der Gesamtheit aller Bewegungen, der Motorik verknüpft. Wenn das Leben des Menschen nur als Bewegung und in Bewegung möglich ist, dann entspricht die Qualität des Lebens der Qualität der Bewegung. Die Lebensbedingungen der westlichen Industriegesellschaft mit ihrem zunehmenden
Medienkonsum und ihrer fortschreitenden Urbanisierung schränken die Lern- und Bewegungsmöglichkeiten von Erwachsenen und Kindern so stark ein, daß ein immer größeres Bedürfnis nach psychomotorischer Förderung und Erziehung entsteht.
Daß Bewegungen vom Zeitpunkt der Zeugung an ein wesentliches Merkmal
menschlicher Existenz sind und maßgeblich zur Ausgestaltung des Organismus beitragen, verdeutlicht die Darstellung humanembryologischer Erkenntnisse nach BLECHSCHMIDT (1989). Die Erkenntnisse der pränatalen Psychologie sensibilisieren für die Auswirkungen der verschiedenen Umwelteinflüsse, die bereits
im Mutterleib auf die Psyche des Kindes einwirken.
Die Untersuchungen von Daniel STERN (2000) und Martin DORNES (1999 &
2001) zur Entwicklung des Selbstempfindens in frühester Kindheit als Grundlage des subjektiven Erlebens, der Selbstreflexion und der sozialen Interaktion, führen zu einer gänzlich anderen Betrachtung des neugeborenen Kindes. Ihre Erkenntnisse zur Entwicklung und Entstehung des Selbstkonzepts - der Selbstwahrnehmung und der
Selbstwirksamkeit - tragen zu einem neuen Verständnis der Fähigkeiten von Ungeborenen und Säuglingen bei. Das primäre subjektive Empfinden des Körperselbst, das auch die Gestaltung aller sozialen Kontakte maßgeblich beeinflußt, bleibt für den Menschen während seiner gesamten Lebensspanne relevant.
Das Selbstkonzept, als lebenslang überdauerndes Bild des Menschen von sich selbst, ist nach STERN (2000) daher ebenfalls in hohem Maße Resultat von Bewegungen in Gestalt der Körpererfahrungen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gegenwärtige Theorien der Entwicklungspsychologie
- 2.1 Der Säugling in der psychologischen Forschung
- 2.2 Die Untersuchungsmethoden der neueren Säuglingsforschung
- 2.3 Methodenkritik
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Die pränatale Entwicklung
- 3.1 Die frühe embryologische Entwicklung des Menschen nach Erich BLECHSCHMIDT
- 3.2 Die pränatale Entwicklung der Sinne
- 3.2.1 Die pränatale Entwicklung des zentralen Nervensystems
- 3.2.2 Die Augen
- 3.2.3 Die Ohren
- 3.2.4 Der Geruch
- 3.2.5 Der Geschmack
- 3.2.6 Die Haut
- 3.3 Die pränatale Entwicklung der Motorik
- 3.4 Die pränatale Mutter-Kind-Beziehung
- 3.5 Praktische Folgerungen für die Betreuung von Schwangeren
- 3.6 Zusammenfassung
- 4. Die Geburt
- 4.1 Die Bedeutung der prä- und perinatalen Risiken für die psychologische Entwicklung
- 4.2 Zusammenfassung
- 5. Die postnatale Entwicklung
- 5.1 Das Neugeborenenverhalten
- 5.1.1 Das Saugen und seine psychologische Bedeutung
- 5.1.2 Das Nachahmungsverhalten von Neugeborenen
- 5.1.3 Die Ablösung des Neugeborenenverhaltens
- 5.2 Die Entwicklung der Sinne
- 5.2.1 Das visuelle System
- 5.2.2 Das auditive System
- 5.2.3 Das vestibuläre System
- 5.2.4 Das olfaktorische und gustatorische System
- 5.2.4.1 Der Geruchssinn
- 5.2.4.2 Der Geschmackssinn
- 5.2.5 Das taktile System
- 5.2.6 Das kinästhetische System
- 5.3 Zur Integration der Sinneswahrnehmungen
- 5.4 Die statomotorische Entwicklung
- 5.4.1 Frühkindliche Reaktionen und Reflexe
- 5.4.1.1 Orale Reflexe
- 5.4.1.2 Die Körperreflexe
- 5.4.2 Kindliche Aktionen in Haltung, Bewegung und Gleichgewicht
- 5.4.2.1 Stellreaktionen
- 5.4.2.2 Bewegungsreaktionen
- 5.4.2.3 Gleichgewichtsreaktionen
- 5.4.1 Frühkindliche Reaktionen und Reflexe
- 5.5 Motorische Veränderungen im Säuglingsalter
- 5.5.1 Das Greifen
- 5.5.2 Die Auge-Hand-Koordination
- 5.5.3 Das Krabbeln
- 5.5.4 Das Laufen
- 5.6 Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Bewegung
- 5.7 Die Bindungstheorie
- 5.7.1 Grundannahmen der Bindungstheorie
- 5.7.2 Repräsentationen von Bindungsmustern und ihre Bedeutung
- 5.8 Zusammenfassung
- 5.1 Das Neugeborenenverhalten
- 6. Perspektiven der Entwicklungforschung
- 6.1 Die Entwicklung des Selbstempfindens als organisierendes Prinzip der Entwicklung
- 6.2 Die vier Selbstempfindungen nach Daniel STERN
- 6.2.1 Das auftauchende Selbst
- 6.2.1.1 Amodale Wahrnehmung
- 6.2.1.2 Physiognomische Wahrnehmung
- 6.2.1.3 Vitalitätsaffekte
- 6.2.2 Das Empfinden eines Kern-Selbst
- 6.2.2.1 Urheberschaft des eigenen Handelns
- 6.2.2.2 Selbst-Kohärenz
- 6.2.2.3 Selbst-Affektivität
- 6.2.2.4 Selbst-Geschichtlichkeit
- 6.2.3 Das subjektive Selbst
- 6.2.3.1 Affektabstimmung
- 6.2.4 Das verbale Selbst
- 6.2.1 Das auftauchende Selbst
- 6.3 Zusammenfassung
- 7. Psychomotorische Therapie - Definition, Ziele und Inhalte
- 7.1 Entwicklungsüberprüfung und -beobachtung
- 7.1.1 Entwicklungsfrühdiagnostik
- 7.2 Sensomotorische und psychomotorische Fehlanpassungen
- 7.3 Konzeptionelle Ansätze in der Psychomotorik
- 7.3.1 Die Psychomotorische Übungsbehandlung nach Ernst KIPHARD
- 7.3.2 Die sensorische Integrationsbehandlung nach Jean AYRES
- 7.3.3 Der Systemisch-konstruktivistische Ansatz der Psychomotorik
- 7.3.4 Die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung
- 7.4 Konsequenzen für die Praxis der Psychomotorik
- 7.4.1 Selbstkonzept und Identität – Schlüsselbegriffe psychomotorischer Förderung
- 7.4.2 Die Bedeutung der neueren Entwicklungspsychologie für die Psychomotorik
- 7.4.3 Säuglingsschwimmen – ein Beispiel der psychomotorischen Förderung
- 7.5 Zusammenfassung
- 7.1 Entwicklungsüberprüfung und -beobachtung
- 8. Diskussion und Ausblick - Die Bedeutung der Selbstentwicklung in der Lebensspanne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Konzepte der neueren Säuglingsforschung und deren Relevanz für die psychomotorische Therapie. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Säuglingsentwicklung zu vermitteln und die daraus resultierenden Implikationen für die therapeutische Praxis aufzuzeigen.
- Pränatale Entwicklung und ihre Auswirkungen
- Postnatale Entwicklung der Sinne und Motorik
- Theorien der Bindung und Selbstentwicklung
- Konzeptionelle Ansätze der psychomotorischen Therapie
- Bedeutung der Säuglingsforschung für die psychomotorische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Bedeutung der Säuglingsforschung für die psychomotorische Therapie. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die Forschungsfragen.
2. Gegenwärtige Theorien der Entwicklungspsychologie: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über aktuelle Theorien der Entwicklungspsychologie im Hinblick auf den Säugling. Er beleuchtet verschiedene Forschungsmethoden und deren Limitationen. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und bereitet den Boden für die folgenden Kapitel.
3. Die pränatale Entwicklung: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Entwicklung des Säuglings im Mutterleib, beginnend mit der frühen embryologischen Entwicklung nach Blechschmidt. Es werden die pränatale Entwicklung der Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) und der Motorik detailliert beschrieben. Die Bedeutung der pränatalen Mutter-Kind-Beziehung und praktische Folgerungen für die Betreuung von Schwangeren werden ebenfalls behandelt. Die Zusammenfassung integriert alle Aspekte der pränatalen Entwicklung und deren Bedeutung für die spätere Entwicklung des Kindes.
4. Die Geburt: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der prä- und perinatalen Risiken für die spätere psychologische Entwicklung des Kindes. Es werden kritische Phasen und potenzielle Komplikationen während der Geburt und deren Einfluss auf die Entwicklung des Säuglings diskutiert. Die Zusammenfassung fokussiert auf die Langzeitfolgen von Geburtskomplikationen und deren Relevanz für die psychomotorische Therapie.
5. Die postnatale Entwicklung: Das Kapitel beschreibt die postnatale Entwicklung des Säuglings, beginnend mit dem Neugeborenenverhalten (Saugen, Nachahmung). Die Entwicklung der verschiedenen Sinnesmodalitäten und die statomotorische Entwicklung (Reflexe, Bewegungen, Gleichgewicht) werden detailliert erläutert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Auge-Hand-Koordination, dem Greifen, Krabbeln und Laufen gewidmet. Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Bewegung sowie die Bindungstheorie werden in ihren Implikationen für die Entwicklung des Kindes umfassend diskutiert. Die Zusammenfassung integriert die verschiedenen Aspekte der postnatalen Entwicklung und deren Interdependenzen.
6. Perspektiven der Entwicklungforschung: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des Selbstempfindens nach Daniel Stern. Die vier Selbstempfindungen (auftauchendes Selbst, Kern-Selbst, subjektives Selbst, verbales Selbst) werden ausführlich beschrieben und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Kindes analysiert. Die Zusammenfassung betont die Bedeutung des Selbstempfindens als organisierendes Prinzip der Entwicklung.
7. Psychomotorische Therapie - Definition, Ziele und Inhalte: Dieses Kapitel definiert die psychomotorische Therapie, beschreibt ihre Ziele und Inhalte. Es werden verschiedene konzeptionelle Ansätze (z.B. nach Kiphard, Ayres) vorgestellt und deren praktische Anwendung erläutert. Die Bedeutung des Selbstkonzepts und der Identität für die psychomotorische Förderung wird hervorgehoben, und die Relevanz der neueren Entwicklungspsychologie für die Praxis wird diskutiert. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Aspekte der psychomotorischen Therapie und deren theoretische Grundlagen zusammen.
Schlüsselwörter
Säuglingsforschung, Entwicklungspsychologie, Psychomotorik, pränatale Entwicklung, postnatale Entwicklung, Sinnesentwicklung, Motorikentwicklung, Bindungstheorie, Selbstentwicklung, Selbstempfinden, Daniel Stern, Jean Ayres, Ernst Kiphard, psychomotorische Therapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Säuglingsentwicklung und Psychomotorische Therapie
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Konzepte der neueren Säuglingsforschung und deren Relevanz für die psychomotorische Therapie. Ziel ist ein umfassendes Verständnis der Säuglingsentwicklung und die daraus resultierenden Implikationen für die therapeutische Praxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die pränatale Entwicklung, die postnatale Entwicklung der Sinne und Motorik, Theorien der Bindung und Selbstentwicklung, konzeptionelle Ansätze der psychomotorischen Therapie und die Bedeutung der Säuglingsforschung für die psychomotorische Praxis. Konkret werden die Entwicklungsphasen vom pränatalen Stadium bis zum Säuglingsalter detailliert beschrieben, inklusive der Entwicklung der Sinne, der Motorik und des Selbstempfindens.
Welche Theorien und Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert aktuelle Theorien der Entwicklungspsychologie, die Bindungstheorie, die Selbstempfindung nach Daniel Stern (auftauchendes Selbst, Kern-Selbst, subjektives Selbst, verbales Selbst) und verschiedene konzeptionelle Ansätze in der Psychomotorik, wie die Ansätze nach Ernst Kiphard und Jean Ayres.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Gegenwärtige Theorien der Entwicklungspsychologie, Pränatale Entwicklung, Geburt, Postnatale Entwicklung, Perspektiven der Entwicklungforschung, Psychomotorische Therapie und Diskussion/Ausblick. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Welche Aspekte der pränatalen Entwicklung werden behandelt?
Die pränatale Entwicklung wird umfassend behandelt, von der frühen embryologischen Entwicklung nach Blechschmidt bis zur Entwicklung der einzelnen Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) und der Motorik. Die Bedeutung der pränatalen Mutter-Kind-Beziehung und praktische Folgerungen für die Betreuung von Schwangeren werden ebenfalls thematisiert.
Welche Aspekte der postnatalen Entwicklung werden behandelt?
Die postnatale Entwicklung umfasst die Beschreibung des Neugeborenenverhaltens (Saugen, Nachahmung), die Entwicklung der verschiedenen Sinnesmodalitäten, die statomotorische Entwicklung (Reflexe, Bewegungen, Gleichgewicht), die Auge-Hand-Koordination, das Greifen, Krabbeln und Laufen. Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Bewegung sowie die Bindungstheorie werden ebenfalls ausführlich diskutiert.
Welche Rolle spielt die Bindungstheorie?
Die Bindungstheorie spielt eine wichtige Rolle im Verständnis der Entwicklung des Säuglings und wird in ihren Implikationen für die Entwicklung des Kindes umfassend diskutiert.
Wie wird das Selbstempfinden nach Daniel Stern behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert die vier Selbstempfindungen nach Daniel Stern (auftauchendes Selbst, Kern-Selbst, subjektives Selbst, verbales Selbst) und analysiert deren Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Das Selbstempfinden wird als organisierendes Prinzip der Entwicklung hervorgehoben.
Welche konzeptionellen Ansätze der psychomotorischen Therapie werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene konzeptionelle Ansätze der psychomotorischen Therapie vor, darunter die Ansätze nach Ernst Kiphard und Jean Ayres, sowie einen systemisch-konstruktivistischen Ansatz und die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit betont die Bedeutung der neueren Entwicklungspsychologie für die Praxis der psychomotorischen Therapie und die Relevanz der Säuglingsforschung für die Entwicklungsförderung. Es wird ein umfassendes Verständnis der Säuglingsentwicklung vermittelt und die daraus resultierenden Implikationen für die therapeutische Praxis aufgezeigt.
- Quote paper
- Melanie Sachs-Kamenz (Author), 2001, Konzepte der neueren Säuglingsforschung und ihre Bedeutung für die Psychomotorische Therapie - eine Literaturstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2958