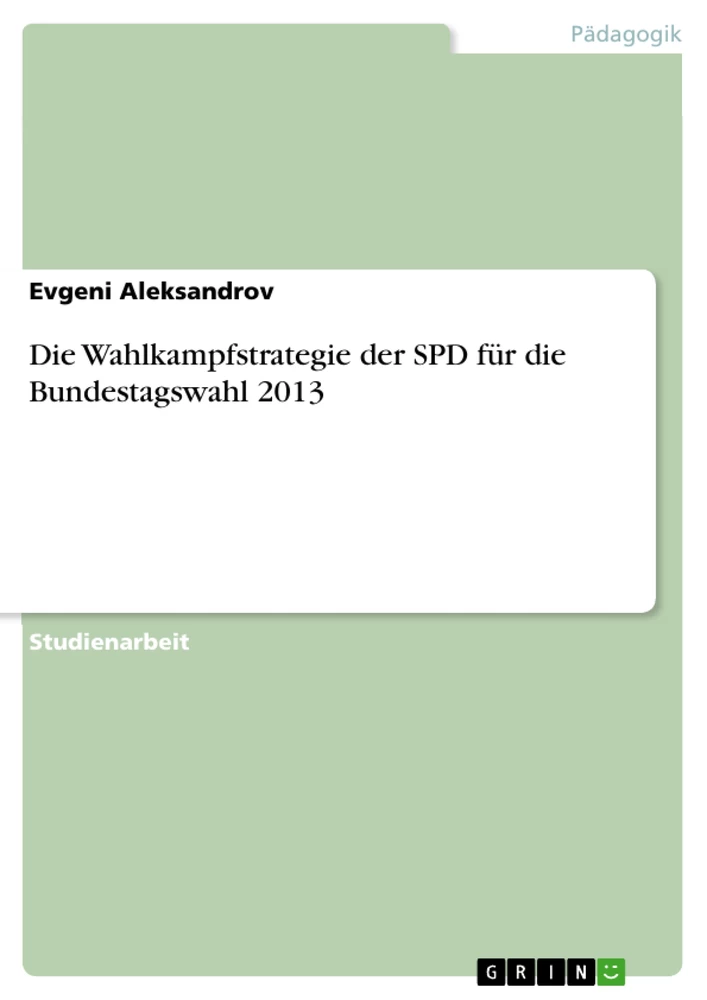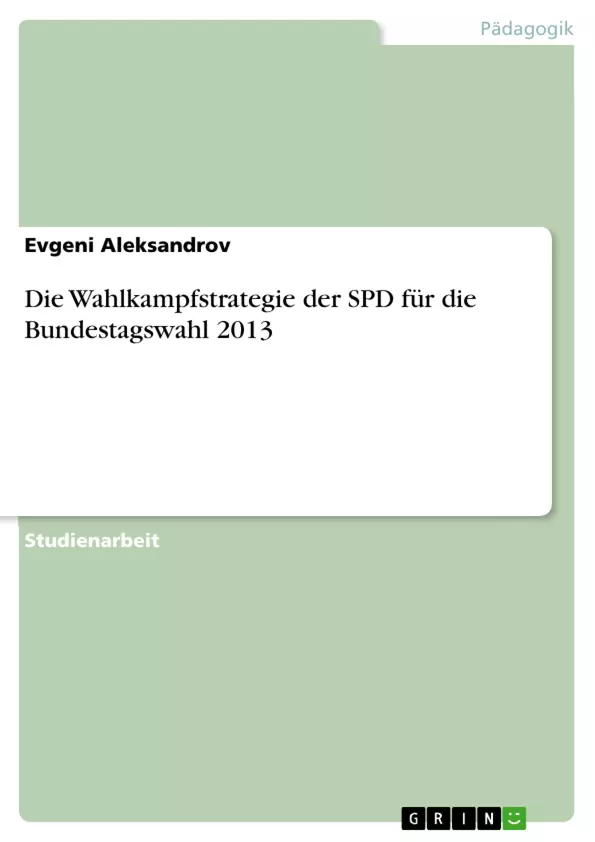Das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2013 wirft sowohl für Politikwissenschaftler als auch für politische Entscheider Fragen auf. Wie konnte aus einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Union ein Jahr vor der Wahl ein 15-prozentiger Vorsprung der Christdemokraten am Wahltag werden? Warum konnte die SPD aus ihren Erfolgen auf Landesebene in der vergangenen Legislaturperiode keinerlei Vorteile für die Bundestagswahl ziehen? Während die historische Wahlniederlage von 2009 zu einem Großteil auf die Beteiligung der Sozialdemokraten an der Großen Koalition und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten für die Kampagnenführung zurückgeführt werden kann, so drängt sich mit Blick auf den Wahlkampf 2013 eine weitere Frage auf: Wie war es möglich, aus einer Angriff vermeintlich begünstigenden Ausgangsposition als Oppositionspartei sich um lediglich zwei Prozentpunkte im Vergleich zu 2009 zu verbessern und somit das zweitschlechteste Ergebnis bei Bundestagswahlen in der Parteigeschichte zu erzielen?
Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es einerseits einer Analyse der Wahlkampfstrategie der SPD und andererseits einer sehr genauen Beleuchtung der äußeren Zwänge, die unweigerlich auf die strategischen Entscheidungen politischer Akteure einwirken. Diese beiden Aspekte sind untrennbar voneinander zu betrachten, wenn man Erfolg und Misserfolg von Wahlkämpfen erklären will. Im Falle der SPD-Wahlkampagne gilt es in dieser Arbeit zu klären, inwieweit der Misserfolg der Partei bei der Bundestagswahl durch nur bedingt beeinflussbare Faktoren vorprogrammiert oder das Resultat einer misslungener Wahlkampfstrategie war. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wird zunächst der Begriff der politischen Strategie durchleuchtet und auf den besonderen Fall der Wahlkampfkommunikation übertragen. Bevor dann die Wahlkampfstrategie der SPD ausführlich analysiert wird, werden die Ausgangsbedingungen des Bundestagswahlkampfs 2013 geschildert. Die anschließende Untersuchung der SPD-Kampagne erfolgt auf der Basis des von Joachim Raschke und Ralf Tils entwickelten Katalogs von Erfolgsfaktoren strategischen Handelns. Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die Kommunikationsleistungen der Partei im Rahmen der strategischen Wahlkampfsteuerung. Darunter fallen die Konstruktion eines Kandidatenimages, das Themen- und Ereignismanagement, die Abgrenzung vom politischen Gegner und dessen Schwächung durch gezielte Angriffe (Negative-Campaigning).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Politische Strategie
- 2.1. Innerer strategischer Prozess
- 2.2. Äußerer strategischer Prozess
- 2.3. Strategische Erfolgsfaktoren
- 3. Wahlkampfkommunikation und Kommunikationsstrategien
- 4. Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2013
- 4.1. Themenagenda
- 4.2. Mobilisierungsdefizite der SPD
- 4.3. Konsequenzen für den SPD-Wahlkampf
- 5. Die Wahlkampfstrategie der SPD
- 5.1. Strategiefähigkeit
- 5.2. Strategie
- 5.3. Strategische Steuerung
- 5.3.1. Image-Konstruktion
- 5.3.2. Themen- und Ereignismanagement
- 5.3.3 Einsatz zielgruppenorientierter Instrumente
- 5.3.4. Abgrenzung von der Konkurrenz und Negative-Campaigning
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert die Wahlkampfstrategie der SPD für die Bundestagswahl 2013 und untersucht, inwiefern ihr Misserfolg bei der Wahl durch nur bedingt beeinflussbare Faktoren vorprogrammiert oder das Resultat einer misslungenen Wahlkampfstrategie war. Dazu beleuchtet die Arbeit sowohl die innere strategische Denkweise der Partei als auch den äußeren Prozess des Strategy-Making, der sich aus Strategiefähigkeit, Strategiebildung und strategischer Steuerung zusammensetzt.
- Analyse der Wahlkampfstrategie der SPD im Kontext der Bundestagswahl 2013
- Untersuchung der inneren und äußeren Prozesse strategischen Handelns nach Raschke und Tils
- Bewertung der Kommunikationsleistungen der SPD im Rahmen der strategischen Wahlkampfsteuerung
- Bewertung des Einflusses von Faktoren, die die Wahlkampfstrategie beeinflussen
- Klärung der Frage, ob der Misserfolg der SPD durch die Wahlkampfstrategie oder durch andere Faktoren verursacht wurde
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2013 wirft Fragen nach den Ursachen des Misserfolgs auf. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage, inwiefern der Misserfolg der SPD auf eine misslungene Wahlkampfstrategie zurückzuführen ist.
- Politische Strategie: Das Kapitel erläutert den Begriff der politischen Strategie nach Raschke und Tils, die zwischen einem inneren und einem äußeren strategischen Prozess unterscheiden.
- Innerer strategischer Prozess: Dieses Kapitel beleuchtet die Bestandteile des inneren Prozesses des Strategy-Thinking: Orientierungsschema und Kalkulationen. Das Orientierungsschema umfasst relevante Bezugsgrößen wie Zeit, Arenen, Themen, Personen, Symbole, Organisation, Problempolitik, Konkurrenzpolitik, Öffentlichkeit und Wähler. Die Kalkulationen dienen der Ermittlung geeigneter Mittel zum Erreichen der strategischen Ziele.
- Äußerer strategischer Prozess: Dieses Kapitel behandelt die drei Kernelemente des Strategy-Making: Strategiefähigkeit, Strategiebildung und strategische Steuerung. Strategiefähigkeit setzt sich aus Führung, Richtung und Strategiekompetenz zusammen.
- Die Ausgangslage vor der Bundestagswahl 2013: Das Kapitel beschreibt die Ausgangslage der SPD vor der Bundestagswahl 2013, inklusive der Themenagenda, Mobilisierungsdefizite und deren Konsequenzen für den Wahlkampf.
- Die Wahlkampfstrategie der SPD: Dieses Kapitel analysiert die Wahlkampfstrategie der SPD unter Berücksichtigung der Strategiefähigkeit, der Strategie selbst und der strategischen Steuerung. Die strategische Steuerung beinhaltet die Bereiche Image-Konstruktion, Themen- und Ereignismanagement, Einsatz zielgruppenorientierter Instrumente und Abgrenzung von der Konkurrenz durch Negative-Campaigning.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Wahlkampfstrategie, der strategischen Steuerung, dem Strategy-Making, der Kommunikationsstrategie, dem Image-Management, dem Themen- und Ereignismanagement, der Abgrenzung von der Konkurrenz und dem Negative-Campaigning im Kontext der Bundestagswahl 2013. Weitere wichtige Begriffe sind: Orientierungsschema, Kalkulationen, Strategiefähigkeit, Strategiebildung, Führung, Richtung, Strategiekompetenz.
Warum schnitt die SPD bei der Bundestagswahl 2013 schlecht ab?
Die Arbeit analysiert, ob der Misserfolg auf eine misslungene Wahlkampfstrategie oder auf äußere Faktoren wie Mobilisierungsdefizite zurückzuführen war.
Was ist der „innere strategische Prozess“ nach Raschke und Tils?
Er umfasst das Orientierungsschema (Themen, Personen, Symbole) und die Kalkulationen, die eine Partei zur Erreichung ihrer Ziele anstellt.
Was bedeutet „Negative Campaigning“?
Es bezeichnet die Strategie, den politischen Gegner durch gezielte Angriffe und die Hervorhebung seiner Schwächen zu schwächen.
Wie wurde das Image des Kanzlerkandidaten 2013 konstruiert?
Die Arbeit untersucht die Kommunikationsleistungen der SPD bei der Image-Konstruktion ihres Kandidaten Peer Steinbrück im Rahmen der strategischen Wahlkampfsteuerung.
Was ist Strategiefähigkeit im politischen Kontext?
Sie setzt sich aus den Elementen Führung, Richtung und Strategiekompetenz zusammen und bestimmt, wie effektiv eine Partei ihre Ziele verfolgen kann.
- Arbeit zitieren
- Evgeni Aleksandrov (Autor:in), 2014, Die Wahlkampfstrategie der SPD für die Bundestagswahl 2013, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295874