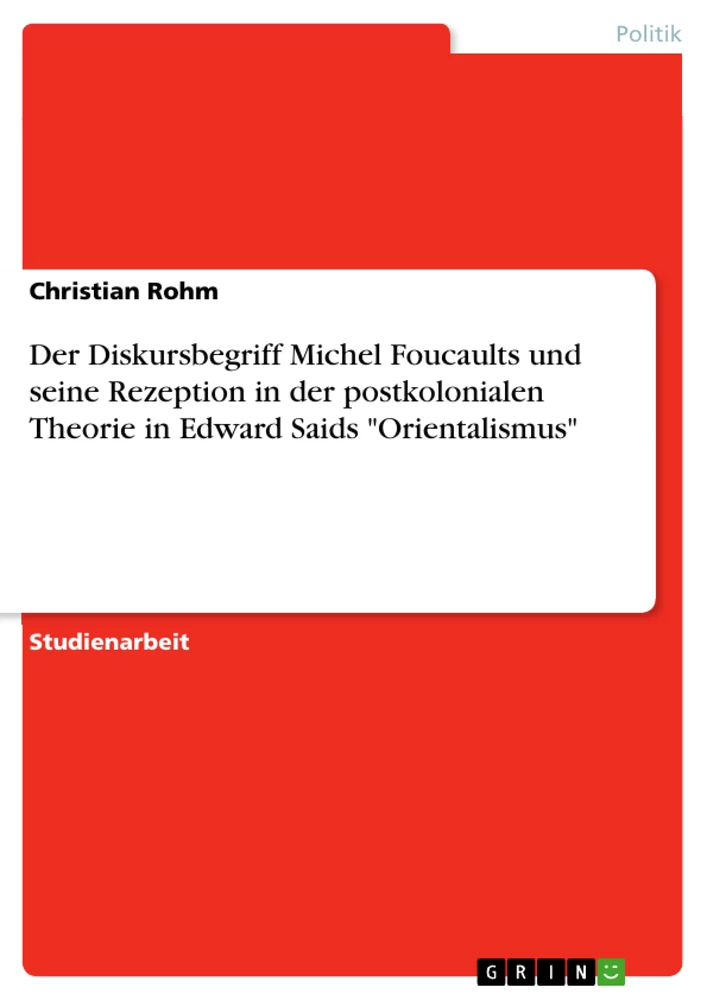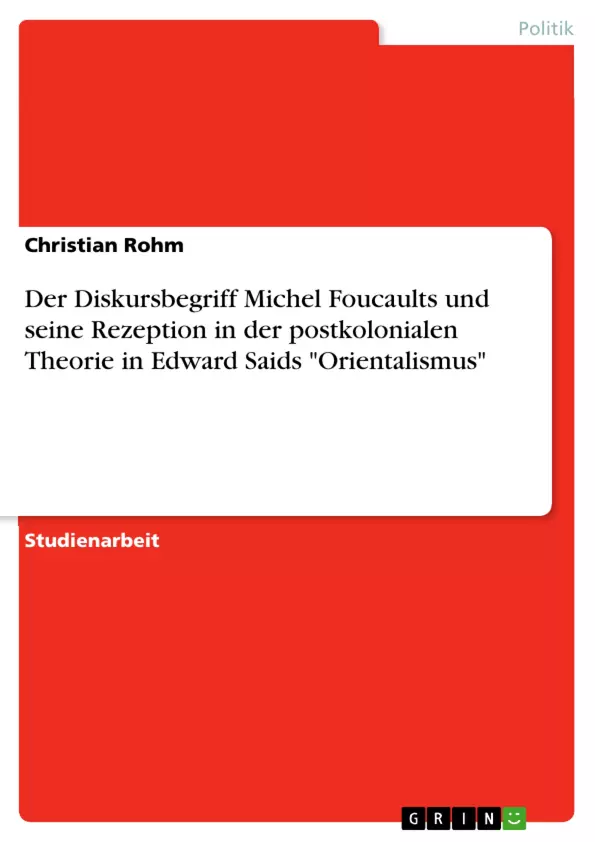Das Denken und die zentralen Begrifflichkeiten des französischen Philosophen Michel Foucault (1926-1984) haben mittlerweile Eingang in nahezu alle Einzelwissenschaften und ihre Subdisziplinen gefunden. Im Besonderen gilt dies für den von Foucault ab Mitte der 1960er-Jahre entwickelten Diskursbegriff, der fraglos als „das zentrale Etikett“ des Foucault’schen Denkens bezeichnet werden kann und der von traditionsreichen Disziplinen wie beispielsweise der Literatur- oder die Geschichtswissenschaft ebenso aufgegriffen wurde wie von eher neueren Forschungsrichtungen wie zum Beispiel der postkolonialen Theorie.
Genau diese Verbindung von Foucaults Diskursbegriff und postkolonialer Theorie bildet den Mittelpunkt dieser Arbeit. Ihr Ziel ist es, anhand Edward Saids Studie „Orientalismus“ exemplarisch und in groben Gründzügen die Rezeption des Foucault’schen Diskursbegriffs in der postkolonialen Theorie nachzuzeichnen. Saids im Jahr 1978 erschienene Abhandlung bietet sich als Untersuchungsgegenstand insbesondere deshalb an, weil sie als „Gründungsdokument der postkolonialen Studien“ (Castro Varela/Dhawan 2005) und als „eine Art Startsignal für die postcolonial studies“ (Hofmann 2012) angesehen wird und somit unstreitig eines der bedeutendsten Werke postkolonialer Theorie darstellt.
Was sind die zentralen Charakteristika von Michel Foucaults Diskursbegriff? Und auf welche Weise und mit welchem Ziel wurde dieser von Edward Said in seiner Studie „Orientalismus“ innerhalb der postkolonialen Theorie rezipiert? Zur Beantwortung dieser beiden Forschungsfragen werden zunächst gerafft die zentralen diskurstheoretischen Überlegungen Michel Foucaults dargestellt. Dafür wird schwerpunktmäßig auf seine Abhandlung „Die Ordnung des Diskurses“ zurückgegriffen, da diese innerhalb seines Werkes als „eine der informativsten Schriften zum Thema Diskurs“ (Ruoff 2013) gilt. Anschließend wird herausgearbeitet, wie Edward Said den Diskursbegriff Foucaults in „Orientalismus“ aufgreift und was er damit erklären kann. Hierbei wird die Studie auch in den Kontext der postkolonialen Theorie eingebettet. Abschließend werden die wesentlichen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit komprimiert zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Der Diskursbegriff Michel Foucaults
- 2.1 Der Diskurs bei Michel Foucault - Eine Annäherung
- 2.2 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses
- 3. „Foucault postkolonial“ – Edward Saids Analyse orientalistischer Diskurse
- 3.1 Was ist postkoloniale Theorie - und was ihr Forschungsinteresse?
- 3.2 Edward Said: Orientalismus
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert, wie der Diskursbegriff Michel Foucaults in der postkolonialen Theorie rezipiert wurde. Am Beispiel von Edward Saids "Orientalismus" wird exemplarisch untersucht, wie Foucaults Konzepte zur Analyse orientalistischer Diskurse eingesetzt wurden. Das Ziel ist es, die Erklärungsmöglichkeiten des Foucaultschen Diskursbegriffes für die postkoloniale Theorie aufzuzeigen.
- Michel Foucaults Diskursbegriff
- Rezeption des Foucaultschen Diskursbegriffes in der postkolonialen Theorie
- Orientalistische Diskurse
- Edward Saids "Orientalismus" als Beispiel für die postkoloniale Theorie
- Erklärung sozialer Phänomene durch den Diskursbegriff Foucaults
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 stellt zunächst die zentralen diskurstheoretischen Überlegungen von Michel Foucault dar, wobei der Fokus auf seiner Abhandlung "Die Ordnung des Diskurses" liegt. Kapitel 3 untersucht, wie Edward Said den Diskursbegriff Foucaults in "Orientalismus" aufgreift und welche Erklärungen er damit liefern kann. Der Kontext der postkolonialen Theorie wird dabei mit einbezogen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Diskursbegriff Michel Foucaults und seiner Rezeption in der postkolonialen Theorie. Dabei werden die Konzepte von Foucault, insbesondere "Die Ordnung des Diskurses", mit der Studie von Edward Said "Orientalismus" in Verbindung gebracht. Wichtige Themen sind der Zusammenhang von Diskurs und Macht, die Konstruktion des „Orients“ und die Kritik an eurozentrischen Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Michel Foucault unter dem Diskursbegriff?
Für Foucault ist der Diskurs ein System von Aussagen, das Regeln folgt und bestimmt, was in einer bestimmten Epoche als wahr oder sagbar gilt. Er wird oft als zentrales Etikett seines Denkens bezeichnet.
Wie nutzt Edward Said Foucaults Theorien in seinem Werk „Orientalismus“?
Said wendet Foucaults Diskursbegriff an, um zu zeigen, wie der Westen den „Orient“ als ein Konstrukt von Macht und Wissen erschaffen hat, um koloniale Herrschaft zu legitimieren.
Was ist das Hauptanliegen der postkolonialen Theorie?
Die postkoloniale Theorie untersucht die kulturellen, politischen und sozialen Folgen des Kolonialismus und kritisiert eurozentrische Perspektiven auf ehemals kolonisierte Gesellschaften.
Welche Rolle spielt die Schrift „Die Ordnung des Diskurses“?
Diese Schrift gilt als eine der informativsten Quellen zum Foucault’schen Diskursbegriff und dient als theoretische Basis für die Analyse von Ausschlussmechanismen in der Kommunikation.
Warum gilt „Orientalismus“ als Gründungsdokument der Postcolonial Studies?
Saids Werk von 1978 gab das Startsignal für die systematische Untersuchung der Verbindung von Wissen und imperialer Macht und prägte die Analyse orientalischer Diskurse nachhaltig.
- Arbeit zitieren
- Christian Rohm (Autor:in), 2014, Der Diskursbegriff Michel Foucaults und seine Rezeption in der postkolonialen Theorie in Edward Saids "Orientalismus", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295886