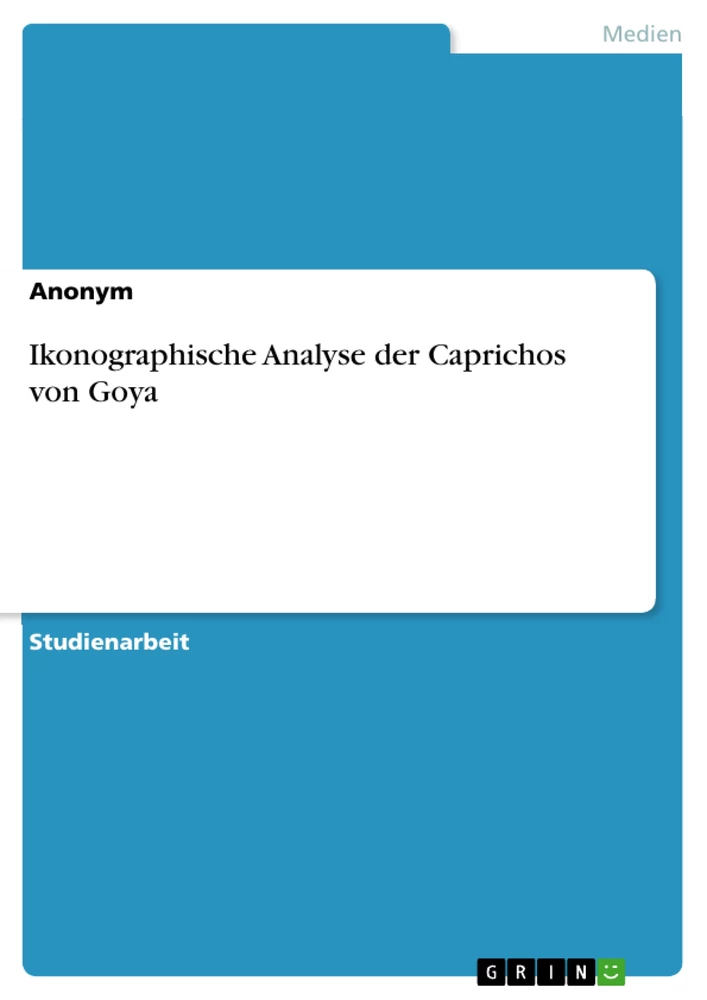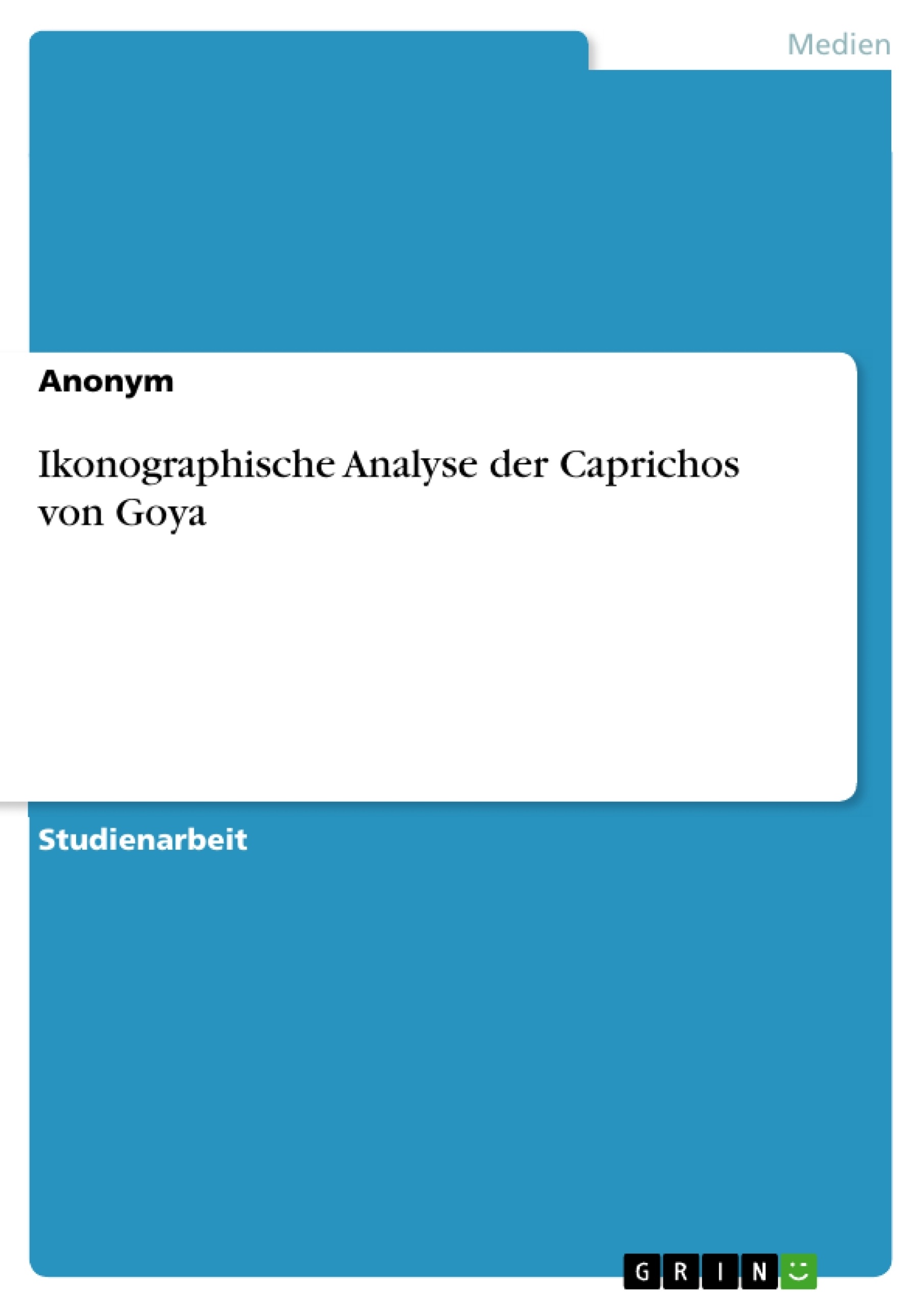Francisco de Goya veröffentlichte seine Caprichos 1799 mit einem Umfang von 80 zeitkritischen Blättern. Sie wurden vor der Veröffentlichung im Diario de Madrid von Goya selbst angekündigt, aber zwei Tage nach der Veröffentlichung, nach nur wenigen verkauften Exemplaren, wegen ihres kritischen Inhalts und Goyas Furcht vor der Inquisition wieder aus dem Verkauf genommen. Goya prangert darin die Laster von Menschen aller Stände aus seiner Zeit an, kritisiert den Machtmissbrauch der Regierung und des Adels, gesellschaftlich damals aktuelle Themen wie Prostitution, Zwangsheirat, Aberglaube oder Korruption. Der Gegenstand dieser Seminararbeit sind ikonographische Untersuchungen zu einzelnen Blättern aus ebendiesem Radierzyklus von Francisco de Goya mit emblematischem Schwerpunkt. Es soll zunächst die Frage beantwortet werden, inwieweit Goya von spanischen oder außerspanischen Ikonologie- und Emblembüchern Kenntnis hatte. Danach sollen die Motive dreier Blätter aus dem Caprichos-Zyklus eingehend auf ihre ikonographischen und emblematischen Wurzeln zurückverfolgt werden. Das Ziel der Betrachtungen soll die Beantwortung der Frage sein, auf welche Weise Goya bereits bekannte Motive für sich und seine Kritik neu verwendet, kombiniert, umwertet und damit instrumentalisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emblematik in Spanien zu Zeiten von Goya
- Untersuchung ausgewählter Blätter aus den Caprichos auf ihre ikonographischen Wurzeln
- Capricho Nr. 19 - Todos caeràn (Alle werden fallen)
- Capricho Nr. 56 – Subir y Bajar (Steigen und Fallen)
- Capricho 43 – El sueno de la razón produce monstrous (Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer)
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die ikonographischen Wurzeln ausgewählter Blätter aus Francisco de Goyas Radierzyklus "Caprichos". Die Arbeit zielt darauf ab, Goyas Kenntnis spanischer und außerspanischer Emblematik zu belegen und zu analysieren, wie er bekannte Motive neu interpretiert und für seine Kritik instrumentalisiert.
- Goyas Kenntnis und Verwendung emblematischer Traditionen
- Ikonographische Analyse ausgewählter Caprichos
- Goyas Kritik an Gesellschaft, Macht und Institutionen
- Die Funktion von Satire und Allegorie in Goyas Werk
- Vergleichende Analyse von Goyas Werken mit emblematischen und literarischen Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Francisco de Goyas "Caprichos" vor, einen Zyklus von 80 Radierungen, der 1799 veröffentlicht und aufgrund seines kritischen Inhalts schnell wieder aus dem Verkauf genommen wurde. Die Arbeit fokussiert sich auf die ikonographische und emblematische Analyse einzelner Blätter und untersucht, wie Goya bereits bekannte Motive für seine sozialkritische Botschaft umdeutet und verwendet. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit Goya von spanischen und außerspanischen Emblem- und Ikonologiebüchern beeinflusst war.
Emblematik in Spanien zu Zeiten von Goya: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Emblematik in Spanien und ihren Einfluss auf Goya. Es wird deutlich, dass die spanische Emblematik im Vergleich zu anderen Ländern, wie den Niederlanden, weniger stark ausgeprägt war. Trotzdem hatten Werke wie Juan de Borjas "Empresas Morales" und Diego de Saavedra Fajardos "Idea de un principe politico cristiano" Einfluss. Ausländische Werke wie Cesare Ripas "Iconologia" und Andrea Alciatis "Emblematum liber" waren ebenfalls relevant und durch Übersetzungen und Verbreitung weitreichend zugänglich. Obwohl kein direkter Beweis für Goyas direkte Bezugnahme auf Emblembücher vorliegt, wird die Hypothese aufgestellt, dass Goya vertraut mit der emblematischen Literatur und Bildkunst seiner Zeit war, basierend auf seinem Status als Hofkünstler und vergleichenden Bildanalysen, die im weiteren Verlauf der Arbeit erläutert werden.
Untersuchung ausgewählter Blätter aus den Caprichos auf ihre ikonographischen Wurzeln: Dieses Kapitel untersucht die ikonographischen und emblematischen Wurzeln ausgewählter Blätter der Caprichos. Es analysiert die Motive und Symbole in den ausgewählten Werken und vergleicht sie mit bekannten emblematischen und literarischen Quellen. Die detaillierte Analyse zeigt Goyas Fähigkeit, bereits bekannte Bildmotive neu zu interpretieren und für seine satirische und kritische Botschaft zu instrumentalisieren. Durch den Vergleich mit Werken anderer Künstler und Schriftsteller wird Goyas tiefes Verständnis und seine bewusste Verwendung emblematischer und ikonographischer Elemente deutlich. Der Bezug zu Cesare Ripas Iconologia wird exemplarisch an Hand von Goyas Allegorien herausgearbeitet und die Umdeutung von Motiven und Symbolen von Goya analysiert.
Schlüsselwörter
Francisco de Goya, Caprichos, Emblematik, Iconologie, Satire, Sozialkritik, Spanien, 18. Jahrhundert, Radierung, Ikonographie, Allegorie, Cesare Ripa, Emblembücher.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Untersuchung ausgewählter Blätter aus den Caprichos auf ihre ikonographischen Wurzeln"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die ikonographischen Wurzeln ausgewählter Blätter aus Francisco de Goyas Radierzyklus "Caprichos". Der Fokus liegt auf Goyas Kenntnis spanischer und außerspanischer Emblematik und der Analyse, wie er bekannte Motive neu interpretiert und für seine Kritik an Gesellschaft, Macht und Institutionen instrumentalisiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Goyas Kenntnis spanischer und außerspanischer Emblematik zu belegen und zu analysieren, wie er bekannte Motive neu interpretiert und für seine sozialkritische Botschaft verwendet. Es werden Goyas Verwendung emblematischer Traditionen, die ikonographische Analyse ausgewählter Caprichos, seine Kritik an Gesellschaft und Institutionen sowie die Funktion von Satire und Allegorie in seinem Werk untersucht.
Welche Caprichos werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail die Caprichos Nr. 19 ("Todos caeràn"), Nr. 56 ("Subir y Bajar") und Nr. 43 ("El sueno de la razón produce monstrous"). Die Analyse konzentriert sich auf die ikonographischen und emblematischen Wurzeln der Motive und Symbole in diesen Werken.
Wie wird die Emblematik in Spanien zu Goyas Zeiten behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Emblematik in Spanien und ihren Einfluss auf Goya. Es wird der Einfluss von Werken wie Juan de Borjas' "Empresas Morales" und Diego de Saavedra Fajardos "Idea de un principe politico cristiano", aber auch ausländischer Werke wie Cesare Ripas "Iconologia" und Andrea Alciatis "Emblematum liber" untersucht. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass Goya, trotz fehlender direkter Beweise, vertraut mit emblematischer Literatur und Bildkunst war.
Wie werden die ausgewählten Caprichos analysiert?
Das Kapitel zur Analyse der ausgewählten Blätter untersucht die ikonographischen und emblematischen Wurzeln der Motive und Symbole. Es vergleicht diese mit bekannten emblematischen und literarischen Quellen und zeigt Goyas Fähigkeit, bekannte Motive neu zu interpretieren und für seine satirische und kritische Botschaft zu verwenden. Der Bezug zu Cesare Ripas "Iconologia" wird exemplarisch herausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Francisco de Goya, Caprichos, Emblematik, Iconologie, Satire, Sozialkritik, Spanien, 18. Jahrhundert, Radierung, Ikonographie, Allegorie, Cesare Ripa, Emblembücher.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Emblematik in Spanien zu Goyas Zeiten, ein Kapitel zur Untersuchung ausgewählter Blätter aus den Caprichos, sowie ein Fazit und Ausblick.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene emblematische und literarische Quellen, darunter die Werke von Juan de Borjas, Diego de Saavedra Fajardo, Cesare Ripa und Andrea Alciati. Zusätzlich werden Goyas "Caprichos" selbst analysiert und mit Werken anderer Künstler und Schriftsteller verglichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Ikonographische Analyse der Caprichos von Goya, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295908