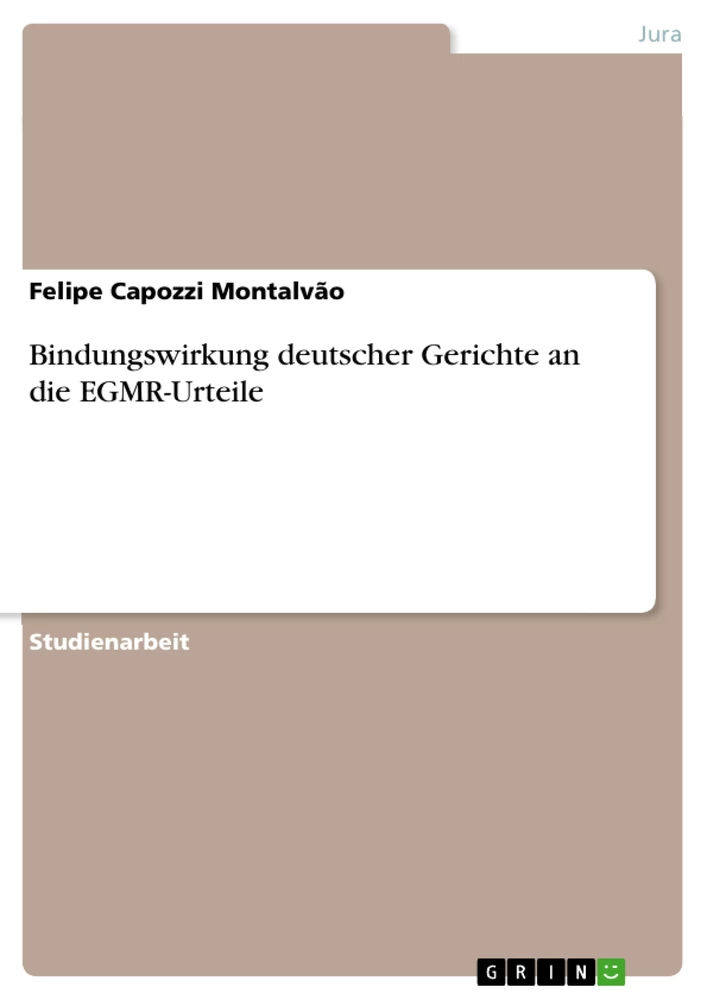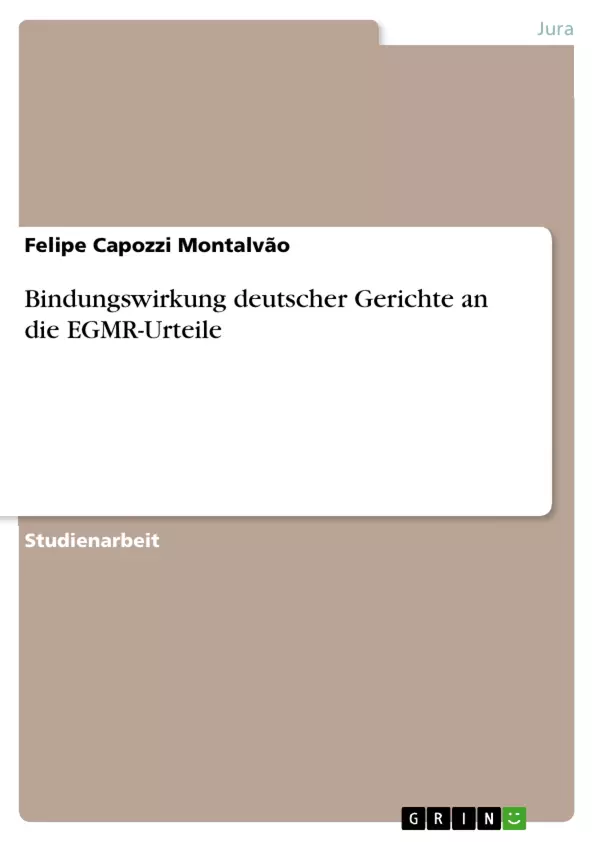In der Rechtsprechung deutscher Gerichte wächst seit Mitte der 1990er Jahre das Bewusstsein für die praktische Bedeutung der EMRK7. Zwischen dem EGMR und dem BVerfG gibt es jedoch ein offensichtliches Spannungsfeld. Denn die Gerichte haben
einen unterschiedlichen Prüfungsmaßstab. Während der EGMR anhand des Maßstabs der EMRK entscheidet, überprüft das BVerfG die Verletzung von Menschrechten ausschließlich
anhand des deutschen Grundgesetzes. Dieser Prozess wird oft als „quasi politischer Machtkampf“ oder als „Kompetenzgerangel“ dargestellt. Seit 1959 wurde in 159 von insgesamt 234 Urteilen gegen Deutschland ein Verstoß gegen die EMRK konstatiert.
In der vorliegenden Arbeit wird auf die Beziehung zwischen den deutschen Gerichten (insbesondere dem BVerfG) und dem EGMR eingegangen. Dabei werden zunächst die EMRK und ihre Struktur aufgezeigt. In diesem Zusammenhang wird die
Wirkung der EGMR-Urteile aus konventionsrechtlicher und nationaler Sicht erklärt. Im Anschluss daran werden zwei Fälle dargestellt, mithilfe derer die Bindungswirkung deutscher Gerichte an die Entscheidungen des EGMR untersucht wird. Abschließend wird das zuvor Erörterte bewertet und ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die EMRK im Allgemeinen
- Das 11. Zusatzprotokoll und die Zunahme an Beschwerden
- Wirkungen der EGMR-Urteile aus konventionsrechtlicher Sicht
- Wirkungen der EGMR-Urteile aus nationaler Sicht
- Fall Caroline von Hannover ./. Deutschland
- Darstellung des Sachverhaltes
- Darstellung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
- Darstellung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
- Fall Görgülü ./. Deutschland
- Darstellung des Sachverhaltes
- Darstellung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
- Weitere Entscheidungen des Oberlandesgerichts Naumburg
- Darstellung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts
- Kommentare zu den Entscheidungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bindungswirkung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) auf deutsche Gerichte. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Entscheidungen sowohl aus konventionsrechtlicher als auch aus nationaler Sicht und beleuchtet dabei die Rolle des Bundesverfassungsgerichts.
- Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) für den deutschen Rechtsschutz
- Die Auswirkungen von EGMR-Urteilen auf die deutsche Rechtsprechung
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Bindungswirkung von EGMR-Urteilen
- Die praktische Anwendung der EMRK in deutschen Gerichtsverfahren
- Die Herausforderungen der Koordination von nationalem und europäischem Rechtsschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bindungswirkung von EGMR-Urteilen auf deutsche Gerichte ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 stellt die EMRK im Allgemeinen vor, während Kapitel 3 die Wirkungen der EGMR-Urteile aus konventionsrechtlicher Sicht beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit den Auswirkungen der EGMR-Urteile aus nationaler Sicht. Die Kapitel 5 und 6 analysieren zwei konkrete Fälle, die Caroline von Hannover- und die Görgülü-Entscheidung, und stellen die jeweiligen Sachverhalte, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des EGMR sowie weitere relevante Entscheidungen dar. Kapitel 7 bietet einen kritischen Kommentar zu den Entscheidungen und diskutiert die Auswirkungen der EGMR-Urteile auf die deutsche Rechtsprechung.
Schlüsselwörter
Europäische Menschenrechtskonvention, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Bundesverfassungsgericht, Bindungswirkung, Rechtsprechung, Grundrechte, nationale Gerichte, Völkerrecht, Menschenrechtsschutz, Rechtsharmonisierung, Rechtsentwicklung, Gerichtsentscheidungen, Rechtsvergleichung.
Häufig gestellte Fragen
Wie binden Urteile des EGMR deutsche Gerichte?
Deutsche Gerichte müssen die Entscheidungen des EGMR im Rahmen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes berücksichtigen.
Was ist der Unterschied im Prüfungsmaßstab zwischen BVerfG und EGMR?
Das BVerfG prüft am Maßstab des Grundgesetzes, während der EGMR Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) untersucht.
Was wurde im Fall „Caroline von Hannover“ entschieden?
In diesem Fall ging es um den Schutz der Privatsphäre gegenüber der Pressefreiheit, wobei der EGMR einen stärkeren Schutz der Privatheit forderte als zuvor deutsche Gerichte.
Welche Bedeutung hat der Fall „Görgülü“ für die deutsche Justiz?
Der Fall Görgülü verdeutlichte die Pflicht deutscher Fachgerichte, die Urteile des EGMR bei Sorge- und Umgangsrechtsentscheidungen effektiv zu beachten.
Was änderte das 11. Zusatzprotokoll zur EMRK?
Es führte zu einer Strukturreform des Gerichtshofs, um die wachsende Zahl an Individualbeschwerden effizienter bearbeiten zu können.
- Citar trabajo
- Felipe Capozzi Montalvão (Autor), 2013, Bindungswirkung deutscher Gerichte an die EGMR-Urteile, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295936