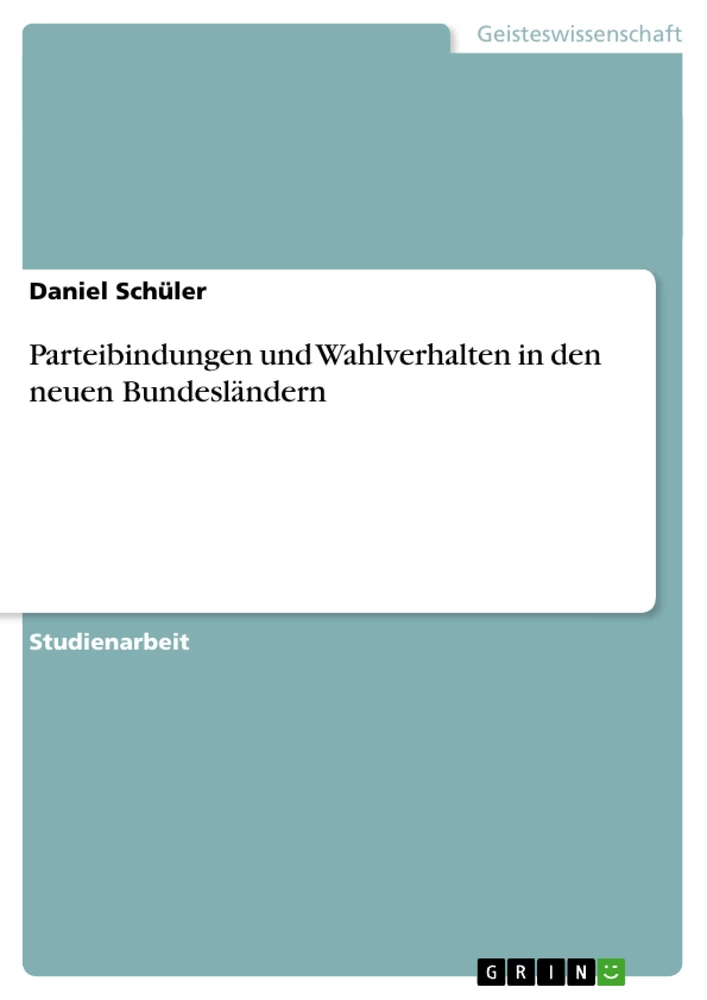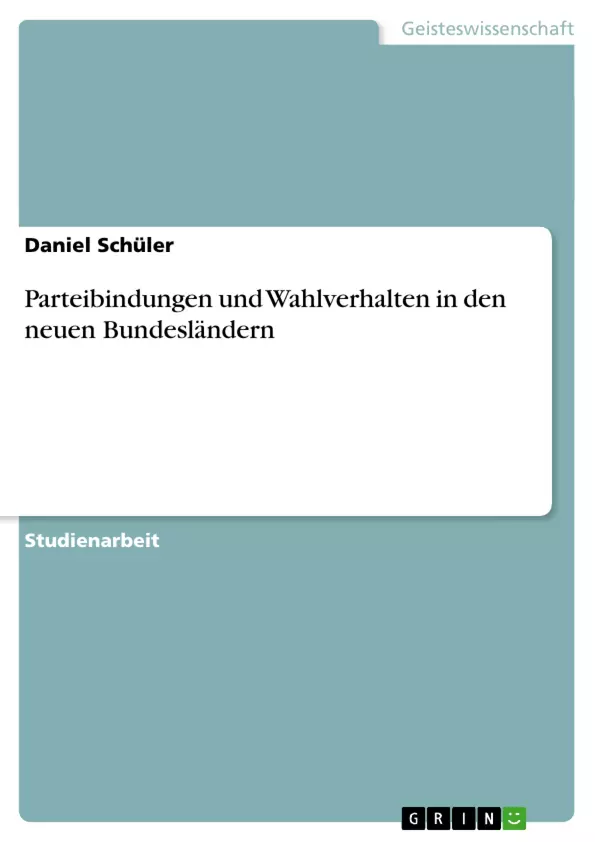Die hier vorliegende Arbeit wird sich mit einer beinahe einmaligen Umbruchssituation
in der politischen Landschaft und deren Auswirkungen beschäftigen. Mit dem
Zusammenbruch der sozialistischen Systeme im Ostblock sehen sich zwar alle
betroffenen Länder großen Umbrüchen gegenüber, die Situation der ehemaligen DDR
unterscheidet sich von allen anderen aber durch den Zusammenschluss mit der
Bundesrepublik Deutschland; es muss also nicht wie in den anderen Ländern erst das
passende bzw. ein passendes politisches System gefunden werden, sondern die Bürger
der DDR finden sich „von heute auf morgen“ in einem demokratischen System mit
freien Wahlen wieder1. Die Situation der ehemaligen DDR entscheidet sich ebenfalls
insofern, dass aufgrund der Teilung Deutschlands und dem somit direkten
kapitalistischen und demokratischen Nachbarn eine gewisse Nähe zum Westen durch
die in einem großen Teil der DDR empfangbaren Medien (Fernsehen/Radio) gegeben
war2.
Wie würden die neuen Bundesbürger also wählen? Waren sie in ihrer Wahrnehmung
der westlichen Parteien durch die Indoktrination der DDR-Bürokratie beeinflusst oder
doch eher doch durch die Rezeption der Westmedien? Besitzen sie womöglich so etwas
wie Parteibindungen, obwohl sie diese nicht durch praktiziertes Wählen erhalten haben
konnten und wie sehen die erwünschten bzw. verfolgten Werte der Bürger aus?
Um diese Fragen zu klären, werden zunächst die Wahlen nach dem Zusammenbruch
des DDR-Regimes und die damit verbunden zeitgenössischen soziologischen
Überlegungen zum Wahlverhalten zu betrachten sein. Danach wird die Frage nach der
Entwicklung des Wahlverhaltens der Ostwähler bis heute und die Unterschiede zum
Wähler in den alten Bundesländern zu bearbeiten sein.
Natürlich können diese Fragen in der hier vorliegenden Arbeit nur überblicksartig
behandelt werden.
1 Im Gegensatz zu anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks, in denen sich eher autokratische Systeme
entwickelten
2 Besonders ist hier die Stellung Westberlins als Sendeplatz der TV- und Radioanstalten im Herzen der
DDR hervorzuheben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wahlverhalten der ostdeutschen Wähler 1990
- Die Kontinuitätsthese
- Die Tabula-Rasa-These
- Die Konvergenzthese
- Die Kristallistationsthese
- Die Entwicklung des Wahlverhaltens im Osten seit 1990
- Die Wahlergebnisse in Gesamtdeutschland zum Vergleich
- Erklärungsversuche der Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die einzigartige Umbruchssituation in der politischen Landschaft Ostdeutschlands nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems und untersucht die Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Bevölkerung. Der Fokus liegt dabei auf der besonderen Situation der ehemaligen DDR im Vergleich zu anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks, die sich mit der Wiedervereinigung Deutschlands in einem demokratischen System mit freien Wahlen wiederfanden.
- Das Wahlverhalten der ostdeutschen Wähler bei den ersten Bundestagswahlen 1990
- Die Entwicklung des Wahlverhaltens in den neuen Bundesländern seit 1990
- Vergleich des Wahlverhaltens in Ost- und Westdeutschland
- Erklärungsversuche für das Wahlverhalten in den neuen Bundesländern
- Die Rolle von Parteibindungen und Werten im Wahlverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die besondere Situation der ehemaligen DDR im Kontext des Zusammenbruchs des sozialistischen Systems im Ostblock dar. Sie beleuchtet die Unterschiede zur Situation in anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks und beschreibt die Herausforderungen, die sich für die Bürger der DDR durch die Wiedervereinigung ergaben.
Das Wahlverhalten der ostdeutschen Wähler 1990
Dieses Kapitel behandelt die ersten Bundestagswahlen nach der Wiedervereinigung und die vier Hauptthesen zur Erklärung des Wahlverhaltens der ostdeutschen Wähler. Die Kapitel analysiert die spezifischen Merkmale dieser Wahlen, darunter die Wahlbeteiligung, die Ergebnisse der einzelnen Parteien und die Bedeutung des „Issue-Voting“ in Bezug auf die Frage der Wiedervereinigung.
Die Entwicklung des Wahlverhaltens im Osten seit 1990
Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Wahlverhaltens in den neuen Bundesländern seit 1990 und stellt einen Vergleich zu den Wahlergebnissen in Gesamtdeutschland an. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für die beobachteten Veränderungen im Wahlverhalten diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Wahlverhalten, Ostdeutschland, Wiedervereinigung, Bundestagswahlen, Parteibindungen, Werte, Issue-Voting, Konvergenzthese, Kontinuitätsthese, Tabula-Rasa-These, Kristallistationsthese, politische Landschaft, Umbruchssituation, Sozialismus, Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich das Wahlverhalten in der DDR nach der Wende?
Die Bürger der ehemaligen DDR mussten sich 1990 plötzlich in einem demokratischen System mit freien Wahlen zurechtfinden, was zu einzigartigen Umbrüchen führte.
Was besagt die "Tabula-Rasa-These"?
Diese These geht davon aus, dass die ostdeutschen Wähler keine festen Parteibindungen hatten und ihre Wahlentscheidung völlig neu trafen.
Welche Rolle spielten West-Medien für die Ostwähler?
Durch den Empfang von West-Fernsehen und Radio hatten viele DDR-Bürger bereits vor der Wende eine gewisse Nähe zu westlichen Parteien entwickelt.
Was ist "Issue-Voting"?
Das bedeutet, dass Wähler ihre Entscheidung primär an Sachthemen festmachen (z.B. die Art der Wiedervereinigung) statt an langfristiger Parteitreue.
Gibt es heute noch Unterschiede zwischen Ost- und Westwählern?
Die Arbeit untersucht die Konvergenzthese, also die Frage, ob sich das Wahlverhalten im Osten über die Jahre dem im Westen angeglichen hat.
- Quote paper
- Daniel Schüler (Author), 2004, Parteibindungen und Wahlverhalten in den neuen Bundesländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29599