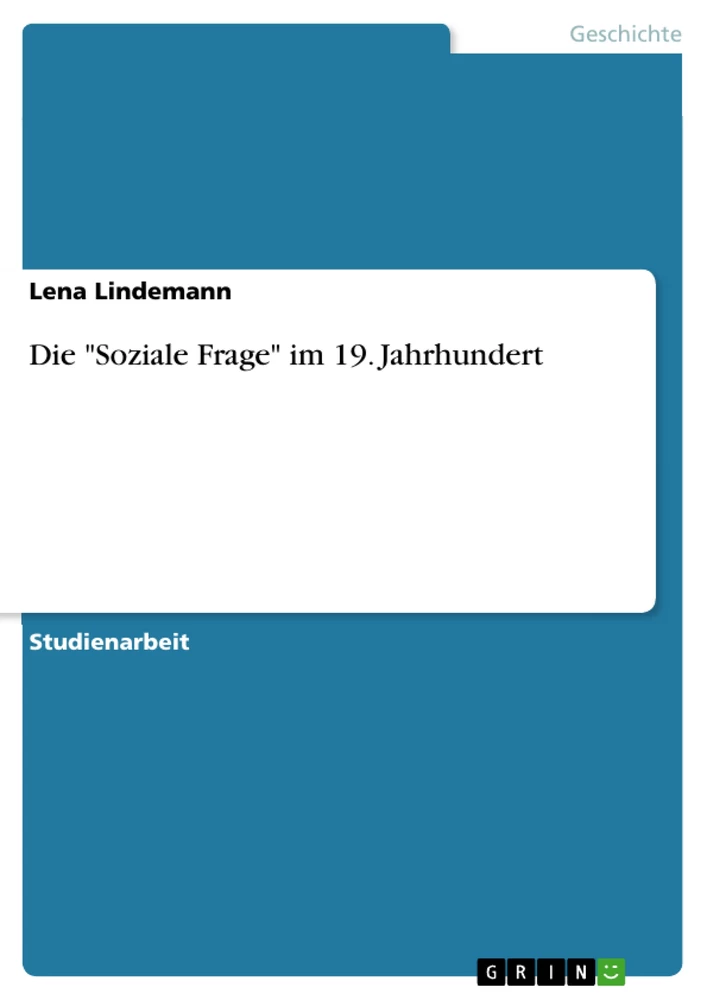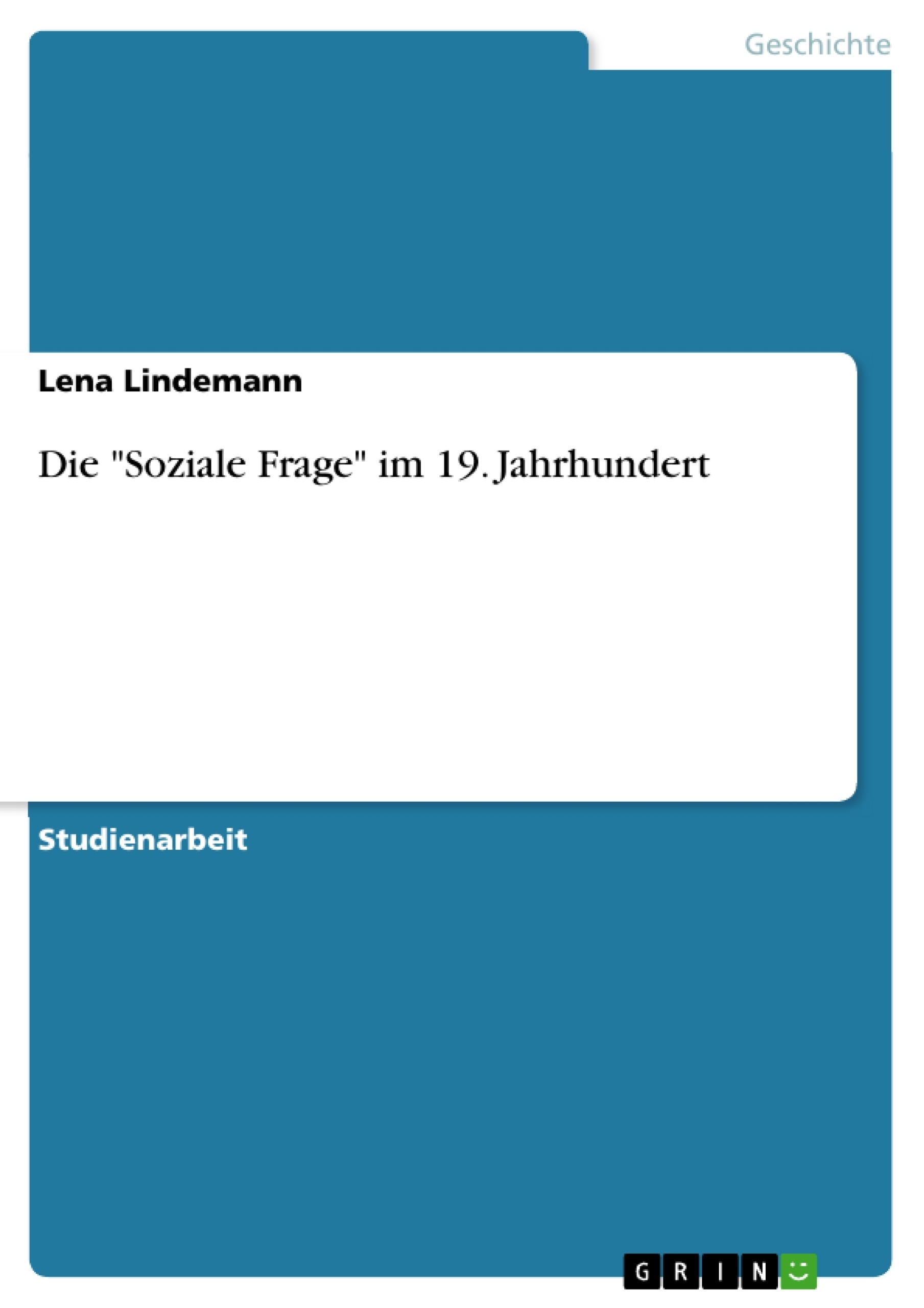„Als soziale Frage wird die Summe der ökonomischen Probleme, die aus der industriellen Revolution resultieren und damit das bürgerliche Leben im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Industrialisierung, prägen, bezeichnet.“ Die sozialen Probleme wurden von den jeweiligen Bevölkerungsgruppen allerdings aus unterschiedlicher Perspektive gesehen. So seien aus Sicht des Besitzbürgertums die fehlende Moral, die Trunksucht und die Faulheit der Arbeiter verantwortlich für die sozialen Probleme. Teile des Bildungsbürgertums mit sozialistischer politischer Gesinnung waren hingegen der Meinung, dass das Problem auf die Klassenunterschiede zwischen Bürgertum und Arbeiterklasse zurückzuführen sei. Die Arbeiter wiederum waren nicht an den Ursachen der Probleme interessiert. Sie beschäftigte im Gegenteil insbesondere vielmehr die Beseitigung der Symptome. So war eine für alle Beteiligten zufriedenstellende einheitliche Lösung der sozialen Probleme aufgrund ihrer divergenten Vorstellungen nicht zu erreichen. In dieser Arbeit wird exemplarisch auf die Lösungsansätze der katholischen als auch der protestantischen Kirche, sowie auf die des Staates eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Situation der Arbeiter zur Zeit der „Sozialen Frage“ im 19. Jahrhundert
- 3 Die Arbeiterbewegung
- 4 Das Sozialistengesetz
- 5 Der staatliche Lösungsansatz der „Sozialen Frage“ – Die Sozialgesetzgebung Bismarcks
- 6 Die kirchliche Sicht als ein weiterer Lösungsansatz der „Sozialen Frage“
- 6.1 Die Katholiken und die „Soziale Frage“
- 6.2 Die Protestanten und die „Soziale Frage“
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Soziale Frage“ im 19. Jahrhundert, die aus den ökonomischen Problemen der industriellen Revolution resultierte und das bürgerliche Leben prägte. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven auf die sozialen Probleme, die von den jeweiligen Bevölkerungsgruppen vertreten wurden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Lösungsansätze der katholischen und protestantischen Kirche sowie des Staates.
- Die Situation der Arbeiter während der Industrialisierung
- Die Entstehung der Arbeiterbewegung und ihre Forderungen
- Das Sozialistengesetz und seine Auswirkungen
- Die staatliche Sozialgesetzgebung Bismarcks
- Die Rolle der Kirchen in der „Sozialen Frage“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der „Sozialen Frage“ ein und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die sozialen Probleme. Kapitel 2 beschreibt die schwierigen Lebensbedingungen der Arbeiter während der Industrialisierung, die durch Landflucht, Überfüllung der Städte, schlechte Hygiene und hohe Arbeitslosigkeit geprägt waren. Kapitel 3 behandelt die Arbeiterbewegung und ihre Forderungen nach sozialer Absicherung. Kapitel 4 beleuchtet das Sozialistengesetz, das 1878 verabschiedet wurde und die Sozialdemokratie als „Reichsfeind Nummer eins“ ausmachte. Kapitel 5 analysiert die staatliche Sozialgesetzgebung Bismarcks, die als Reaktion auf die soziale Not eingeführt wurde. Kapitel 6 untersucht die Rolle der Kirchen in der „Sozialen Frage“ und betrachtet die Positionen der Katholiken und Protestanten. Kapitel 7 fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die „Soziale Frage“, Industrialisierung, Arbeiterbewegung, Sozialistengesetz, Sozialgesetzgebung Bismarcks, Kirche, Katholizismus, Protestantismus, soziale Not, Arbeitslosigkeit, Landflucht, Hygiene, Lebensbedingungen, soziale Absicherung, Klassenunterschiede.
- Citation du texte
- Lena Lindemann (Auteur), 2012, Die "Soziale Frage" im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296184