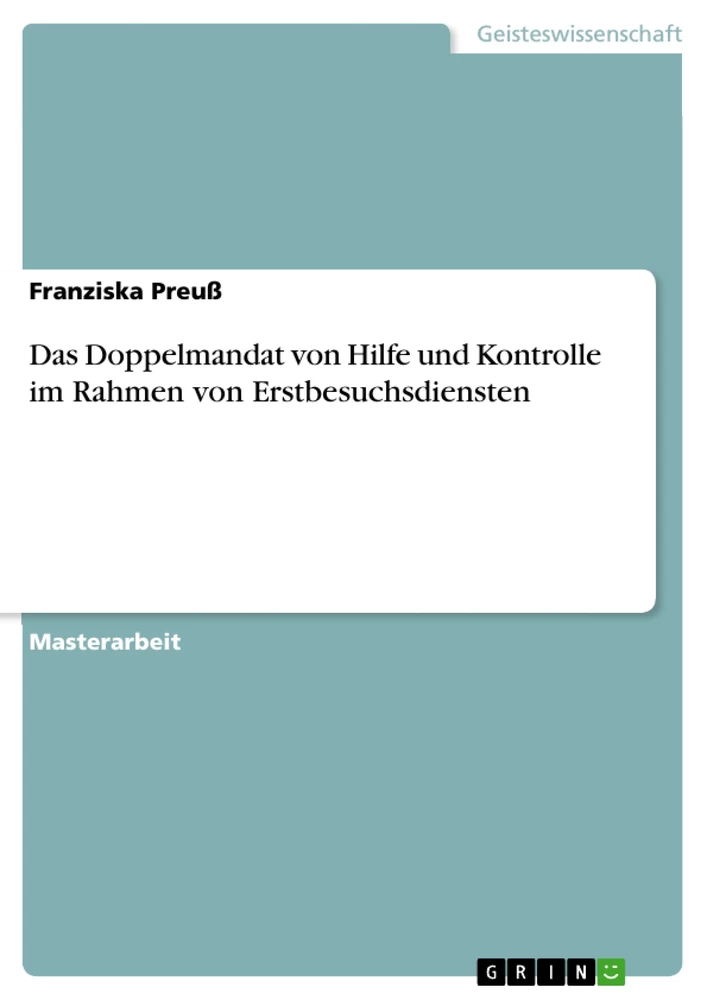Der Alltag mit einem Neugeborenen bringt eine Veränderung des eigenen Lebens mit sich. Viele Eltern stellen sich darauf ein und können mit der neuen Situation umgehen, doch dies betrifft nicht alle. Auf Grundlage der tragischen Fälle von Kindeswohlgefährdung und der daraus folgenden medialen Inszenierung wurde in den letzten Jahren vermehrt das Thema der Unterstützung von Eltern diskutiert, wobei belastete Familien im Fokus stehen. Das Angebot der Frühen Hilfen bezieht sich hierbei speziell auf die Zielgruppe von Familien mit Kleinkindern. Um dabei Eltern aller Milieus erreichen zu können ist es besonders wichtig niederschwellige Hilfsangebote zu unterbreiten. Als geeignete Hilfeform für elterliche Belastungssituationen kann dabei die aufsuchende Elternarbeit genannt werden.
Im Rahmen der Debatte über Frühe Hilfen wurden in vielen Städten und Gemeinden Deutschlands von den Jugendämtern oder freien Trägern lokale Babybegrüßungsdienste, die sogenannten Willkommens- oder Erstbesuchsdienste ins Leben gerufen. Diese Dienste besuchen junge Familie in den ersten Wochen nach der Geburt ihres Kindes.
In dieser Arbeit soll das Angebot des Erstbesuchsdienstes nun mit Blick auf den Aspekt von Hilfe und Kontrolle durch Institutionen untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Thematische Hinführung
- 1.2 Fragestellung und Relevanz des Themas
- 2. Forschungshintergrund
- 2.1 Adressatenforschung
- 2.1.1 Interaktion/Beziehung Sozialpädagoge – Klient
- 2.1.2 Gespräche in der Sozialen Arbeit
- 2.2 Forschungen zum Doppelmandat Hilfe und Kontrolle aus Adressatensicht
- 2.3 Aktueller Forschungsstand Erstbesuchsdienst
- 2.3.1 Studie 1 – Desiree Günther, Christina Frese: „,Willkommensbesuche bei Neugeborenen. Konzepte Erfahrungen und Nutzen“
- 2.3.2 Studie 2-Stiftung Kinderland Baden-Württemberg: „Aktionsprogramm Familienbesucher“
- 3. Forschungsdesign
- 3.1 Forschungsmethode Interview
- 3.1.1 Narratives Interview
- 3.1.2 Leitfadeninterview
- 3.2 Transkription
- 3.3 Inhaltsanalyse
- 3.4 Exemplarische Analyse
- 3.5 Gegenstand der Forschung
- 3.6 Forschungsfragen
- 3.7 Methodenkritik
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Darstellung der Ergebnisse
- 4.2 Diskussion der dargestellten Ergebnisse
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit untersucht das Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle im Kontext von Erstbesuchsdiensten. Der Fokus liegt dabei auf den Erfahrungen von Familien mit Kleinkindern, die von diesen Diensten begleitet werden. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit der Kombination von Unterstützung und Überwachung im Rahmen des Erstbesuchs verbunden sind.
- Erfahrungen von Familien mit Erstbesuchsdiensten
- Das Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle
- Die Rolle von Sozialpädagogen im Erstbesuchsdienst
- Die Bedeutung von Vertrauen und Offenheit in der Beziehung zwischen Sozialpädagogen und Familien
- Die Auswirkungen von Erstbesuchsdiensten auf die Familienentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik des Doppelmandats von Hilfe und Kontrolle im Rahmen von Erstbesuchsdiensten ein und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 beleuchtet den Forschungshintergrund, indem es die Adressatenforschung, Forschungen zum Doppelmandat und den aktuellen Forschungsstand von Erstbesuchsdiensten beleuchtet. In Kapitel 3 wird das Forschungsdesign vorgestellt, welches auf narrativen Interviews und einer anschließenden Inhaltsanalyse basiert. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und diskutiert deren Bedeutung. Das Fazit und der Ausblick in Kapitel 5 fassen die zentralen Ergebnisse zusammen und werfen einen Blick auf zukünftige Forschungsperspektiven.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Doppelmandats von Hilfe und Kontrolle, Erstbesuchsdiensten, Familien mit Kleinkindern, Sozialpädagogik, Vertrauen, Offenheit und Familienentwicklung. Die Untersuchung analysiert die Erfahrungen von Familien mit Erstbesuchsdiensten und beleuchtet die komplexen Interaktionen zwischen Sozialpädagogen und Familien in diesen besonderen Kontexten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das "Doppelmandat" in der Sozialen Arbeit?
Es bezeichnet das Spannungsfeld zwischen der Hilfeleistung für Klienten (Unterstützung) und der staatlichen Kontrolle (z. B. Wächteramt bei Kindeswohlgefährdung).
Was sind Erstbesuchsdienste (Babybegrüßungsdienste)?
Dies sind niederschwellige Angebote der "Frühen Hilfen", bei denen Fachkräfte junge Familien kurz nach der Geburt besuchen, um Unterstützung anzubieten und über Hilfsangebote zu informieren.
Wie nehmen Eltern diese Besuche wahr?
Die Wahrnehmung variiert: Während viele Eltern die Information und Wertschätzung begrüßen, können sich andere durch den Besuch kontrolliert oder in ihrer Privatsphäre gestört fühlen.
Warum sind niederschwellige Hilfsangebote wichtig?
Sie ermöglichen es, belastete Familien in allen sozialen Milieus frühzeitig zu erreichen und präventiv tätig zu werden, bevor Krisen oder Kindeswohlgefährdungen entstehen.
Welche Rolle spielt Vertrauen bei Hausbesuchen?
Vertrauen ist die Basis für eine gelingende Interaktion. Sozialpädagogen müssen offen kommunizieren, um den Kontrollaspekt in den Hintergrund und den Hilfecharakter in den Vordergrund zu rücken.
- Quote paper
- Franziska Preuß (Author), 2015, Das Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle im Rahmen von Erstbesuchsdiensten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296234