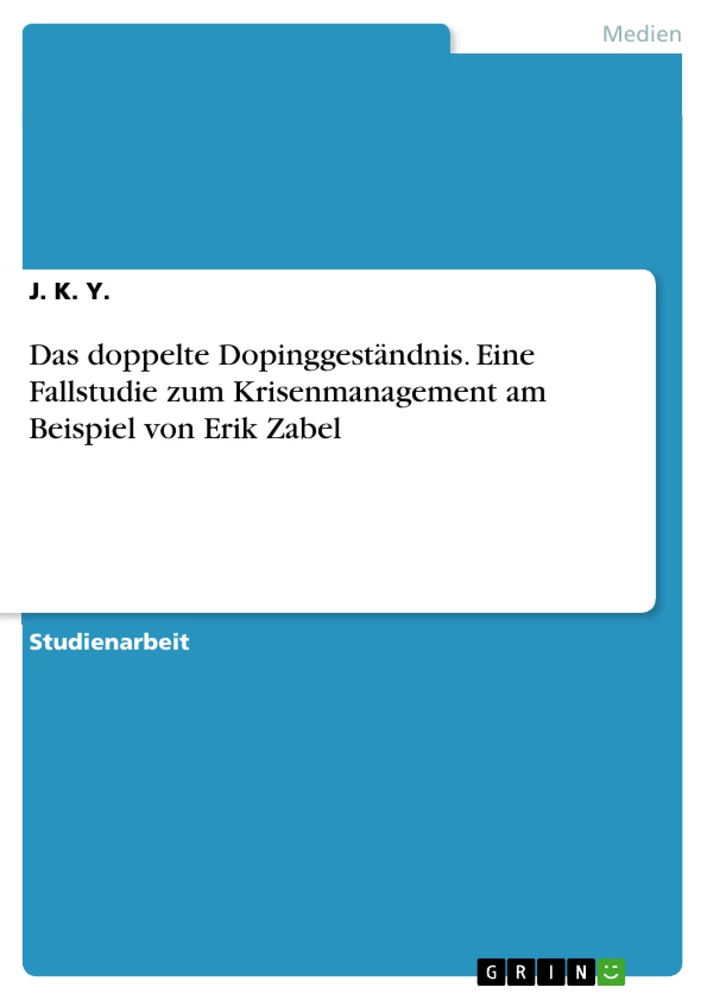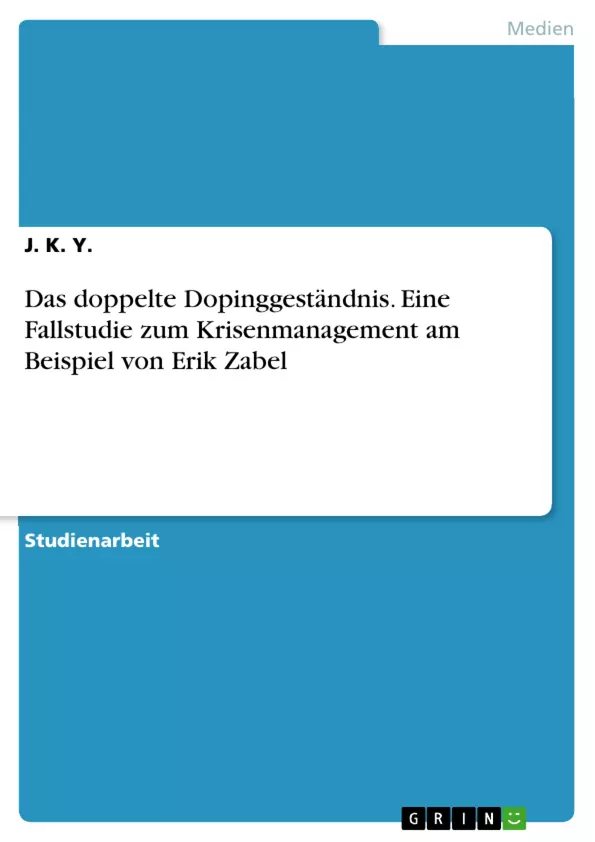Der Missbrauch von leistungssteigernden Substanzen hat im Radsport eine lange Vergangenheit, doch in den Fokus der Öffentlichkeit rückte das Thema erst rund um die Jahrtausendwende. Bis 1997 galt das Image des Radsports als positiv konnotiert, dann kamen die ersten positiven Doping-Proben, anschließend von 1999 bis 2005 die dominierende Zeit von Lance Armstrong. Sieben Jahre in Folge gewann er die Gesamtwertung des Radrennens Tour de France, in diesen Jahren wurde er des Dopings verdächtigt, 2013 legte er ein umfassendes Geständnis ab, in dem auch das eingangs erwähnte Zitat fiel. Im selben Jahr gestand in Deutsch-land ein ähnlich erfolgreicher ehemaliger Radsportler jahrelanges Doping: Erik Zabel, der erfolgreichste Sprinter während der Zeit von Armstrong. Für Zabel war es nicht sein erstes Geständnis, bereits 2007 gab er auf einer Pressekonferenz einen Teil seiner Vergehen zu. Dieses doppelte Dopinggeständnis ist in der internationalen Radsportszene bis heute einmalig.
In dieser Arbeit wird für die beiden Jahre 2007 und 2013 das Krisenmanagement von Erik Zabel bei seinen beiden Dopinggeständnissen untersucht und analysiert. Dazu werden als erstes aus der Fachliteratur die gängigen Definitionen und Kriterien für eine Krise genannt. Als nächstes werden der Fall Erik Zabel detailliert vorgestellt und die Ursachen und Auswirkungen der Dopinggeständnisse beschrieben. Anschließend wird dieser Fall anhand der Merkmale aus Kapitel 2 untersucht, analysiert und das Vorgehen bewertet. In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse dieser Analyse zusammengefasst und eingeordnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen des Krisenmanagements
- 2.1 Definition des Begriffs Krise
- 2.2 Arten des Krisenmanagements
- 2.3 Periodisierung einer Krise
- 2.4 Krisenkommunikation
- 2.5 Resümee
- 3. Der Fall Zabel
- 3.1 Zur Person
- 3.2 Das erste Dopinggeständnis 2007
- 3.3 Das zweite Dopinggeständnis 2013
- 4. Analyse des Falls Erik Zabel
- 4.1 Zur Tragfähigkeit der Krisendefinition
- 4.2 Krisenmanagement 2007
- 4.3 Krisenkommunikation 2007
- 4.4 Analyse der Unterschiede der Krisenkommunikation 2007 und 2013
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Krisenmanagement von Erik Zabel im Zusammenhang mit seinen beiden Dopinggeständnissen in den Jahren 2007 und 2013. Ziel ist es, die Krisendefinitionen aus der Literatur auf den Fall Zabel anzuwenden und dessen Krisenmanagement zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in der Krisenkommunikation zwischen beiden Jahren und bewertet das Vorgehen Zabels.
- Definition und Charakteristika von Krisen im Kontext des Sports
- Analyse des Krisenmanagements von Erik Zabel (2007 und 2013)
- Bewertung der Krisenkommunikation in beiden Fällen
- Vergleich der Strategien und deren Wirksamkeit
- Übertragbarkeit von Theorien des Krisenmanagements auf individuelle Sportler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Dopings im Radsport ein und nennt Erik Zabel als Beispiel für einen erfolgreichen Sportler mit zwei Dopinggeständnissen. Sie skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der die Analyse des Krisenmanagements Zabels in den Jahren 2007 und 2013 zum Gegenstand hat. Der Fokus liegt auf der Anwendung theoretischer Grundlagen des Krisenmanagements auf einen individuellen Fall im professionellen Sport.
2. Theoretische Grundlagen des Krisenmanagements: Dieses Kapitel beschreibt theoretische Konzepte des Krisenmanagements. Es definiert den Begriff "Krise" anhand verschiedener wissenschaftlicher Ansätze und unterscheidet zwischen operativem und strategischem Krisenmanagement. Es werden verschiedene Phasen der Krisenentwicklung beschrieben und die Bedeutung der Krisenkommunikation hervorgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Konzepte von Unternehmen auf individuelle Akteure wie Sportler wird diskutiert.
3. Der Fall Zabel: Dieses Kapitel präsentiert detailliert den Fall Erik Zabel, einschließlich seiner Biographie und seiner beiden Dopinggeständnisse in den Jahren 2007 und 2013. Es beschreibt den Kontext der Geständnisse und ihre Auswirkungen auf Zabels Karriere und öffentliches Image. Die Kapitel bietet eine chronologische Darstellung der Ereignisse und legt den Grundstein für die anschließende Analyse.
Schlüsselwörter
Krisenmanagement, Krisenkommunikation, Doping, Radsport, Erik Zabel, Fallstudie, Sport, öffentliches Image, Existenzbedrohung, Strategisches Krisenmanagement, Operatives Krisenmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des Krisenmanagements von Erik Zabel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Krisenmanagement von Erik Zabel im Zusammenhang mit seinen Dopinggeständnissen in den Jahren 2007 und 2013. Der Fokus liegt auf der Anwendung theoretischer Krisenmanagement-Konzepte auf einen individuellen Fall im professionellen Sport, insbesondere im Radsport.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika von Krisen im Sport, die Analyse des Krisenmanagements Zabels in beiden Jahren, die Bewertung der Krisenkommunikation, einen Vergleich der Strategien und deren Wirksamkeit sowie die Übertragbarkeit von Krisenmanagement-Theorien auf individuelle Sportler.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen des Krisenmanagements, Der Fall Zabel, Analyse des Falls Erik Zabel und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Krisenmanagements im Kontext des Falls Zabel.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Kapitel 2 erläutert verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Definition von "Krise", unterscheidet zwischen operativem und strategischem Krisenmanagement, beschreibt Phasen der Krisenentwicklung und hebt die Bedeutung der Krisenkommunikation hervor. Die Übertragbarkeit dieser Konzepte von Unternehmen auf individuelle Akteure wird diskutiert.
Wie wird der Fall Zabel dargestellt?
Kapitel 3 präsentiert detailliert den Fall Erik Zabel, inklusive Biographie und den beiden Dopinggeständnissen. Der Kontext der Geständnisse und deren Auswirkungen auf seine Karriere und sein öffentliches Image werden beschrieben. Eine chronologische Darstellung der Ereignisse dient als Grundlage für die Analyse.
Was ist das Ergebnis der Analyse des Falls Zabel?
Kapitel 4 analysiert die Tragfähigkeit der Krisendefinitionen im Bezug auf den Fall Zabel, das Krisenmanagement und die Krisenkommunikation in 2007 und 2013 und vergleicht die Unterschiede in der Krisenkommunikation beider Jahre. Es bewertet das Vorgehen Zabels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Krisenmanagement, Krisenkommunikation, Doping, Radsport, Erik Zabel, Fallstudie, Sport, öffentliches Image, Existenzbedrohung, Strategisches Krisenmanagement, Operatives Krisenmanagement.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Krisendefinitionen aus der Literatur auf den Fall Zabel anzuwenden und sein Krisenmanagement zu analysieren. Es werden die Unterschiede in der Krisenkommunikation zwischen 2007 und 2013 beleuchtet und das Vorgehen Zabels bewertet.
- Quote paper
- J. K. Y. (Author), 2014, Das doppelte Dopinggeständnis. Eine Fallstudie zum Krisenmanagement am Beispiel von Erik Zabel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296252