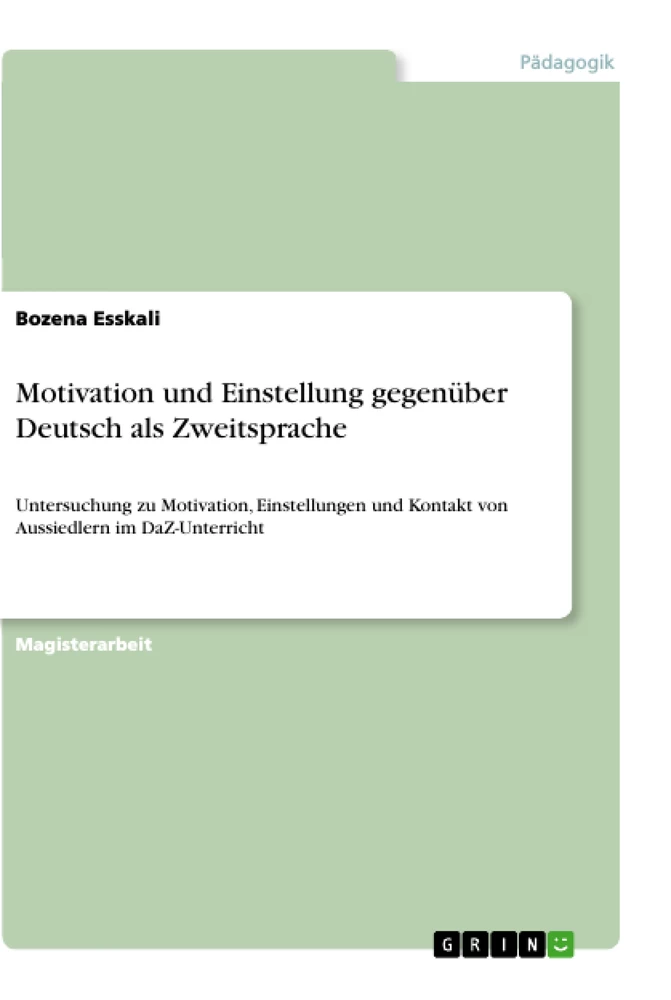Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Erkenntnissen von zwei wissenschaftlichen Teildisziplinen: der Zweitsprachenerwerbs- und Sprachlehrforschung. Sie beschäftigen sich mit einem speziellen Aspekt der Sprache - mit der angemessenen Erforschung des Fremd- und Zweitsprachenlernens. Die erste befasst sich mit dem Erwerb von Sprachen in außerschulischer Umgebung. Den Begriff der Sprachlehrforschung liefern Edmondson und House (1993: 17). Sie soll sich mit dem, durch Unterricht gesteuerten, Lehren und Lernen von Fremd- oder Zweitsprachen in verschiedenen Lernkontexten beschäftigen. Darüber hinaus soll sie sowohl die Entwicklung einer Theorie des L2-Lernens als auch die Formulierung empirisch begründeter didaktischer Empfehlungen für verbesserte Sprachenvermittlung im Fremdsprachenunterricht anstreben. Diese zwei wissenschaftlichen Disziplinen sind miteinander verwandt und nicht einfach voneinander abzugrenzen. In der vorliegenden Arbeit beabsichtige ich, auf Erkenntnisse dieser beiden Forschungsbereiche in Bezug auf die Bedeutung von zwei affektiven Einflussgrößen: Motivation und Einstellung sowie des sozialen Faktors Kontakt auf den Prozess des Zweitsprachenerwerbs näher einzugehen. Das Interesse der Arbeit ist ferner gerichtet auf Unterschiede im Zweitsprachenerwerb nach Alter, Geschlecht und sozialer Herkunft der Lernenden. Es soll folglich danach gefragt werden, ob in den Bereichen Motivation, Einstellung sowie Kontakt signifikante Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Probanden, zwischen den Geschlechtern und den sozialen Schichten auftreten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Erkenntnisse der Sprachlehrforschung
- 1. Erst-, Zweit- und Mehrsprachigkeit- ein Überblick
- II. Sprachlernvoraussetzungen für die nachzeitige Aneignung einer Zweitsprache
- 1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Bezug auf biologische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Lernalters und des Geschlechtes
- 1. 1. Unterschiede zum Erstsprachenerwerb
- 1. 1. 1. Lernalter
- 1. 1. 2. Geschlecht
- 1. 2. Einige Gemeinsamkeiten zwischen Erst- und Zweitsprachenerwerb
- III. Rolle der ausgewählten affektiven Faktoren im Zweitsprachenerwerb am Beispiel von Motivation und Einstellung
- 1. Zum Begriff der Motivation und des Motivs
- 2. Einstellung
- 3. Zum Begriff der Motivation und Einstellung im Spracherwerb
- 3. 1. Motivations- und Einstellungsproblematik in der Erst- und Zweitsprache- ein Vergleich
- 3. 2. Grundlagen zur Rolle von Einstellung und der integrativen vs. instrumentellen Motivation beim Zweitsprachenerwerb
- 3. 2. 1. Die sozialpsychologischen Faktoren des Zweitsprachenerwerbsprozesses auf der Grundlage des Models von Gardner 1979
- 3. 2. 1. 1. Soziales Milieu unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Herkunft
- 3. 2. 1. 1. 1. Soziale Herkunft
- 3. 2. 1. 2. Persönlichkeitsmerkmale
- 3. 2. 1. 3. Spracherwerbskontexte
- 3. 3. Der Faktor Kontakt nach Schumanns,, Akkulturationshypothese“
- 3. 4. Wechselwirksamkeit der Einflussvariable Alter mit der Motivation und der Einstellung
- 3. 5. Die Expansion des Motivationskonstruktes
- IV. Einige Informationen zur sozio- ökonomischen Situation der Spätaussiedler
- 1. Der politische Status und die Motivation
- 1. 1. Die unmittelbare Lernnotwendigkeit
- 1. 2. Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland
- V. Forschungsmethodische Implikationen
- 1. Die Fragestellungen und Hypothesen der Untersuchung
- 2. Die Methodik
- 3. Gesamtinstitutionelle Rahmenbedingungen der Untersuchung
- 3. 1. Erhebungskontexte
- 3. 2. Erhebungsverfahren
- 3. 2. 1. Schülerfragebogen
- 3. 2. 2. Die Lehrerbefragung
- 4. Die Durchführung der Befragung
- 5. Die Auswertung des Datenmaterials
- 6. Motivation im DaZ- Unterricht mit Aussiedlern
- 6. 1. Zusammenfassung der Ergebnisse zur integrativen Motivation
- 6. 2. Zusammenfassung der Ergebnisse zur instrumentellen Motivation
- 7. Einstellung zum Schwierigkeitsgrad des Erwerbs der deutschen Sprache
- 8. Einstellung zu Deutschland und der deutschsprachingen Bevölkerung
- 9. Kontakt
- 10. Soziale Herkunft
- 11. Ergebnisse der Lehrerbefragung
- 12. Zusammenfassung der Ergebnisse der Erhebung
- Analyse der Motivationsfaktoren bei Spätaussiedlern im DaZ-Unterricht
- Untersuchung der Einstellung gegenüber der deutschen Sprache und Kultur
- Bedeutung des Kontakts mit der deutschen Sprache und Kultur für den Spracherwerb
- Einfluss des Lernalters und des Geschlechts auf die Motivation und Einstellung
- Rolle der sozialen Herkunft und des soziokulturellen Hintergrunds im DaZ-Lernprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Motivation und Einstellung von Spätaussiedlern im Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Unterricht. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für die komplexen Faktoren zu entwickeln, die den Spracherwerbsprozess dieser Gruppe beeinflussen. Die Untersuchung soll die Rolle von Motivation und Einstellung, sowie den Einfluss von Faktoren wie Alter, Geschlecht, soziokulturellem Hintergrund und Kontakterfahrungen auf den DaZ-Lernprozess beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Sprache als Kommunikationsmittel und differentia specifica des Menschen dar. Sie führt die wissenschaftlichen Teildisziplinen der Zweitsprachenerwerbs- und Sprachlehrforschung ein und erläutert die Bedeutung des Fremd- und Zweitsprachenlernens. Das erste Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Erst-, Zweit- und Mehrsprachigkeit und stellt die Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachstufen heraus. Das zweite Kapitel analysiert die Sprachlernvoraussetzungen für den Erwerb einer Zweitsprache, insbesondere im Hinblick auf biologische Entwicklungsfaktoren wie Lernalter und Geschlecht. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Erst- und Zweitsprachenerwerb beleuchtet. Im dritten Kapitel werden die affektiven Faktoren Motivation und Einstellung im Kontext des Zweitsprachenerwerbs näher untersucht. Hierbei werden die Begriffe Motivation und Einstellung definiert und ihre Rolle im Spracherwerbsprozess erläutert. Die Unterschiede zwischen instrumenteller und integrativer Motivation werden diskutiert, und das Modell von Gardner (1979) wird zur Analyse der sozialpsychologischen Faktoren des Zweitsprachenerwerbsprozesses herangezogen. Kapitel IV beleuchtet die sozioökonomische Situation von Spätaussiedlern und stellt die Bedeutung des politischen Status und der Motivation im Kontext der deutschen Sprache dar. Das fünfte Kapitel widmet sich den Forschungsmethodischen Implikationen der Untersuchung. Es werden die Fragestellungen und Hypothesen der Untersuchung vorgestellt, die Methodik erläutert und die Gesamtinstitutionellen Rahmenbedingungen der Untersuchung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sprachlehrforschung, Zweitsprachenerwerb, Motivation, Einstellung, Spätaussiedler, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Lernalter, Geschlecht, soziale Herkunft, soziokultureller Hintergrund, Kontakt, instrumentelle Motivation, integrative Motivation, Akkulturationshypothese.
- Quote paper
- Bozena Esskali (Author), 2004, Motivation und Einstellung gegenüber Deutsch als Zweitsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29642