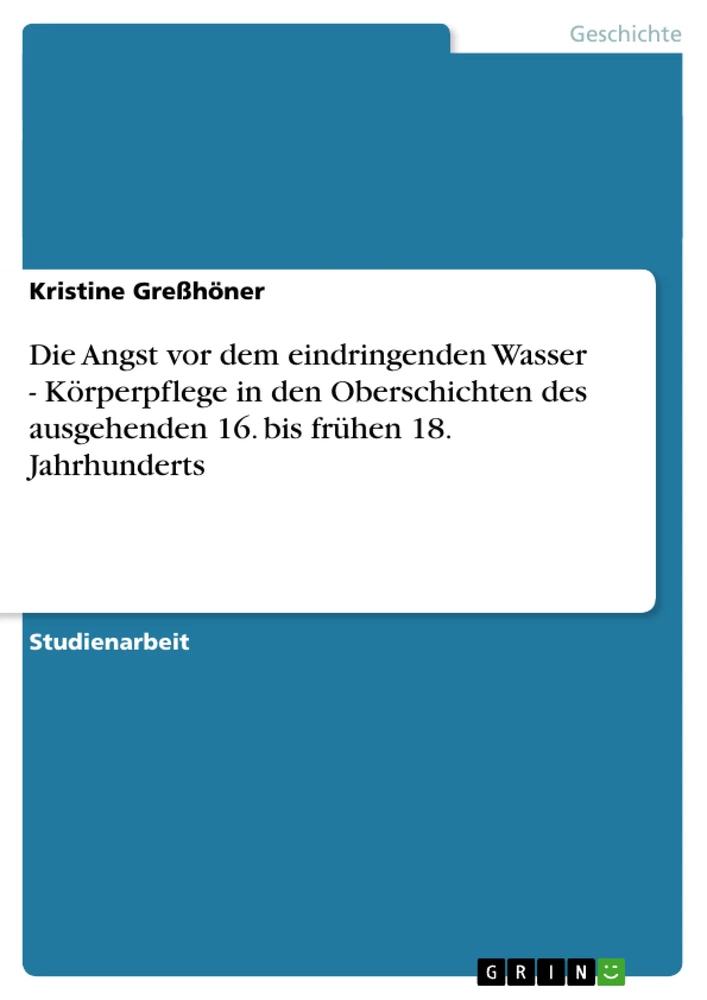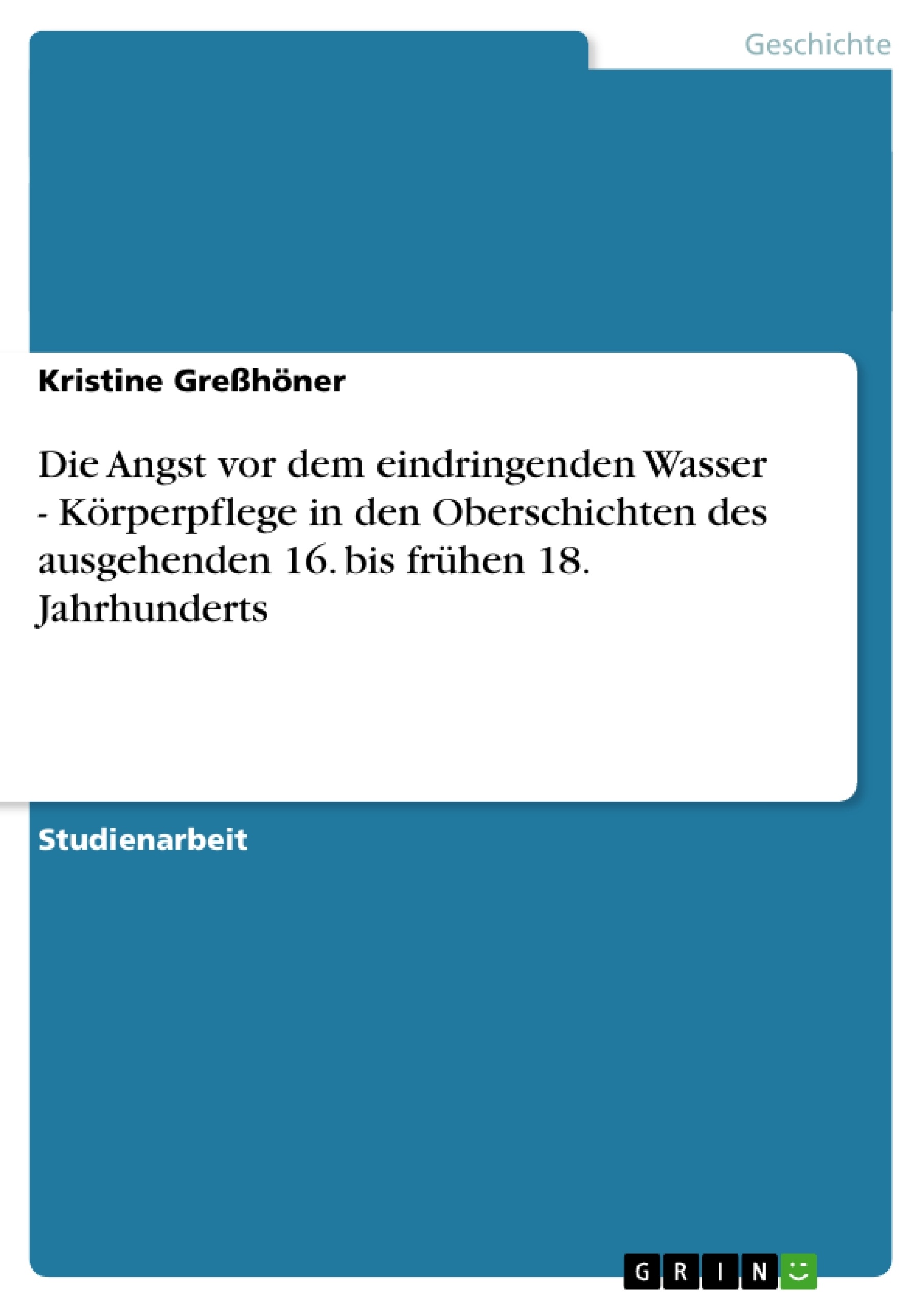Dieses Bild scheint das Klischee des weiß gepuderten Adeligen zu belegen: der Dreck wird übergepudert, das Haar nicht gewaschen, in den Achseln lenken Parfümkissen vom Schweißgeruch ab und Mitesser werden mit Schönheitspflästerchen überklebt. Man macht es sich zu einfach, würde man die Oberschichten an den adeligen Höfen des 16. bis 18. Jahrhunderts zu reichen Schmutzfinken degradieren. Aus sozialer Sicht wäre zu argumentieren, dass Hygiene begrifflich so flexibel sein müsse, dass sie eben das ausmacht, was der jeweilige Mensch seiner Zeit in sie interpretiert oder schlichtweg wie er sie definiert. Aus medizinischer Sicht wäre zu untersuchen, was die jeweiligen Praktiken bewirkten, was aus medizinischer Sicht hygienischer wäre – Körperpflege heute oder Körperpflege damals? Letzteres würde zu weit führen an dieser Stelle und reicht m. E. zu weit in den Bereich der Dermatologie u. a. hinein. Doch die Frage bleibt, was eine Toilette eben ausmacht. Der Stuhlgang ist heute wie damals Bestandteil, davon kann man ausgehen, doch die morgendliche Dusche, das Putzen der Zähne, das Kämmen der Haare – was sind ihre Vorläufer, bedenke man, dass Technik, Kosmetikindustrie und Medizin von den Neuerungen unserer Zeit noch entfernt waren? Wie Körperpflege beim angeblich so schmutzigen Adel aussah, wie diese durchgeführt, wahrgenommen und definiert wurde, wird im Folgenden zu klären sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Forschungsstand
- Die Praktiken physischer Hygiene
- Das Baden des Körpers als unübliche Praxis
- Die trockene Toilette
- Sauberkeit des Sichtbaren: Leibwäsche, Puder und Parfüm
- Reinlichkeit in Erziehungsinstruktionen
- Auswirkungen der Hygienemaßstäbe am Beispiel der Krätze
- Ausblick auf die Entwicklung zur Jahrhundertwende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Körperpflegepraktiken in den Oberschichten Nordwestdeutschlands vom ausgehenden 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert. Ziel ist es, die damaligen Vorstellungen von Hygiene und Reinlichkeit zu rekonstruieren und deren soziale und kulturelle Bedeutung zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die vorhandenen Quellen und setzt sie in den Kontext der damaligen Zeit.
- Entwicklung und Wandel von Körperpflegepraktiken
- Soziale und kulturelle Interpretationen von Hygiene
- Der Einfluss von Erziehung und gesellschaftlichen Normen
- Vergleich mit zeitgenössischen Praktiken in anderen Regionen (z.B. Frankreich)
- Die Rolle von Medizin und Mode in Bezug auf Körperpflege
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Forschungsstand: Die Einleitung diskutiert die Schwierigkeiten, ein umfassendes Bild der Körperhygiene im untersuchten Zeitraum zu gewinnen, da Studien für den deutschsprachigen Raum Mangelware sind. Sie verweist auf die Notwendigkeit, auf Sekundärliteratur und Primärquellen zurückzugreifen, die sich mit Erziehung, Körperverständnis, Medizin, Anstand, Mode und Repräsentation befassen. Es wird die Forschungslücke in Bezug auf Körperhygiene in Deutschland aufgezeigt und die vorhandenen Quellen und deren Limitationen beschrieben. Die Arbeit zielt darauf ab, die Wahrnehmung, Durchführung und das Verständnis von Körperpflege im Kontext der Frühen Neuzeit zu beleuchten.
Die Praktiken physischer Hygiene: Dieses Kapitel untersucht die Körperpflegepraktiken des Adels im 16. bis 18. Jahrhundert. Es beleuchtet den Wandel des Badens vom Spätmittelalter in die Frühe Neuzeit, wobei der Fokus auf dem Rückgang des öffentlichen Badens liegt. Die Arbeit untersucht die Gründe hierfür, welche unter anderem in der Veränderung sozialer Normen und der Entwicklung neuer Vorstellungen über den Zusammenhang von Wasser und Körper zu suchen sind. Weiterhin werden die Praktiken der „trockenen Toilette“, einschließlich Leibwäsche, Puder und Parfüm, als Alternative zum Baden analysiert und in den gesellschaftlichen Kontext eingeordnet. Der Text betont die soziale Differenzierung der Körperkultur und die Kontinuität des Badens in ländlichen Gebieten.
Schlüsselwörter
Körperhygiene, Frühe Neuzeit, Adel, Nordwestdeutschland, Baden, Sauberkeit, Reinlichkeit, soziale Normen, Medizin, Mode, Repräsentation, Erziehung, Frankreich.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Körperpflegepraktiken im nordwestdeutschen Adel (16.-18. Jahrhundert)
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die Körperpflegepraktiken des Adels in Nordwestdeutschland vom ausgehenden 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert. Sie rekonstruiert die damaligen Vorstellungen von Hygiene und Reinlichkeit und beleuchtet deren soziale und kulturelle Bedeutung.
Welche Aspekte der Körperpflege werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte der Körperpflege, darunter das Baden (inklusive des Rückgangs des öffentlichen Badens und der Gründe dafür), die „trockene Toilette“ (als Alternative zum Baden), die Verwendung von Leibwäsche, Puder und Parfüm. Der Fokus liegt auf der sozialen Differenzierung der Körperkultur und dem Wandel der Praktiken im untersuchten Zeitraum.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Studie greift auf Sekundärliteratur und Primärquellen zurück, die sich mit Erziehung, Körperverständnis, Medizin, Anstand, Mode und Repräsentation befassen. Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeiten, ein umfassendes Bild der Körperhygiene im untersuchten Zeitraum zu gewinnen, da Studien für den deutschsprachigen Raum Mangelware sind und beschreibt die Limitationen der verwendeten Quellen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, die Wahrnehmung, Durchführung und das Verständnis von Körperpflege im Kontext der Frühen Neuzeit zu beleuchten. Sie analysiert die Entwicklung und den Wandel von Körperpflegepraktiken, deren soziale und kulturelle Interpretationen sowie den Einfluss von Erziehung und gesellschaftlichen Normen. Ein Vergleich mit zeitgenössischen Praktiken in anderen Regionen (z.B. Frankreich) und die Rolle von Medizin und Mode werden ebenfalls betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie beinhaltet eine Einleitung mit Forschungsstand, ein Kapitel über die Praktiken physischer Hygiene (Baden, trockene Toilette, Leibwäsche etc.), ein Kapitel über Reinlichkeit in Erziehungsinstruktionen, ein Kapitel zu den Auswirkungen der Hygienemaßstäbe am Beispiel der Krätze und einen Ausblick auf die Entwicklung zur Jahrhundertwende.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Körperhygiene, Frühe Neuzeit, Adel, Nordwestdeutschland, Baden, Sauberkeit, Reinlichkeit, soziale Normen, Medizin, Mode, Repräsentation, Erziehung, Frankreich.
Welche Forschungslücke schließt die Studie?
Die Studie adressiert die Forschungslücke in Bezug auf Körperhygiene im deutschsprachigen Raum der Frühen Neuzeit. Sie trägt dazu bei, ein detaillierteres Verständnis der Körperpflegepraktiken und -vorstellungen dieser Epoche zu entwickeln.
- Citar trabajo
- Kristine Greßhöner (Autor), 2004, Die Angst vor dem eindringenden Wasser - Körperpflege in den Oberschichten des ausgehenden 16. bis frühen 18. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29653