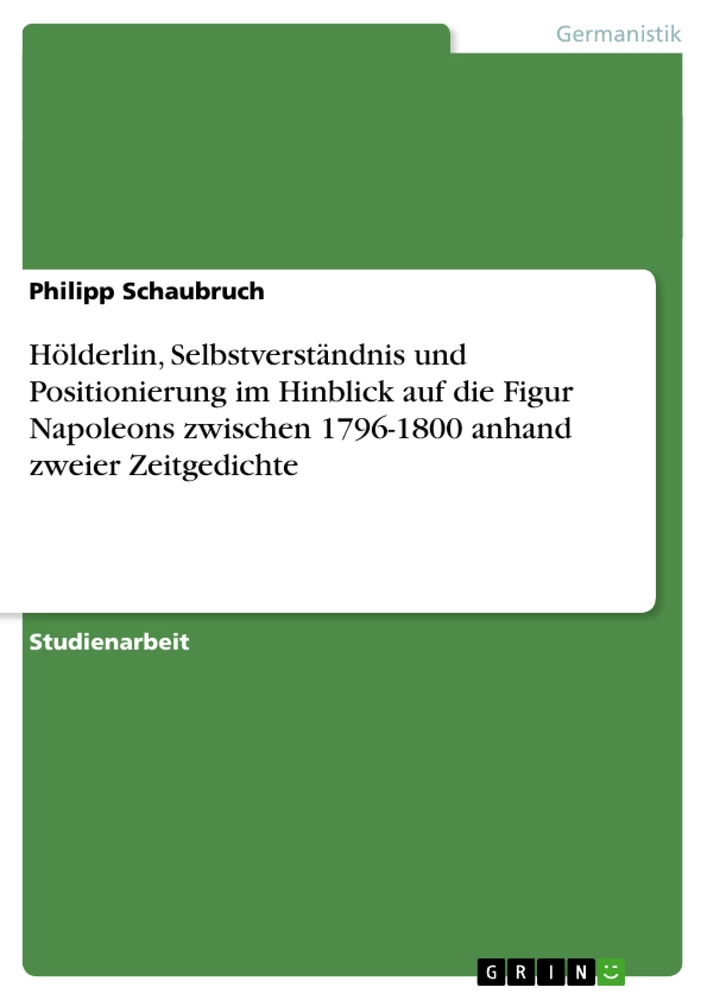Blickt man, ausgehend vom 21. Jahrhundert zurück in die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der Werke Friedrich Hölderlins, so scheint den interessierten Leser die ungeheuere Vielfalt an Texten, an Auslegungen und Interpretationen zu erschlagen. War man im 19. Jahrhundert noch damit beschäftigt, die ungeheure Fülle literarischen Materials zu ordnen und zu chronologisieren, setzte erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine zunehmende Faszination und Begeisterung für seine Werke, aber auch vor allem für Hölderlin selbst als dichterische Existenz ein. Das Exklusiv-Schwierige, die Dunkelheit in vielen Gedichten, ausgelöst durch sich verstärkende Schübe der Geisteskrankheit spiegeln sich in mannigfaltigen Chiffren und Netzwerken wieder. Die Folge war die Nutzung seiner Schriften in unterschiedlichsten ideologischen Zusammenhängen. Jochen Faust beschreibt diese Entfremdung, bzw. stark reduzierende, einseitige Perspektive farblich sehr treffend mit dem „idealischen Licht des Georgekreises über Heideggers Erdbraun, die schwärzliche Restaurationsgestalt der 50er Jahre, bis zum roten Knalleffekt von 1968“.
...
In der folgenden Ausarbeitung soll nun, der Problematik der Hölderlin-Forschung bewusst versucht werden das Selbstverständnis Hölderlins als Dichter in einem engen Zeitausschnitt anhand zweier Gedichte zu untersuchen. Zugrunde gelegt wird eine Hermeneutik im Sinne eines dreidimensionalen Ansatzes (vgl. Beyer/ Brauer 2000), die das Leben (Realgeschichte), Dichten (visionäre Wahrnehmung und Darstellung) und Denken (Reflektion) des Dichters in einer zusammenfassenden Analyse untersuchen soll. Entscheidend wird es um die Fragen gehen, welche Rolle Napoleon für Hölderlin spie lte und welche Position er seiner eigenen Person im geschichtlichen Rahmen dabei einräumte. Hierbei soll auch das zunehmende Spannungsfeld zwischen den eigenen Idealen und der tatsächlich erlebten Wirklichkeit in Deutschland Gegenstand der Betrachtung sein. Die ausgewählten Gedichte bieten sich durch ihre besondere Eigenreflexion hier- für besonders an. Die französische Revolution (1789) als zentrales und prägendes Ereignis des 18. Jahrhunderts mit Einflüssen im gesamten europäischen Raum steht im Blickfeld der Realgeschichte (Leben) Hölderlins und soll im Folgenden kurz skizziert werden. Die verwendeten Gedichte stammen bevorzugt aus der Frankfurter Hölderlin Ausgabe und werden im Folgenden, außer abweichend, nicht extra gelistet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung/ Bezug zur französischen Revolution
- Historischer Hintergrund
- Intentionsansätze/ realgeschichtliche Verarbeitungsbezüge Hölderlins
- Textbezogene Überlegungen
- Buonaparte
- Dem Allbekannten
- Fazit/ Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Selbstverständnis Friedrich Hölderlins als Dichter im Kontext der französischen Revolution (1796-1800) anhand zweier seiner Gedichte. Die Arbeit nutzt einen dreidimensionalen hermeneutischen Ansatz, der Leben, Dichten und Denken des Dichters in Beziehung setzt. Der Fokus liegt auf Hölderlins Positionierung im Hinblick auf Napoleon und das Spannungsfeld zwischen seinen Idealen und der Realität.
- Hölderlins Selbstverständnis als Dichter
- Hölderlins Reaktion auf die Französische Revolution
- Die Rolle Napoleons in Hölderlins Werk
- Das Spannungsverhältnis zwischen Ideal und Realität in Hölderlins Dichtung
- Der Einfluss der Französischen Revolution auf die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die umfangreiche und oft ideologisch geprägte Forschungslandschaft zu Hölderlin. Sie kündigt den Ansatz der Arbeit an, Hölderlins Selbstverständnis anhand zweier Gedichte und eines dreidimensionalen hermeneutischen Ansatzes zu untersuchen, der Leben, Dichten und Denken des Dichters verbindet. Der Fokus liegt auf Hölderlins Verhältnis zu Napoleon und dem Spannungsfeld zwischen seinen Idealen und der erlebten Realität.
Entwicklung/ Bezug zur französischen Revolution: Dieses Kapitel beschreibt zunächst den historischen Hintergrund in Deutschland um 1796-1800, charakterisiert durch eine zersplitterte politische Landschaft und eine überwiegend agrarische Wirtschaft. Es beleuchtet die Aufnahme revolutionärer Ideen in Deutschland und den Kontrast zur französischen Situation. Der Abschnitt geht auf den militärischen Verlauf ein, besonders den Rheinübergang der Franzosen und die daraus resultierenden Plünderungen, die das Bild der Franzosen als Befreier zerstörten. Die Rolle Napoleons, der die revolutionären Kräfte in Deutschland nicht unterstützte und stattdessen absolutistische Regime installierte, wird hervorgehoben. Der Abschnitt führt zur Frage, wie Hölderlin diese Ereignisse literarisch verarbeitet.
Textbezogene Überlegungen: Dieses Kapitel (welches im Auszug nicht enthalten ist) würde eine detaillierte Analyse der ausgewählten Gedichte Hölderlins im Kontext der oben dargestellten historischen und biographischen Informationen liefern. Die Analyse würde die literarischen Mittel untersuchen, mit denen Hölderlin seine Positionierung und sein Selbstverständnis ausdrückt, und seine Auseinandersetzung mit den Ereignissen der Französischen Revolution und der Figur Napoleons beleuchten.
Schlüsselwörter
Friedrich Hölderlin, Französische Revolution, Napoleon, Selbstverständnis, Dichtung, Realgeschichte, Ideale, Hermeneutik, Zeitgedichte, Deutschland, politische Situation, Künstler, politischer Aktivist.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Friedrich Hölderlin und die Französische Revolution
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht das Selbstverständnis Friedrich Hölderlins als Dichter im Kontext der Französischen Revolution (1796-1800) anhand zweier seiner Gedichte. Sie nutzt einen dreidimensionalen hermeneutischen Ansatz, der Leben, Dichten und Denken des Dichters in Beziehung setzt und fokussiert auf Hölderlins Positionierung zu Napoleon und dem Spannungsfeld zwischen seinen Idealen und der Realität.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Hölderlins Selbstverständnis als Dichter, seine Reaktion auf die Französische Revolution, die Rolle Napoleons in seinem Werk, das Spannungsverhältnis zwischen Ideal und Realität in seiner Dichtung und den Einfluss der Französischen Revolution auf die deutsche Gesellschaft.
Welche Methode wird in der Hausarbeit angewendet?
Die Hausarbeit verwendet einen dreidimensionalen hermeneutischen Ansatz, der Leben, Werk und Denken Hölderlins miteinander verbindet, um sein Selbstverständnis zu ergründen.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Hausarbeit basiert auf zwei Gedichten Friedrich Hölderlins und berücksichtigt den historischen Kontext der Französischen Revolution in Deutschland (1796-1800). Der Text erwähnt explizit die historische Situation in Deutschland, den Verlauf der französischen Revolution und die Rolle Napoleons. Eine detaillierte Analyse der Gedichte ist im Auszug nicht enthalten.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Entwicklung/ Bezug zur französischen Revolution (mit den Unterkapiteln Historischer Hintergrund und Intentionsansätze/ realgeschichtliche Verarbeitungsbezüge Hölderlins), Textbezogene Überlegungen (mit den Unterkapiteln Buonaparte und Dem Allbekannten) und Fazit/Schluss. Die Einleitung skizziert die Forschungslandschaft zu Hölderlin und den Ansatz der Arbeit. Das Kapitel zur Entwicklung beschreibt den historischen Hintergrund und die literarische Verarbeitung der Ereignisse durch Hölderlin. Das Kapitel zu den Textbezogenen Überlegungen analysiert die ausgewählten Gedichte. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Hölderlin, Französische Revolution, Napoleon, Selbstverständnis, Dichtung, Realgeschichte, Ideale, Hermeneutik, Zeitgedichte, Deutschland, politische Situation, Künstler, politischer Aktivist.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der Einleitung und des Kapitels zur Entwicklung/Bezug zur französischen Revolution. Die Zusammenfassung der Einleitung beschreibt den Ansatz der Arbeit. Die Zusammenfassung des zweiten Kapitels beschreibt den historischen Kontext in Deutschland um 1796-1800, die Aufnahme revolutionärer Ideen und die Rolle Napoleons. Eine Zusammenfassung des Kapitels zu den Textbezogenen Überlegungen ist nur in allgemeiner Form vorhanden, da die detaillierte Analyse der Gedichte nicht im Auszug enthalten ist.
- Arbeit zitieren
- Philipp Schaubruch (Autor:in), 2004, Hölderlin, Selbstverständnis und Positionierung im Hinblick auf die Figur Napoleons zwischen 1796-1800 anhand zweier Zeitgedichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29690