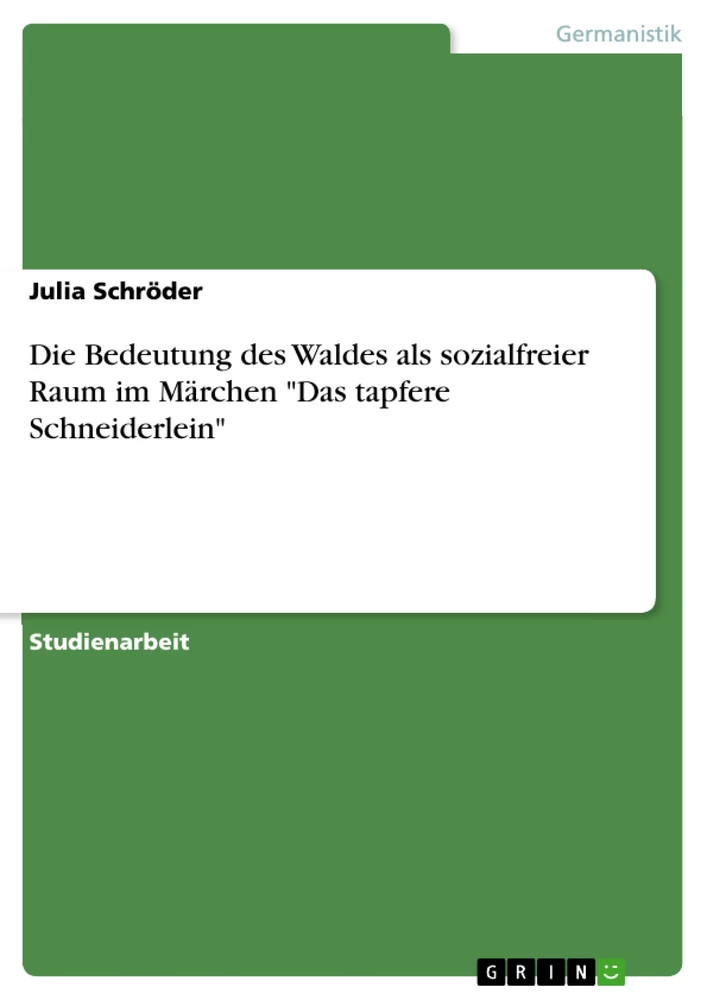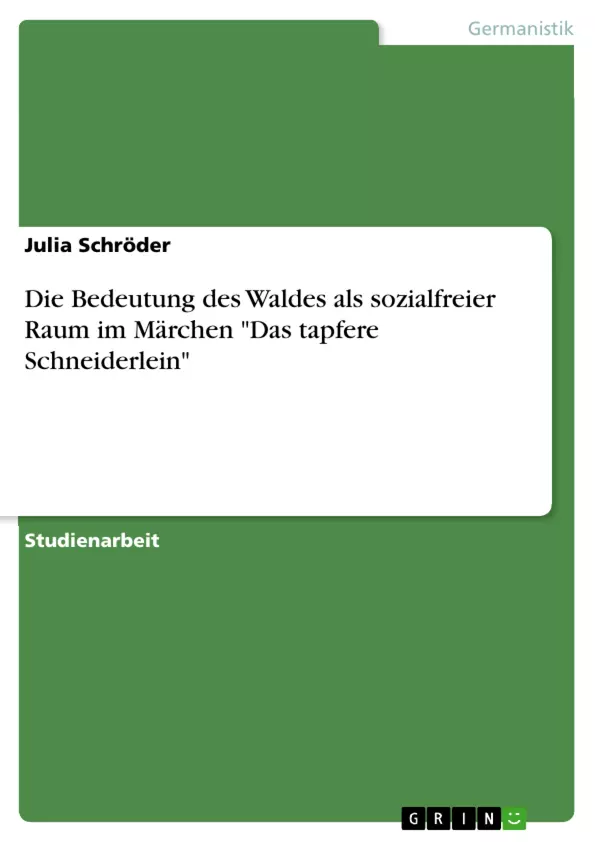Das Märchen wurde in der Epochenwende von der Klassik zur Romantik zum wichtigen Bestandteil der deutschen Literatur. Dichter und Autoren sahen im Märchen das „wahrhaft Poetische“, ein Instrument zur Poetisierung der Wirklichkeit.
Anhand des Märchens „Das tapfere Schneiderlein“ von den Brüdern Grimm soll die Gattung differenziert beleuchtet werden. Schwerpunkt dieser Arbeit bildet im Rahmen einer immanenten Textinterpretation die Frage, inwieweit sich der Wald als gesellschaftsfreier Raum auf die Entwicklung und Verwandlung des Helden im o.g. Märchen auswirkt. Nach kurzen biographischen Hinweisen zu den Brüdern Grimm soll dann der sozialhistorische Hintergrund der damaligen Gesellschaft kurz behandelt und das Motiv des Waldes in der Romantik soweit beleuchtet werden, wie es für das Verständnis und die Interpretation des Märchens hilfreich erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Hauptteil ........
- 2.1 Biographie der Brüder Grimm
- 2.1.1 Der sozialhistorische Hintergrund der damaligen Gesellschaft (Wende 18./19. Jahrhundert)...
- 2.2 Märchenanalyse am Beispiel „Das tapfere Schneiderlein“ .......
- 2.2.1 Aufbau und Erzählweise.
- 2.2.2 Die Verwandlung des Schneiderleins - ein sozialer Paradigmenwechsel
- 2.2.3 Held, Gegner, König - Held ist körperlicher und gesellschaftlicher Macht überlegen...
- 2.3 Bedeutung des Märchens für die damalige Gesellschaft ....
- 3 Schluss
- 4 Literaturverzeichnis ........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Waldes als sozialfreier Raum im Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ der Brüder Grimm. Durch eine immanente Textinterpretation soll gezeigt werden, wie sich der Wald auf die Entwicklung und Verwandlung des Helden im Märchen auswirkt. Darüber hinaus werden kurze biographische Hinweise zu den Brüdern Grimm sowie der sozialhistorische Hintergrund der damaligen Gesellschaft beleuchtet, um das Motiv des Waldes im Kontext der Romantik besser zu verstehen.
- Die Rolle des Waldes als sozialfreier Raum im Märchen.
- Die Entwicklung und Verwandlung des Helden im Märchen.
- Die Bedeutung des Märchens für die damalige Gesellschaft.
- Der Einfluss des sozialhistorischen Hintergrunds auf die Gestaltung des Märchens.
- Das Motiv des Waldes in der Romantik.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in das Thema und beschreibt die Bedeutung des Märchens im Kontext der Epochenwende von der Klassik zur Romantik. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Biographie der Brüder Grimm und dem sozialhistorischen Hintergrund der damaligen Gesellschaft, um das Motiv des Waldes im Märchen besser zu verstehen. Das dritte Kapitel analysiert das Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ hinsichtlich seines Aufbaus, seiner Erzählweise und der Verwandlung des Helden.
Schlüsselwörter
Märchen, „Das tapfere Schneiderlein“, Brüder Grimm, sozialfreier Raum, Wald, Romantik, Epochenwende, Klassik, sozialhistorischer Hintergrund, Held, Verwandlung, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der Wald im Märchen „Das tapfere Schneiderlein“?
Der Wald fungiert als sozialfreier Raum, in dem gesellschaftliche Hierarchien keine Rolle spielen und der Held seine innere Wandlung und Stärke beweisen kann.
Welchen sozialen Paradigmenwechsel vollzieht das Schneiderlein?
Vom einfachen, unterschätzten Handwerker entwickelt er sich durch List und Selbstvertrauen zu einem Helden, der am Ende die Königswürde erlangt.
Warum war das Märchen in der Romantik so wichtig?
Dichter der Romantik sahen im Märchen das „wahrhaft Poetische“ und ein Instrument zur Poetisierung der oft als bedrückend empfundenen Wirklichkeit.
Wie wird das Schneiderlein seinen Gegnern überlegen?
Er nutzt nicht körperliche Kraft, sondern geistige Überlegenheit und List, um Riesen und Einhörner zu besiegen, was einen Sieg des Geistes über rohe Gewalt darstellt.
Welchen biographischen Hintergrund haben die Brüder Grimm?
Die Arbeit beleuchtet das Leben der Brüder Grimm im Kontext der Epochenwende vom 18. zum 19. Jahrhundert und ihre Motivation zur Sammlung deutscher Volksmärchen.
- Citar trabajo
- Magistra Artium Julia Schröder (Autor), 2000, Die Bedeutung des Waldes als sozialfreier Raum im Märchen "Das tapfere Schneiderlein", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2970