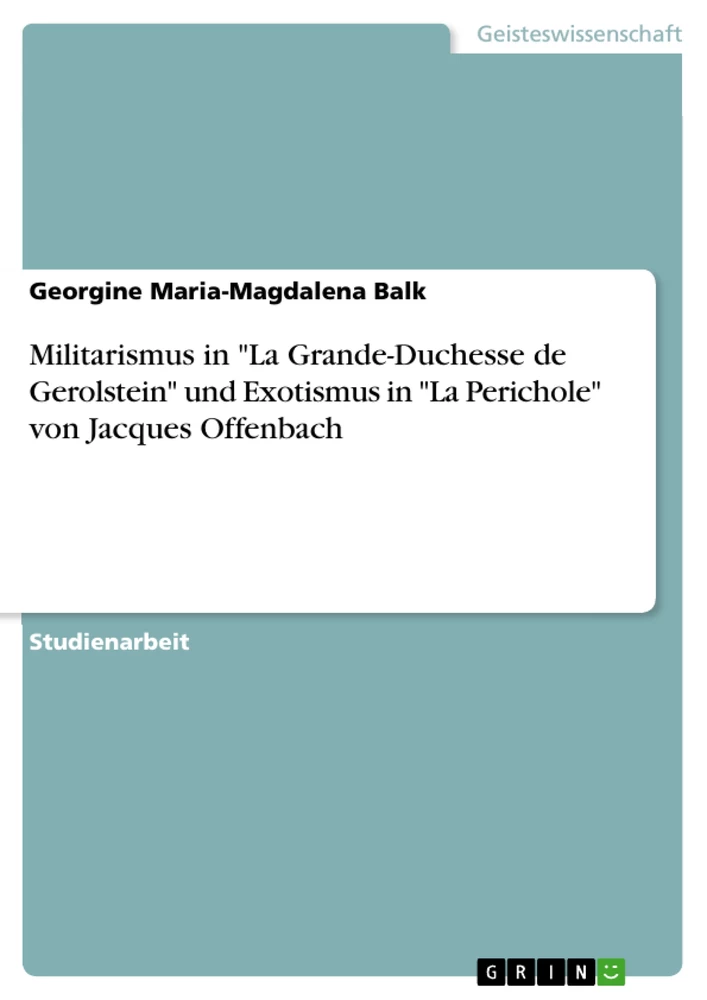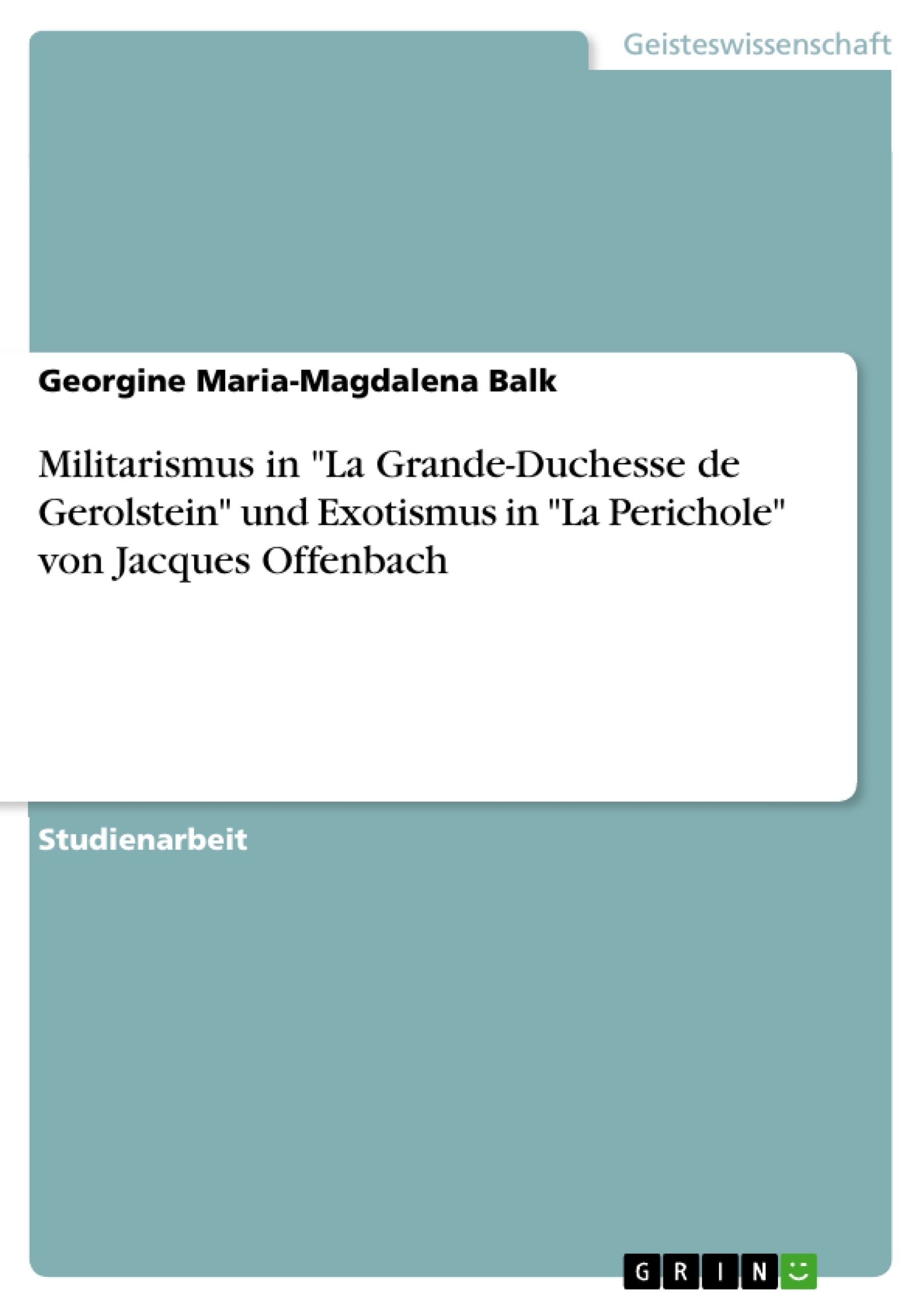Das Second Empire stand 1867 bereits kurz vor seinem Untergang. Doch Bürger Frankreichs nahmen den Ernst der Lage nicht wahr, statt dessen besuchten sie das Theater und verdrängten die eigene Realität, während auf der Bühne z.B. in Offenbachs „La Grande-Duchesse de Gérolstein" eine Karikatur der europäischen Zustände gezeigt wurde. Bereits im gleichen Jahr löste die opéra bouffe in Wien, in England und den Vereinigten Staaten geradezu eine Offenbach-Manie aus. Da aber mit Blick auf Preußen und Napoleon III. die Grundzüge des Librettos nicht ganz aus der Luft gegriffen waren und außerdem die Sensibilität gegenüber der Brisanz des Stoffs zunehmend wuchs, wurde das Stück Ende der 1860er Jahre immer häufiger aus dem Spielplan genommen. Nach der Niederlage der Franzosen gegen die Deutschen 1871 wurde es gar verboten. Schon ein halbes Jahrhundert später galt die opéra bouffe nur mehr als historischer Militärschwank, wurde unbesorgt mitten im ersten Weltkrieg herausgebracht und verursachte keinerlei empörte Reaktionen.
Neben „La Grande-Duchesse de Gérolstein" fällt auch „La Périchole" in die Zeit der sogenannten Goldenen Jahre der Offenbach’schen Operettenproduktion In beiden Fällen soll gleichermaßen historischer Stoff plausibel gemacht werden - in „La Périchole“ erinnert man dabei an eine wohl historische Begebenheit, in „La Grande-Duchesse de Gérolstein" ist die Handlung zwar absolut frei erfunden, doch die Anlehnungen an aktuelle Zustände ist unverkennbar. Um keine Angriffsfläche für die Zensur zu bieten spielen beide Werke an einem fernen oder sogar imaginären Ort, hundert Jahre vor der Zeit Offenbachs.
Der Spielort von „La Périchole" nämlich Lima, die Hauptstadt Perus bedient jedoch ein weiteres zentrales Klischee der Zeit: den Exotismus. Das Exotische als das ganz Andere, Unbekannte, regte stets die Phantasie stark an, das Interesse gipfelte in den Weltausstellungen von London und Paris ab 1851. Die vorliegende Arbeit stellt allerdings fest, dass „La Périchole" in ihrer Klischeehaftigkeit nicht über sich selbst hinausweist und die opéra bouffe der den Offenbach’schen Werken sonst so eigenen Doppelbödigkeit entbehrt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- La Grande-Duchesse de Gérolstein
- Entstehung und Aufführungsgeschichte
- Fassungen
- Die Situation im Frankreich des Second Empire und während der Weltausstellung 1867
- Militär auf dem Theater
- Militarismus
- Begriffsbestimmung
- Militarismus in La Grande-Duchesse de Gérolstein
- Militär in anderen Werken Offenbachs
- La Périchole
- Entstehung
- Fassungen
- La Périchole eine opéra bouffe mit Tendenz zur opéra comique
- Exotismus
- Begriffsbestimmung
- Exotismus in Offenbachs Werk
- Exotismus in La Périchole
- Zusammenfasssung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Opern La Grande-Duchesse de Gérolstein und La Périchole von Jacques Offenbach. Die Arbeit analysiert die beiden Werke im Kontext ihrer Entstehungszeit und untersucht die Themen Militarismus und Exotismus, die in beiden Werken eine zentrale Rolle spielen. Ziel ist es, Offenbachs satirische Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist und seinen künstlerischen Umgang mit den Themen Militarismus und Exotismus zu erforschen.
- Die Rolle von Militär und Militarismus im Kontext des Zweiten Kaiserreichs in La Grande-Duchesse de Gérolstein
- Die satirische Darstellung von Macht und Gesellschaft in La Grande-Duchesse de Gérolstein
- Die Verwendung exotischer Elemente und deren Bedeutung in La Périchole
- Die Grenzen zwischen opéra bouffe und opéra comique in La Périchole
- Offenbachs Beitrag zur Entwicklung des französischen Musiktheaters
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Recherche zu Werken Offenbachs verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf die begrenzte Verfügbarkeit von Quellen und kritischen Ausgaben. Sie erläutert auch die Quellenlage und die verwendeten Materialien für die beiden untersuchten Opern.
- Das Kapitel über La Grande-Duchesse de Gérolstein befasst sich mit der Entstehungsgeschichte und den Aufführungsgeschichte des Werks, sowie mit der Bedeutung der politischen und gesellschaftlichen Situation im Frankreich des Second Empire und während der Weltausstellung 1867. Es analysiert auch den Einsatz von Militärthemen und das Konzept des Militarismus in der Oper.
- Das Kapitel über La Périchole erforscht die Entstehung und die verschiedenen Fassungen des Werks. Es untersucht die Einordnung der Oper als opéra bouffe mit Tendenzen zur opéra comique, und analysiert den Einsatz exotischer Elemente in der Oper und deren Bedeutung für das Werk.
Schlüsselwörter
Oper, Jacques Offenbach, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Périchole, opéra bouffe, opéra comique, Militarismus, Exotismus, Second Empire, Paris, Weltausstellung 1867, Catherine-Jeanne-Hortense Schneider, Henri Meilhac, Ludovic Halévy.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde "La Grande-Duchesse de Gérolstein" zeitweise verboten?
Die Operette karikierte den Militarismus so treffend, dass sie nach der französischen Niederlage gegen Deutschland 1871 als politisch zu brisant galt.
Was thematisiert Offenbach in "La Périchole"?
Das Werk nutzt den Exotismus (Spielort Lima, Peru), um gesellschaftliche Zustände zu spiegeln, wobei es Züge einer opéra comique trägt.
Was ist der historische Kontext dieser Operetten?
Sie entstanden während des Second Empire in Frankreich, einer Zeit, in der das Bürgertum Realitätsverdrängung suchte, während Offenbach die politischen Zustände auf der Bühne parodierte.
Was versteht man unter Exotismus im Musiktheater?
Die Verwendung fremder, oft klischeehafter Schauplätze und kultureller Elemente, um das Interesse des Publikums am Unbekannten zu bedienen.
Wer waren die Librettisten von Offenbach?
Henri Meilhac und Ludovic Halévy waren die maßgeblichen Autoren, die Offenbachs satirische Visionen in Textform umsetzten.
- Arbeit zitieren
- M.A. Georgine Maria-Magdalena Balk (Autor:in), 2004, Militarismus in "La Grande-Duchesse de Gerolstein" und Exotismus in "La Perichole" von Jacques Offenbach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29728