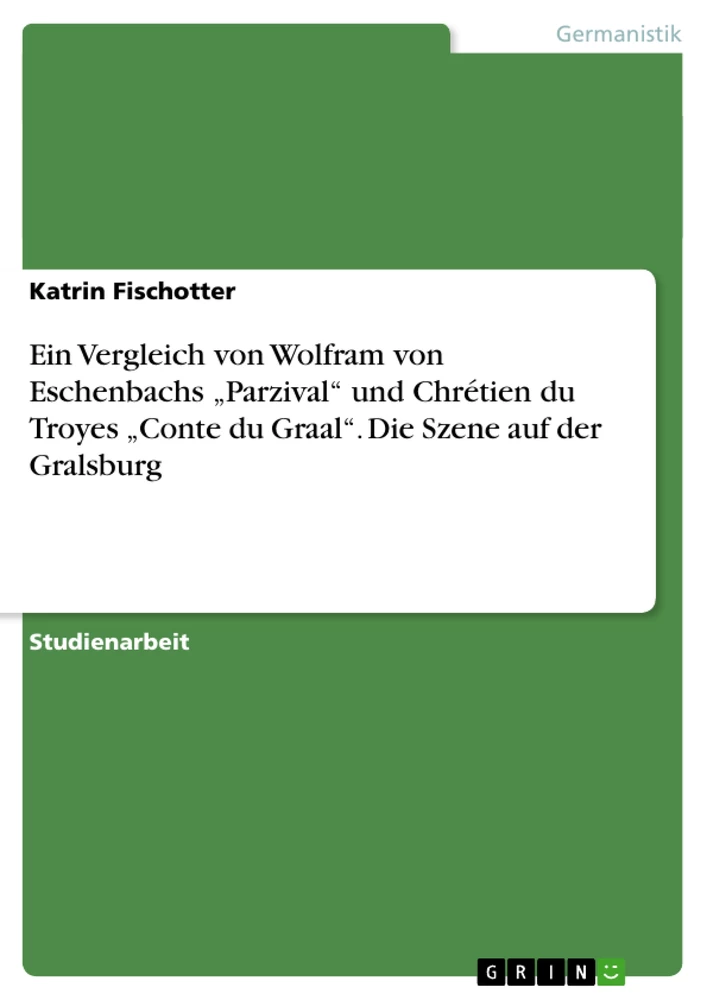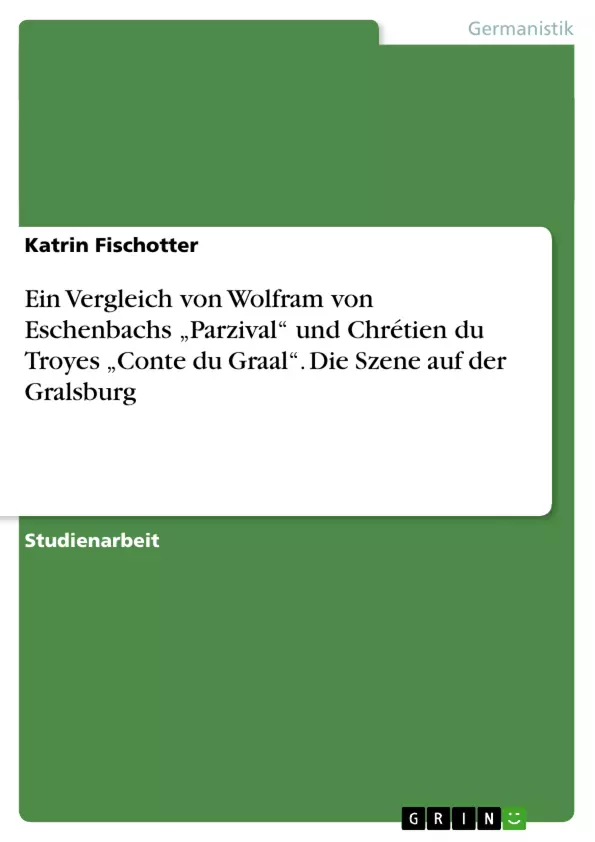Da um 1200 beinahe alle deutschen Romane auf eine französische Vorlage zurückgehen, gibt der Vergleich mit der französischen Quelle Aufschluss über die künstlerische Individualität und den Anteil der Durchformung durch den deutschen Autor. Wie hat ein Schriftsteller also die Vorlage verändert, mit welcher Intention und wie beeinflusste er damit auch die Gesamtpräsentation des Stoffes? Dies sind Fragen, die man nur durch den genauen Textvergleich lösen kann. Der Rückgriff auf Quellen war im Mittelalter üblich, da es nicht gefragt war neue Stoffe zu erfinden, sondern höchstes Gebot, Wahrheit zu verbreiten. Diese Wahrheit wurde nur unter Berufung auf vorangegangene Quellen beglaubigt und fand meist im Vorwort statt. Damit wurden die Texte für die mittelalterlichen Rezipienten glaubwürdig. Auch einer der beliebtesten französischen Dichter dessen Werke von vielen deutschen Autoren adaptiert wurden, Chrétien de Troyes, gibt nicht vor etwas zu erfinden, sondern erklärt viele kleinere Erzählungen zu einem Sinnganzen zusammenzufügen und gilt damit als Begründer der ‚bele conjointure’.
Die deutschen Dichtungen weichen in der Regel in Nuancen von ihren Vorlagen ab und gerade in dieser Abweichung kann man das Besondere der Literatur erkennen. Wolfram von Eschenbach dagegen, der wahrscheinlich zwischen 1200 und 1210 den Parzival verfasste, hatte weitaus mehr Spielraum in seiner Dichtung, da Chrétien de Troyes Le Roman de Perceval ou Le Conte du Graal, zwischen 1180 und 1190 verfasst, kein fertiggestellter Roman war. Es gilt heute als sicher, dass Wolframs Quelle dieser Roman Chrétiens war, auch wenn der Erzähler im Parzival behauptet, die Geschichte von einem Provenzalen Namens Kyot gehört zu haben. Die Bücher 3-12 des Parzival gehen auf Chrétien zurück, während die Vorgeschichte und die ‚Fertigdichtung’ des Roman de Perceval alleinig Wolframs Schaffung sind. Für diesen Teil zog er wahrscheinlich verschiedene Motive aus anderen, damals bekannter Geschichten heran. Auch hat Wolfram besonders in der Gralszene einiges, was er sich vielleicht nicht erklären konnte, zu seiner Hauptvorlage verändert. Vielleicht erfand er daher Kyot, damit man seiner Geschichte nicht die Glaubwürdigkeit absprechen konnte.
Gerade aus diesen Gründen ist Wolframs Parzival und besonders die Szene auf der Gralburg, so interessant. Hier scheint man besonders viel über den künstlerischen Stil und die Individualität des Autors Wolfram von Eschenbach zu erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Adaption Courtoise und der Parzival Wolfram von Eschenbachs
- Hauptteil
- Der Weg zur Gralburg
- Empfang auf der Gralburg
- Die Gralprozession
- Schwert und Lanze
- Der Gral und die Speisung
- Die Nacht auf der Gralburg und das,böse' Erwachen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Wolfram von Eschenbachs "Parzival" im Kontext der französischen Vorlage, Chrétien de Troyes' "Conte du Graal". Der Fokus liegt auf der Anpassung des "Conte du Graal" durch Wolfram, insbesondere in der Szene auf der Gralburg, und untersucht die künstlerische Individualität des Autors und die Bedeutung seiner Änderungen für die Gesamtpräsentation der Geschichte.
- Adaption des "Conte du Graal" durch Wolfram von Eschenbach
- Künstlerische Individualität Wolframs und seine Einflüsse auf die Geschichte
- Analyse der Szene auf der Gralburg im Textvergleich
- Untersuchung der Rolle von Tradition und Innovation in der mittelalterlichen Literatur
- Bedeutung der Quellen und deren Einfluss auf die Gestaltung der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Adaption Courtoise und den Vergleich zwischen Wolframs Parzival und Chrétiens Conte du Graal ein. Sie hebt die Bedeutung des Textvergleichs für die Analyse der künstlerischen Individualität des Autors und die Gesamtpräsentation des Stoffes hervor.
Der Hauptteil analysiert den Weg zur Gralburg, den Empfang auf der Gralburg, die Gralprozession, das Schwert und die Lanze, den Gral und die Speisung sowie die Nacht auf der Gralburg. Er vergleicht die Darstellung dieser Elemente in beiden Texten und zeigt auf, wie Wolfram die Vorlage in seinen eigenen Stil überträgt und seine eigene Interpretation der Geschichte zum Ausdruck bringt.
Schlüsselwörter
Adaption Courtoise, Wolfram von Eschenbach, Parzival, Chrétien de Troyes, Conte du Graal, Gralburg, Gralprozession, Schwert, Lanze, Speisung, Tradition, Innovation, Textvergleich, künstlerische Individualität, mittelalterliche Literatur, Quellen, Interpretation.
- Citation du texte
- Katrin Fischotter (Auteur), 2002, Ein Vergleich von Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ und Chrétien du Troyes „Conte du Graal“. Die Szene auf der Gralsburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29742