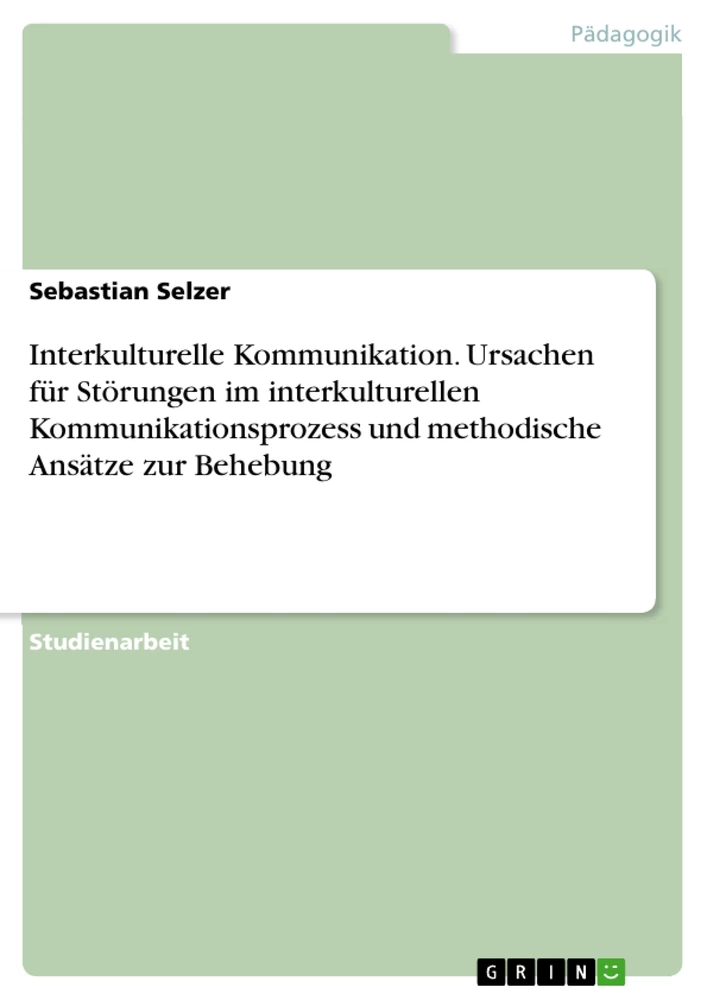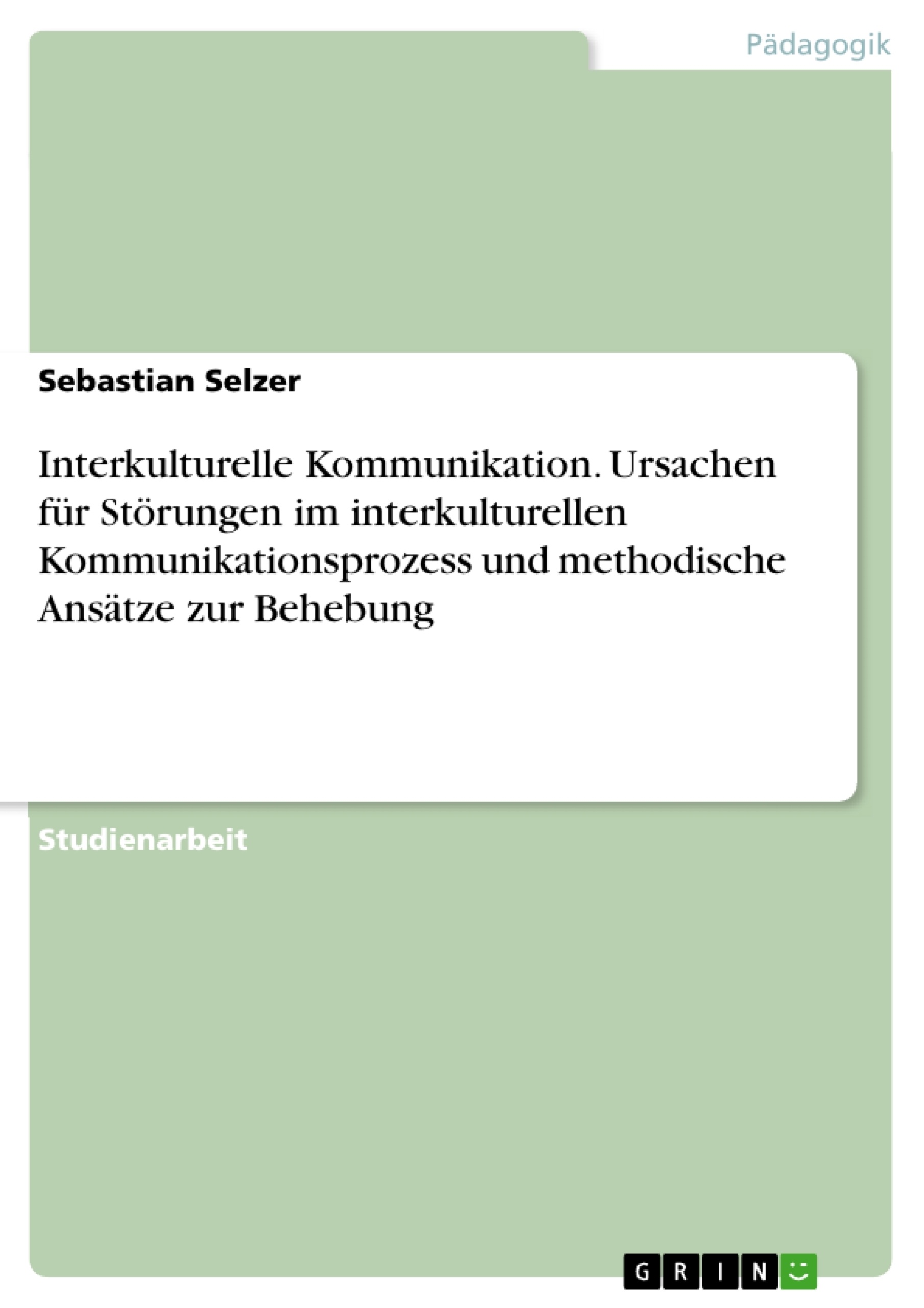In der Zeit der Globalisierung und einer immer mehr pluralisierenden Gesellschaft gewinnt die Interkulturelle Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Ob in der Wirtschaft, in der Schule, im Studium, im alltäglichen Umgang miteinander oder auf ganz persönlicher Ebene sind interkulturelle Kompetenzen immer wichtiger geworden und bieten eine Grundlage für eine solide verbale und nonverbale Kommunikation.
Das Anliegen der Hausarbeit ist es, interkulturelle Kommunikationsprozesse dem Leser näher zu bringen. Dabei wird sich Hauptsächlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie interkulturelle Kommunikations-störungen entsteht, wie man ihr am besten begegnen kann und welche Konzepte es in der Jugendarbeit gibt um interkulturelle Kompetenzen fördern zu können. An einzelnen ausgewählten Beispielen wird erklärt, wie in anderen Kulturkreisen miteinander kommuniziert wird und wo genau die Schwierigkeiten bei der Verständigung liegen.
Um den Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, wird zu Beginn dieser Hausarbeit auf die Begrifflichkeiten der allgemeinen Kommunikation und der interkulturellen Kommunikation eingegangen. Ebenso werden im Punkt 2.3 mögliche störungsverursachende Faktoren vorgestellt. Im dritten Kapitel wird der Schwerpunkt auf die Sprache und Kultur gelegt, wie beide in Interaktion miteinander stehen und welche Kulturmodelle es aktuell gibt. Das dritte und letzte Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen methodischen Vorgehensweisen im schulischen und außerschulischen Bereich. Es wird beschrieben wie interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation jungen Menschen didaktisch vermitteln werden kann. Es werden sechs Konzepte vorgestellt, die schon seit geraumer Zeit in der Praxis durchgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Kommunikation
- 2.1 Kommunikation als allgemeiner Begriff
- 2.2 Interkulturelle Kommunikation
- 2.3 Störungsanfälligkeit interkultureller Kommunikation
- 3 Kultur und Sprache
- 3.1 Definition Kultur
- 3.2 Trans-, Multi- und Interkulturalität
- 3.3 Interkulturelle Kompetenz
- 3.4 Interaktion Sprache und Kultur
- 3.5 Rich Points
- 3.6 Interkulturelle Erziehung
- 4 Didaktische Konzepte Interkulturellen Lernens und interkultureller Kommunikation
- 4.1 Antirassistische Erziehung
- 4.2 Ethnische Spurensuche in Geschichte und Gegenwart
- 4.3 Lernen für Europa
- 4.4 Sprachliche, kulturelle und kommunikationsbezogene Allgemeinbildung
- 4.5 Globales Lernen
- 4.6 Bilder vom Fremden und vom Eigenen wahrnehmen gestalten
- 5 Zusammenfassung
- 6 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit interkulturellen Kommunikationsprozessen. Die zentrale Fragestellung untersucht die Entstehung interkultureller Kommunikationsstörungen, mögliche Lösungsansätze und fördernde Konzepte in der Jugendarbeit. Anhand von Beispielen werden kommunikationsspezifische Unterschiede zwischen Kulturkreisen und resultierende Verständigungsschwierigkeiten erläutert.
- Allgemeine und interkulturelle Kommunikation
- Störungsanfälligkeit interkultureller Kommunikation
- Interaktion von Sprache und Kultur
- Didaktische Konzepte interkulturellen Lernens
- Kulturelle Einflussfaktoren auf die Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der interkulturellen Kommunikation in einer zunehmend globalisierten und pluralistischen Gesellschaft ein. Sie betont die wachsende Bedeutung interkultureller Kompetenzen für gelungene Kommunikation und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Entstehung und Bewältigung interkultureller Kommunikationsstörungen sowie auf die Förderung interkultureller Kompetenzen in der Jugendarbeit.
2 Kommunikation: Dieses Kapitel definiert den allgemeinen Begriff der Kommunikation und beschreibt ihre Merkmale. Es beleuchtet die Bedeutung interkultureller Kommunikation als komplementäre Form des Dialogs und weist auf die Notwendigkeit, kulturspezifische Merkmale differenziert zu betrachten hin. Das Kapitel führt ein in die Problematik der Störungsanfälligkeit interkultureller Kommunikation, ein Thema, das sich als roter Faden durch die gesamte Arbeit zieht.
2.1 Kommunikation als allgemeiner Begriff: Dieses Unterkapitel erläutert Kommunikation als Verbindung, Mitteilung und Beziehung zwischen mindestens zwei Personen, mit dem Ziel des Gedankenaustauschs. Es betont die Rolle von Symbolen und Zeichen, die Mehrdeutigkeit von Bedeutung und die Existenz verschiedener Kommunikationstheorien (z.B. Watzlawick, Schulz von Thun, Mead).
2.2 Interkulturelle Kommunikation: Hier wird der Begriff der interkulturellen Kommunikation definiert und abgegrenzt. Der Fokus liegt auf der zwischenmenschlichen Face-to-Face-Kommunikation zwischen Angehörigen verschiedener Kulturen. Die Wichtigkeit des Dialogs, die Berücksichtigung kultureller Unterschiede und die Notwendigkeit von Empathie werden betont. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Gefahr von Verallgemeinerungen und Stereotypisierungen ist enthalten.
2.3 Störungsanfälligkeit interkultureller Kommunikation: Dieses Unterkapitel behandelt die Faktoren, die zu Störungen in der interkulturellen Kommunikation führen können. Es zeigt die Bedeutung nonverbaler Kommunikation und deren kulturelle Codierung auf (z.B. Blickkontakt). Anhand eines Beispiels einer Lehrersituation mit einer türkischen Schülerin wird die Problematik verdeutlicht. Der Unterschied zwischen Kontakt- und Distanzkulturen bezüglich Körpersprache und räumlicher Distanz wird erläutert.
3 Kultur und Sprache: Dieses Kapitel behandelt den Zusammenhang von Kultur und Sprache im Kontext interkultureller Kommunikation. Es werden verschiedene Kulturmodelle und der Begriff der interkulturellen Kompetenz diskutiert. Die Bedeutung von "Rich Points" als Schlüsselmomente interkultureller Begegnungen wird erläutert, und der Aspekt der interkulturellen Erziehung wird angesprochen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Kommunikationsstörungen, interkulturelle Kompetenz, Kultur, Sprache, Didaktik, Jugendarbeit, nonverbale Kommunikation, Kulturmodelle, Globalisierung, Pluralisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Interkulturelle Kommunikation in der Jugendarbeit"
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit interkulturellen Kommunikationsprozessen, insbesondere mit der Entstehung von Kommunikationsstörungen, möglichen Lösungsansätzen und fördernden Konzepten in der Jugendarbeit. Sie analysiert kommunikationsspezifische Unterschiede zwischen Kulturkreisen und die daraus resultierenden Verständigungsschwierigkeiten anhand von Beispielen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Kommunikation (inklusive allgemeiner und interkultureller Kommunikation sowie Störungsanfälligkeit), Kultur und Sprache (Definition von Kultur, Interkulturelle Kompetenz, Rich Points, Interkulturelle Erziehung), didaktische Konzepte interkulturellen Lernens, eine Zusammenfassung und ein Quellenverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind allgemeine und interkulturelle Kommunikation, die Störungsanfälligkeit interkultureller Kommunikation, die Interaktion von Sprache und Kultur, didaktische Konzepte interkulturellen Lernens und kulturelle Einflussfaktoren auf die Kommunikation. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bewältigung interkultureller Kommunikationsstörungen und der Förderung interkultureller Kompetenzen in der Jugendarbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kommunikation (mit Unterkapiteln zu allgemeiner Kommunikation, interkultureller Kommunikation und Störungsanfälligkeit), Kultur und Sprache (mit Unterkapiteln zu Kulturdefinition, Interkulturalität, Interkultureller Kompetenz, Interaktion von Sprache und Kultur, Rich Points und Interkultureller Erziehung), Didaktische Konzepte Interkulturellen Lernens und interkultureller Kommunikation (mit Unterkapiteln zu Antirassistischer Erziehung, Ethnischer Spurensuche, Lernen für Europa, Sprachlicher Allgemeinbildung und Globalem Lernen), Zusammenfassung und Quellenverzeichnis.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Kapitel?
Die Einleitung führt in das Thema ein. Das Kapitel "Kommunikation" definiert den Begriff und beleuchtet interkulturelle Kommunikation und deren Störungsanfälligkeit. Das Kapitel "Kultur und Sprache" untersucht den Zusammenhang beider Bereiche und die Rolle interkultureller Kompetenz. Das Kapitel zu didaktischen Konzepten stellt verschiedene Ansätze zur Förderung interkulturellen Lernens vor. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kommunikation, Kommunikationsstörungen, interkulturelle Kompetenz, Kultur, Sprache, Didaktik, Jugendarbeit, nonverbale Kommunikation, Kulturmodelle, Globalisierung, Pluralisierung.
Wie wird die Problematik interkultureller Kommunikationsstörungen dargestellt?
Die Arbeit zeigt auf, welche Faktoren zu Störungen in der interkulturellen Kommunikation führen können, beispielsweise Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation (Blickkontakt, Körpersprache, räumliche Distanz) und kulturelle Missverständnisse. Ein Beispiel einer Lehrersituation mit einer türkischen Schülerin verdeutlicht die Problematik.
Welche didaktischen Konzepte werden im Zusammenhang mit interkulturellem Lernen vorgestellt?
Die Arbeit behandelt verschiedene didaktische Konzepte, wie Antirassistische Erziehung, Ethnische Spurensuche, Lernen für Europa, Sprachliche und kulturelle Allgemeinbildung und Globales Lernen. Diese Konzepte sollen die Förderung interkultureller Kompetenz in der Jugendarbeit unterstützen.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Studierende der Pädagogik, Sozialwissenschaften und verwandter Fächer, die sich mit interkultureller Kommunikation und Jugendarbeit befassen. Sie ist auch für Praktiker*innen in der Jugendarbeit von Interesse, die ihr Wissen über interkulturelle Kommunikation erweitern möchten.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Selzer (Autor:in), 2015, Interkulturelle Kommunikation. Ursachen für Störungen im interkulturellen Kommunikationsprozess und methodische Ansätze zur Behebung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298242