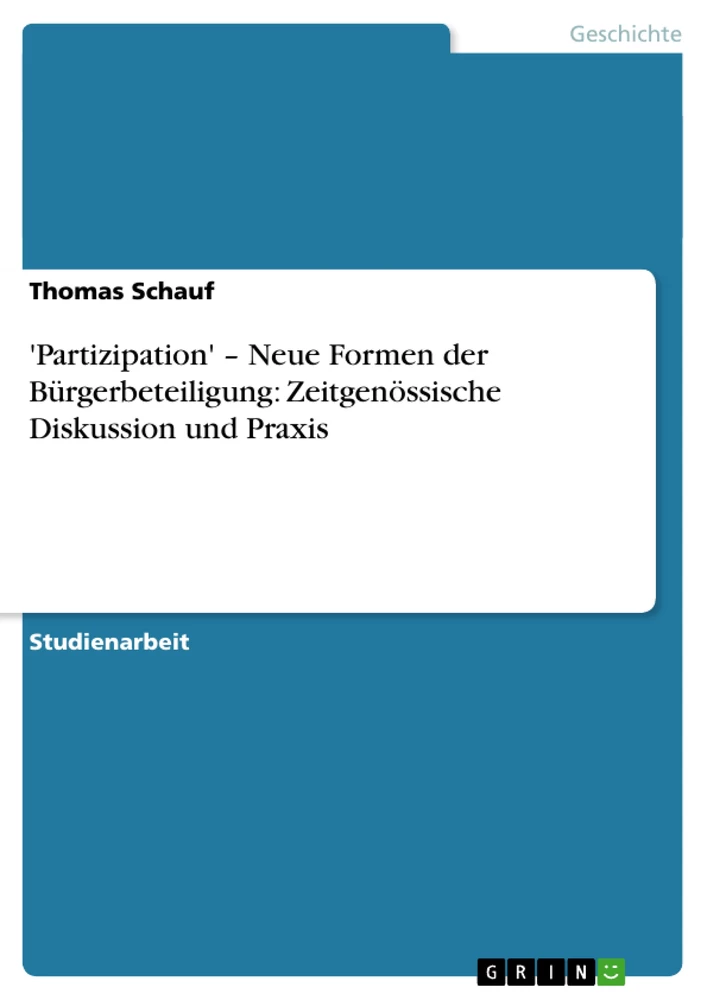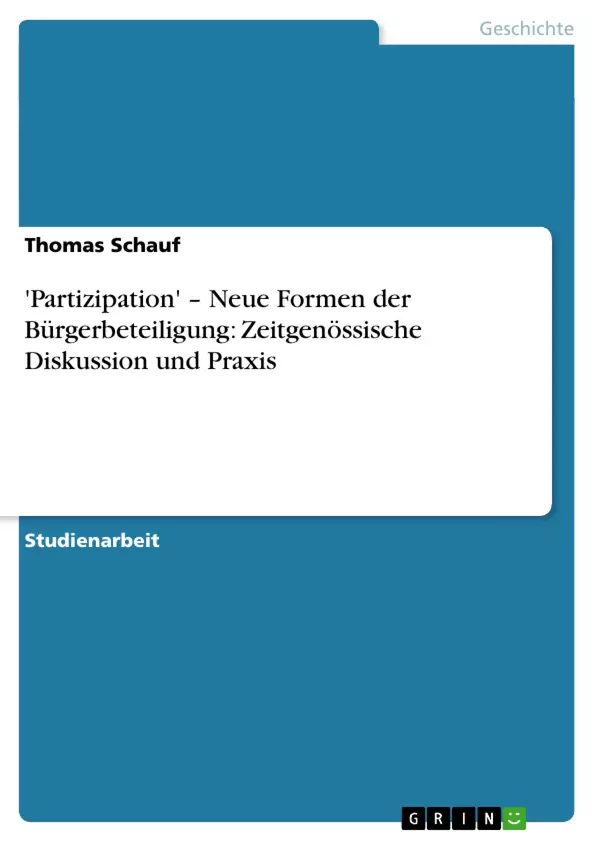Eine aktuelle politische Debatte bezieht sich auf die Einrichtung neuer Formen der Bürgerbeteiligung. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie man mit diesen neuen Formen „die Qualität und Akzeptanz kommunalpolitischen Handelns verbessern“1 kann. Bekannte Stichworte und mögliche Verfahren dieser Debatte sind vor allem städtische Leitbilder und lokale Agenda 21-Prozesse. An der aktuellen Diskussion ist auffällig, dass sie nicht von den Bürgern geführt wird, sondern von den politischen Entscheidungsträgern. Erkennbar wird dies vor allem daran, dass die Diskussionsführer anstreben die neuen Beteiligungsformen in das bestehende Institutionengefüge einzuordnen.2 Es wird versucht mit diesen neuen Diskussionen auf die zunehmende Politikverdrossenheit zu reagieren.
Die Entwicklung neuer Beteiligungsformen in den 1950er und vor allem 60er Jahren stand auch in einem engen Zusammenhang mit einer wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Leistungen des politischen Systems und den verstärkten Partizipationsforderungen, denen Politik und Administration nur unzureichend Rechnung trugen. Hinzu kam eine wachsende Sensibilität für neue Politikfelder, derer sich die etablierten Repräsentationsorgane zunächst nur zögernd angenommen haben.
Einleitend muss zunächst geklärt werden, was unter Partizipation zu verstehen ist. Im Bereich der politischen Partizipation lässt sich zwischen einem instrumentellen und normativen Verständnis unterscheiden. Bei ersterem wird die Teilhabe als Mittel zum Zweck, als Mittel zur Interessensdurchsetzung betrachtet. Partizipation ist damit eindeutig konfliktorientiert. Im normativen Verständnis, welches konsensorientiert ist, geht es auch „um Selbstverwirklichung im Prozeß des direktdemokratischen Zusammenhandelns“3.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ENTSTEHUNG NEUER PARTIZIPATIONSFORMEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- Historischer Kontext
- Die zeitgenössische Diskussion unter dem Stichwort „Mehr Demokratie wagen“
- Die empirische Dimension - Wie sehen die neuen Formen der Bürgerbeteiligung aus?
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung neuer Formen der Bürgerbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland der 1960er Jahre. Sie analysiert die zeitgenössische Diskussion um „Mehr Demokratie wagen“ und betrachtet die empirische Dimension der neuen Partizipationsformen. Ziel ist es, die Ursachen für die Entstehung dieser Formen zu beleuchten und die verschiedenen Beteiligungsformen im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der 1960er Jahre zu analysieren.
- Der historische Kontext der Entstehung neuer Partizipationsformen
- Die zeitgenössische Debatte um „Mehr Demokratie wagen“ und ihre Motivationen
- Die empirische Dimension der neuen Partizipationsformen
- Die Unterscheidung zwischen Protestbewegungen und institutionalisierten Beteiligungsformen
- Die Nachhaltigkeit und Abgrenzung der verschiedenen neuen Partizipationsformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den aktuellen Bezug der Debatte über neue Formen der Bürgerbeteiligung und grenzt den historischen Kontext der 1960er Jahre ab. Sie definiert den Begriff „Partizipation“ und stellt verschiedene Formen der politischen Teilhabe vor.
Das Kapitel „Entstehung neuer Partizipationsformen in der Bundesrepublik Deutschland“ beginnt mit einer Analyse des historischen Kontextes und der strukturellen Weichenstellungen der Nachkriegsentwicklung. Es befasst sich mit der Diskussion um „Mehr Demokratie wagen“ und untersucht die Motive, Inhalte und die Verbreitung dieser Debatte in der Gesellschaft. Im Anschluss beleuchtet es die empirische Dimension der neuen Partizipationsformen und stellt verschiedene Beispiele und ihre Nachhaltigkeit dar.
Das abschließende Fazit fasst die Hauptaussagen zusammen und bewertet die neuen Methoden der politischen Partizipation. Es skizziert außerdem einen Ausblick auf heutige Partizipationsforderungen.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Bürgerbeteiligung, Mehr Demokratie wagen, Protestbewegungen, Studentenbewegung, Außerparlamentarische Opposition (APO), Institutionalisierung, Repräsentation, Demokratiedefizite, Politiksystem, Gesellschaftlicher Wandel, Bundesrepublik Deutschland, 1960er Jahre.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet 'Mehr Demokratie wagen' historisch?
Es war das Motto der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt Ende der 1960er Jahre, das auf eine stärkere Einbindung der Bürger in politische Prozesse zielte.
Was ist der Unterschied zwischen instrumenteller und normativer Partizipation?
Instrumentelle Partizipation sieht Teilhabe als Mittel zur Interessenvertretung (konfliktorientiert), während normative Partizipation auf Selbstverwirklichung und Konsens abzielt.
Warum entstanden in den 1960ern neue Beteiligungsformen?
Ursachen waren die wachsende Unzufriedenheit mit dem politischen System, neue Politikfelder (Umwelt, Bildung) und die Forderungen der Studentenbewegung (APO).
Was sind Beispiele für institutionalisierte Bürgerbeteiligung?
Dazu gehören städtische Leitbilder, lokale Agenda 21-Prozesse und Bürgerbegehren, die versuchen, Bürgerwünsche in das bestehende Institutionengefüge zu integrieren.
Wie reagiert die Politik heute auf Politikverdrossenheit?
Politische Entscheidungsträger versuchen oft, durch neue Dialogformate die Akzeptanz kommunalpolitischen Handelns zu erhöhen und Bürger wieder aktiver einzubinden.
- Quote paper
- Thomas Schauf (Author), 2003, 'Partizipation' – Neue Formen der Bürgerbeteiligung: Zeitgenössische Diskussion und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29827