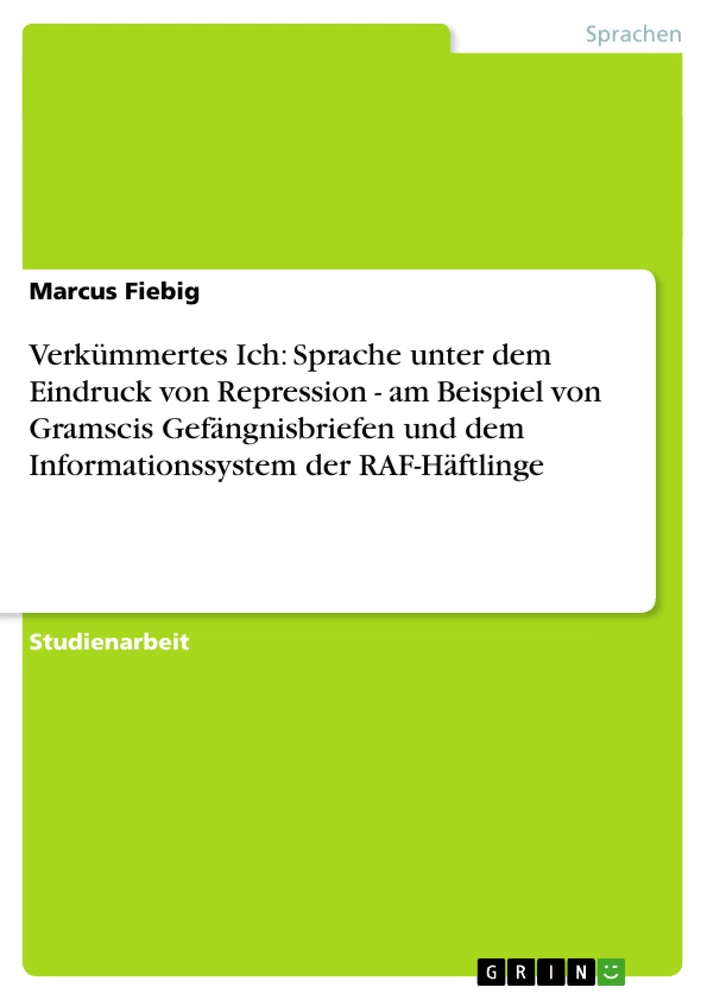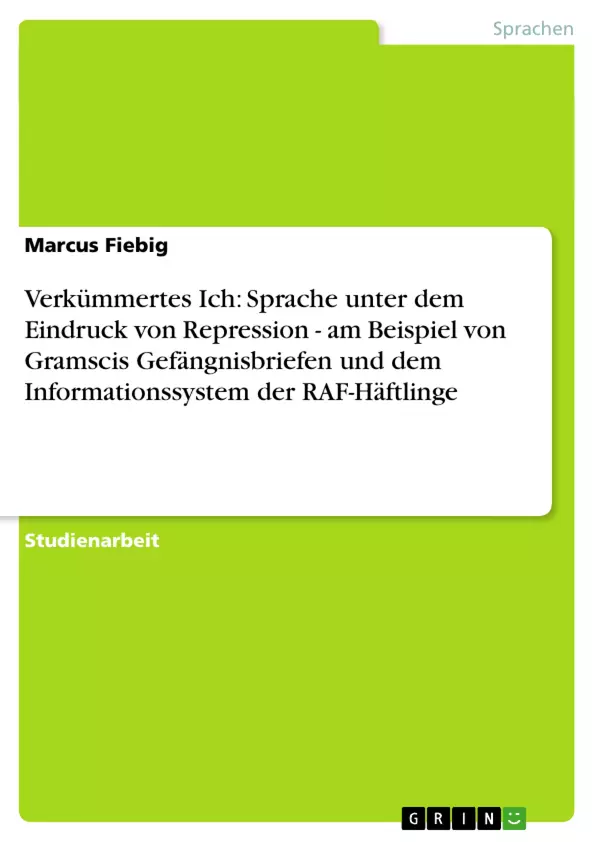Wie verändert sich Sprache und damit Denken unter extremer Repression eines Daseins in Gefangenschaft? Das ist die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit. Wo sind die strukturellen Gemeinsamkeiten bzw. die Unterschiede zwischen den Gefängnisbriefen Gramscis und dem info-System der RAF? Wie verhärtet sich Sprache in der außergewöhnlichen Situation des Eingesperrtseins? Wie militant kann sie sein? Trotz der enormen historischen Differenz ist den beiden Kommunikationssituationen der Moment der Repression und der ihrer sprachlichen Folgen eigen. Das “verkümmerte Ich” tritt dabei immer offener zu Tage. Gramsci sitzt bis 1934 ein und stirbt schließlich im Jahre 1937. Seit Anfang der 1970er sitzen viele RAF-Mitglieder in der BRD in Haft. 1977 stirbt die Kommandoebene um Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin in Stuttgart-Stammheim. Die Kommunikation innerhalb des Freiheitsentzug (RAF) und die Kommunikation nach draußen (Gramsci) bilden, so die These dieser Arbeit, Ablagerungen linguistische Sedimente der Repression ab.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 2. Koordinaten des Spagats
- 3. Der Sprachstil der Disziplinierung
- 3.1. Wurzeln der Disziplinierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Repression auf die Sprache, anhand der Gefängnisbriefe von Antonio Gramsci und dem Info-System der RAF-Häftlinge. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der linguistischen Reaktion auf Repression in unterschiedlichen historischen und politischen Kontexten aufzuzeigen.
- Der Einfluss von Repression auf die Sprache und das Ich
- Unterschiede in der Kommunikationssituation von Gramsci und der RAF
- Der Sprachstil der Disziplinierung und seine Wurzeln
- Die Rolle der Isolationshaft und sensorischen Deprivation
- Die Verbindung von Sprache und Denken in der Unfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG
Der Text stellt die These auf, dass Repression in Gefangenschaft spürbare Spuren in der Sprache der Inhaftierten hinterlässt. Er setzt sich zum Ziel, die linguistischen Folgen von Repression sowohl im Falle Gramscis während der faschistischen Diktatur in Italien als auch bei den RAF-Häftlingen in der BRD zu untersuchen.
2. Koordinaten des Spagats
Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Lebensumstände und politischen Kontexte von Gramsci und der RAF. Es wird deutlich, dass beide Gruppen trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen unter dem Druck der Repression litten. Der Text stellt heraus, dass die Kommunikationssituation sowohl bei Gramsci als auch bei der RAF durch die Repression geprägt war und zu einer Veränderung der Sprache führte.
3. Der Sprachstil der Disziplinierung
Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Repression auf die Sprache. Es wird gezeigt, dass die sprachliche Disziplinierung, obwohl unterschiedlich in ihrer Manifestation, ein gemeinsames Phänomen ist, das bei Gramsci und der RAF zu beobachten ist. Der Text konzentriert sich auf die Wurzeln dieser Disziplinierung und die Auswirkungen auf die Sprache und das Denken in Unfreiheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Repression, Sprache, Gefängnis, Kommunikation, Gramsci, RAF, Isolationshaft, sensorische Deprivation, Sprachstil, Disziplinierung, Unfreiheit und Denken.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert extreme Repression die Sprache?
Repression führt zu einer „Verhärtung“ der Sprache und hinterlässt linguistische Sedimente, die ein „verkümmertes Ich“ offenbaren.
Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Gramsci und der RAF?
Beide erlebten extreme Isolation in Gefangenschaft, was sich in einem spezifischen „Sprachstil der Disziplinierung“ niederschlug.
Was unterscheidet die Gefängnisbriefe Gramscis vom Info-System der RAF?
Gramsci kommunizierte primär nach draußen, während das Info-System der RAF der internen Kommunikation unter Bedingungen der Isolation diente.
Welchen Einfluss hat Isolationshaft auf das Denken?
Die Arbeit untersucht, wie sensorische Deprivation und Unfreiheit die Verbindung zwischen Sprache und Denken radikal verändern.
Was bedeutet der Begriff „militante Sprache“ in diesem Kontext?
Es wird analysiert, wie sich Sprache in außergewöhnlichen Situationen des Eingesperrtseins radikalisiert und als Werkzeug des Widerstands genutzt wird.
- Quote paper
- Marcus Fiebig (Author), 2003, Verkümmertes Ich: Sprache unter dem Eindruck von Repression - am Beispiel von Gramscis Gefängnisbriefen und dem Informationssystem der RAF-Häftlinge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29834