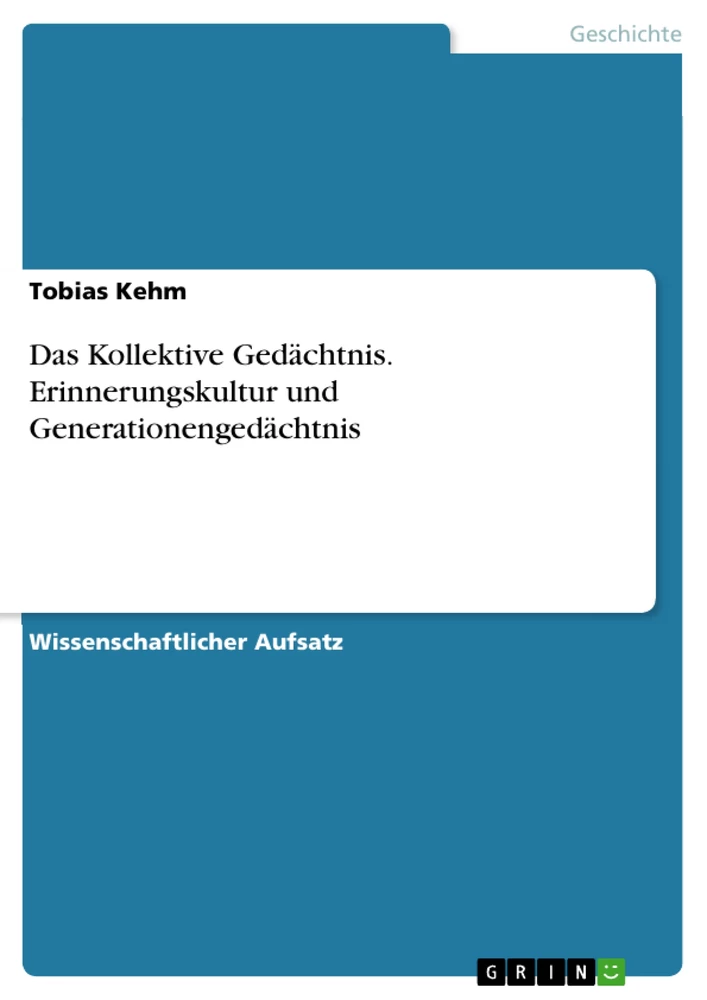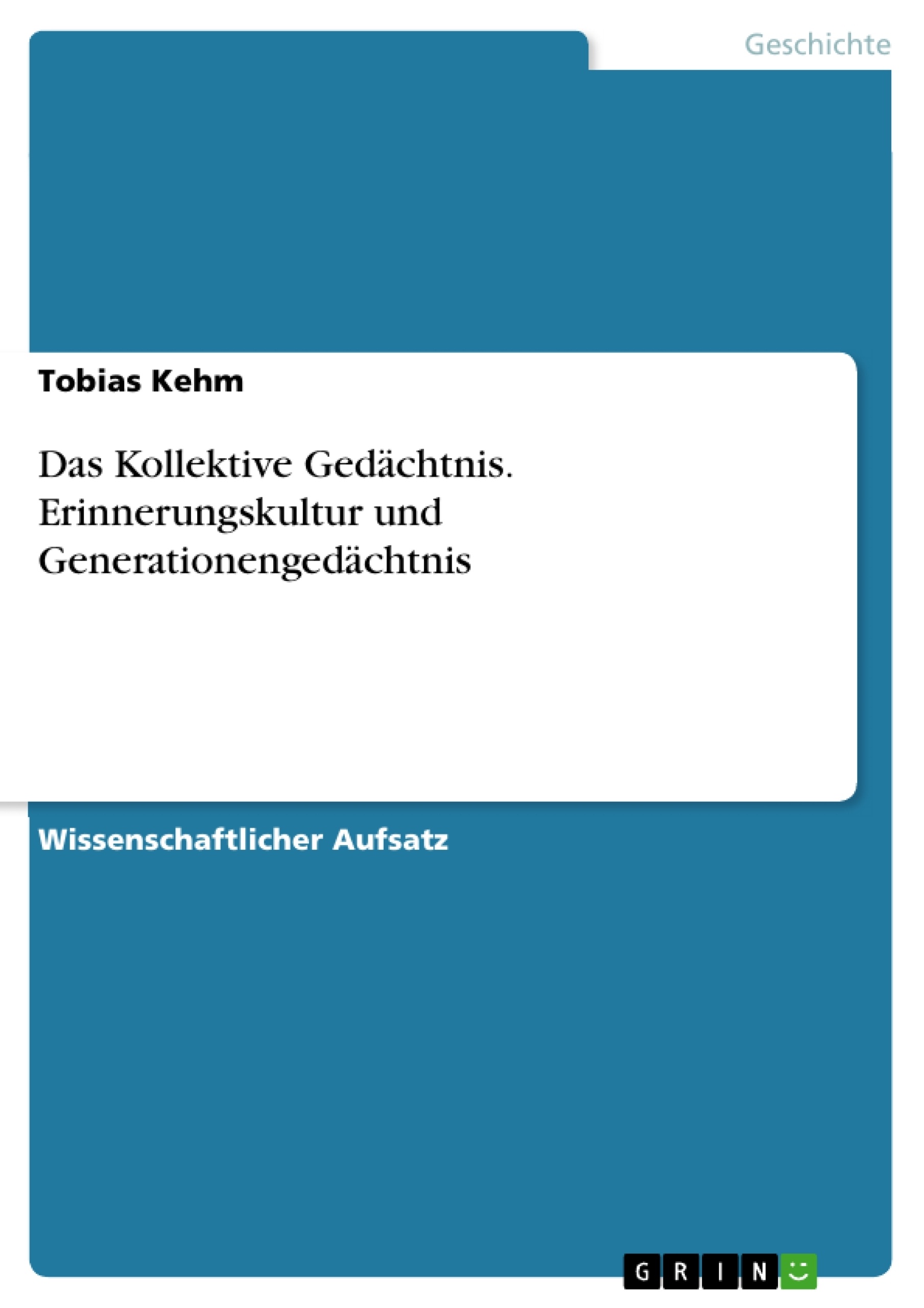Woher stammt das Wissen, dessen wir uns alltäglich bedienen? Wie entstehen die Bilder, welche wir von Ereignissen im Kopf haben, die wir selbst gar nicht erlebt haben? Was bringen uns solche Erinnerungen und wo liegen Gefahren in dieser Art der Tradierung? Gibt es aktuelle Bezüge, die in heutiger Zeit das „Dasein“ und „Wirken“ eines kollektiven Gedächtnisses zeigen?
Die Argumentation wird maßgeblich auf Texte von Astrid Erll bezogen, ihre Darlegung wird jedoch nicht nur mit verschiedenen Historikern verglichen, sondern auch durch andere Fachwissenschaften ergänzt.
Behandelte Themen sind des Weiteren: Sonderforschungsbereich 434 ("Erinnerungskulturen“ und „Pluralität des Erinnerns“); Jacque LeGoff (Erinnerung als Rohstoff der Geschichte); Familiengedächtnis, Modell des sozialen Rahmens; drei Ebenen der Erinnerungskultur; Konzepte/Erscheinungsformen des Erinnerns: Memoria, invented tradition und Archiv,Oral History und Generationengedächtnis: „kommunikatives Gedächtnis“; Zygmund Baumann: „Social Memory Studies“ und „moralische Verantwortung“; die Zusammensetzung des kollektiven Gedächtnisses/ Wie kann man das System beschreiben?; Warum ist es wichtig fachbereichsübergreifend zu forschen?; Aktuelle Bezüge - Die BRD im Ausland: Warum wir mit „Altlasten“ leben müssen; Kann es in einem Kollektiv eine „wahre“ Vorstellung über den Verlauf der Geschichte geben?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Heranführung an die Thematik
- Sonderforschungsbereich 434: „Erinnerungskulturen“ und „Pluralität des Erinnerns“
- Jacque LeGoff : Erinnerung als Rohstoff der Geschichte
- Familiengedächtnis, Modell des sozialen Rahmens
- Die drei Ebenen der Erinnerungskultur
- Rahmenbedingungen des Erinnerns
- Erinnerungshoheit
- Erinnerungstechniken
- Erinnerungsinteresse
- Äußerungsformen und Inszenierungsweisen des „Erinnerungsgeschehens“
- Konzepte/Erscheinungsformen des Erinnerns: Memoria, invented tradition und Archiv
- Oral History und Generationengedächtnis: „kommunikatives Gedächtnis“
- Zygmund Baumann: „Social Memory Studies“ und „moralische Verantwortung“
- Zusammensetzung des kollektiven Gedächtnisses/ Wie kann man das System beschreiben?
- Warum ist es wichtig fachbereichsübergreifend zu forschen?
- Aktuelle Bezüge - Die BRD im Ausland: Warum wir mit „Altlasten“ leben müssen
- Offene Fragen und Fazit – kann es in einem Kollektiv eine „wahre“ Vorstellung über den Verlauf der Geschichte geben?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des „kollektiven Sich-Erinnerns“ in einer Gesellschaft. Sie untersucht die Entstehung von Wissen und Bildern über Ereignisse, die man selbst nicht erlebt hat, die Auswirkungen dieser Erinnerungen und mögliche Gefahren der Tradierung. Zudem werden aktuelle Bezüge zur Existenz und Wirkung eines kollektiven Gedächtnisses in der heutigen Zeit beleuchtet.
- Die Entstehung und Funktionsweise des kollektiven Gedächtnisses
- Die Rolle von Erinnerungskulturen in der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Oral History und Generationengedächtnis
- Die Herausforderungen und Gefahren der Tradierung von Erinnerungen
- Aktuelle Bezüge des kollektiven Gedächtnisses in der BRD
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der Text analysiert verschiedene Aspekte des kollektiven Gedächtnisses, beginnend mit der Frage nach dem Ursprung unseres Wissens und der Entstehung von Bildern vergangener Ereignisse. Es werden unterschiedliche Forschungskonzepte vorgestellt, wie zum Beispiel der Sonderforschungsbereich 434, der sich mit „Erinnerungskulturen“ beschäftigt und die „Pluralität des Erinnerns“ untersucht. Jacque LeGoff beschreibt Erinnerung als „Rohstoff“ der Geschichte, der vom Historiker verarbeitet und zu Wissen gemacht werden muss.
Der Text beleuchtet anschließend die Rolle des Familiengedächtnisses und die drei Ebenen der Erinnerungskultur. Er erklärt, dass jede Gesellschaft eigene Erinnerungstechniken und -interessen entwickelt und wie sich die Äußerungsformen des „Erinnerungsgeschehens“ gestalten. Es werden verschiedene Konzepte des Gedenkens vorgestellt, wie Memoria, invented tradition und Archiv.
Der Text untersucht anschließend den Einfluss von Oral History und Generationengedächtnis auf das kollektive Gedächtnis. Es wird erläutert, wie die Oral History durch die Befragung von Zeitzeugen ein tieferes Verständnis des Lebens der „normalen“ Bürger in der Vergangenheit ermöglicht und welche Rolle das Familien- und Generationengedächtnis in der Tradierung von Wissen spielen.
Weiterhin wird das Konzept der „Social Memory Studies“ von Zygmund Baumann vorgestellt, das eine soziologische Theorie der „moralischen Verantwortung“ entwickelt und den Holocaust als Ergebnis des Zivilisationsprozesses untersucht.
Der Text schließt mit einer Analyse der Zusammensetzung des kollektiven Gedächtnisses und der Bedeutung fachbereichsübergreifender Forschung. Es werden die verschiedenen Ebenen des Gedächtnisses und die Rolle der Kommunikation in der Entstehung von „Semantiken“ erläutert. Schließlich werden die aktuellen Bezüge des kollektiven Gedächtnisses auf die BRD im Ausland beleuchtet und die Problematik des „deutschen Images“ in der Euro-Krise diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kollektives Gedächtnis, Erinnerungskulturen, Oral History, Generationengedächtnis, Memoria, invented tradition, Archiv, „Social Memory Studies“, moralische Verantwortung, Transgenerationelle Weitergabe von Traumata, Deutschland-Image, Euro-Krise.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „kollektiven Gedächtnis“?
Es ist das gemeinsame Wissen und die Erinnerungen einer Gesellschaft an Ereignisse, die oft nicht selbst erlebt wurden, aber die Identität der Gruppe prägen.
Welche Rolle spielt Astrid Erll in der Gedächtnisforschung?
Astrid Erll liefert maßgebliche Texte zur Definition von Erinnerungskulturen und zur Funktionsweise des kollektiven Sich-Erinnerns.
Was ist der Unterschied zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis?
Das kommunikative Gedächtnis basiert auf Oral History und Zeitzeugen (ca. 80-100 Jahre), während das kulturelle Gedächtnis durch Archive und Monumente über Jahrhunderte tradiert wird.
Welche Gefahren birgt die Tradierung von Erinnerungen?
Es besteht die Gefahr der Mythenbildung, der einseitigen Darstellung der Geschichte oder der transgenerationalen Weitergabe von Traumata.
Wie beeinflussen „Altlasten“ das Image der BRD im Ausland?
Die Arbeit untersucht, wie historische Ereignisse (z.B. der Holocaust) das heutige Bild Deutschlands in internationalen Krisen, wie der Euro-Krise, beeinflussen.
Was bedeutet „Erinnerung als Rohstoff der Geschichte“ laut Jacque LeGoff?
Erinnerung ist das Ausgangsmaterial, das von Historikern verarbeitet werden muss, um wissenschaftliches historisches Wissen zu generieren.
- Quote paper
- Tobias Kehm (Author), 2012, Das Kollektive Gedächtnis. Erinnerungskultur und Generationengedächtnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298364