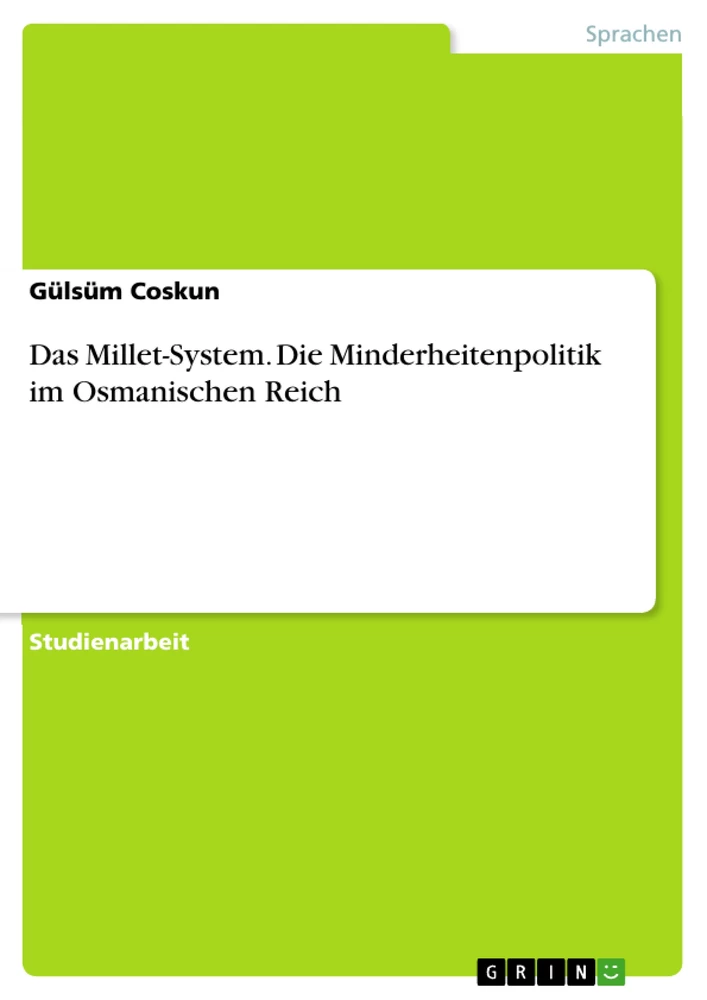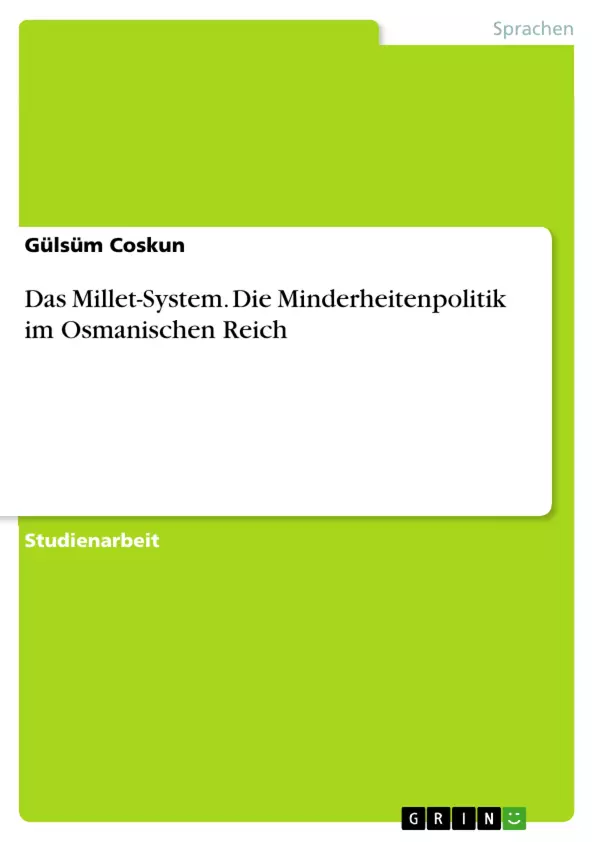Das Osmanische Reich fand seinen Ursprung im Osmanischen
Fürstentum (Osmanl Beylii), dass ca. 1299 gegründet wurde. Das an
dem byzantinischen Reich angrenzende Beylik regierte von der Gründung
an nach dem islamischen Rechtssystem.
Mit zunehmender Zeit nahm das Fürstentum immer mehr Gebiete ein und
wuchs schnell zu einem großen Reich heran und erstreckte sich von
Marokko bis Persien und von der Ukraine bis zum Sudan. Daher war das
Reich während seines 623 jährigen Bestandes von Nationen- und
Glaubensvielfalt geprägt.
Der Umgang der Osmanen mit der nichtmuslimischen Bevölkerung nimmt
in der gesamten Weltgeschichte eine besondere Stellung ein.
Im Gegensatz zu der damals üblichen Vorgehensweise, der Bevölkerung
der eingenommen Gebiete die Konfession aufzuzwingen, herrschte im
Osmanischen Reich die Glaubensfreiheit.
So blieb den Nichtmuslimen die Entscheidung, entweder den islamischen
Glauben anzunehmen oder unter bestimmten Voraussetzungen (u.a.
Zahlung bestimmter Steuern) unter islamischer Herrschaft mit zum Teil
eingeschränkten Freiheiten weiterzuleben.
Die Minderheitenpolitik unterlag in der gesamten Regierungszeit der
Osmanen vielen Veränderungen. Doch die längste Phase, die ohne
bedeutende Veränderungen verlief, das heißt zwischen dem Ende des
13. Jahrhunderts und den Anfängen des 18. Jahrhunderts, in der die
gegenseitige Toleranz und Akzeptanz der so verschiedenen
Bevölkerungsgruppen zum Vorschein kam, fällt in der Literatur
unzureichend aus. Das nahezu 450 Jahre lang erfolgreich durchgesetzte
System wurde nach Einfluss der europäischen Mächte und dem Modernisierungs- und Anpassungsversuch der Osmanen wiederum gegen
das Reich verwendet und musste aufgelöst werden.
Im Folgenden werde ich zunächst versuchen die allgemeine Problematik
darzulegen, indem ich näher auf die damals im Osmanischen Reich
vorhandene Situation bezüglich der Minderheiten und den Umgang der
Regierung mit dieser eingehen werde. Weiterhin werde ich beschreiben,
wie es der Regierung möglich war, das friedliche Nebeneinander und zum
Teil auch Miteinander im Reich zu gewährleisten.
Anschließend werde ich auf die zustande gekommenen Probleme, dessen
Hintergründe und schließlich auf die getroffenen Maßnahmen der
Regierung eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Minderheitenproblematik im Osmanischen Reich
- 2. Das Millet-System
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Minderheitenpolitik des Osmanischen Reiches, insbesondere das Millet-System. Ziel ist es, die Mechanismen dieses Systems zu beschreiben, seine Erfolge und Herausforderungen aufzuzeigen und den Umgang des Reiches mit religiösen und ethnischen Minderheiten zu analysieren.
- Das islamische Rechtssystem und seine Anwendung auf Nichtmuslime
- Das Millet-System als Instrument der Minderheitenverwaltung
- Die Rolle der Glaubensgemeinschaften und ihrer Oberhäupter
- Das friedliche Zusammenleben verschiedener Gruppen im Osmanischen Reich
- Herausforderungen und Veränderungen des Millet-Systems
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung stellt das Osmanische Reich und seine lange Geschichte der multireligiösen und multiethnischen Gesellschaft vor. Sie hebt die besondere Stellung des osmanischen Umgangs mit nichtmuslimischen Bevölkerungsgruppen hervor, insbesondere die Gewährung von Religionsfreiheit unter bestimmten Bedingungen. Die Einleitung skizziert den Fokus der Arbeit auf die Minderheitenpolitik, das friedliche Zusammenleben verschiedener Gruppen und die Herausforderungen, denen das System im Laufe der Zeit begegnete. Die lange Periode relativer Toleranz und Akzeptanz zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert wird als besonders relevant hervorgehoben, ebenso wie der spätere Einfluss europäischer Mächte und die Auflösung des Systems.
1. Die Minderheitenproblematik im Osmanischen Reich: Dieses Kapitel beschreibt die rechtliche Situation von Minderheiten im Osmanischen Reich. Es erläutert die Anwendung der Scharia auf Muslime und den zimmet hukuku für Nichtmuslime, wobei die Konfession, nicht die Ethnie, als entscheidendes Kriterium betont wird. Die Bildung von Glaubensgemeinschaften (Millets) wird als vorteilhaft für den Staat dargestellt, da dies eine indirekte Kontrolle ermöglichte, während gleichzeitig die kulturelle und religiöse Autonomie der Gruppen gewahrt blieb. Die cizye, eine Kopfsteuer für Nichtmuslime, wird als Ausnahme von diesem System der indirekten Kontrolle erwähnt. Das Kapitel erklärt den Begriff „millet“ und seine historische Entwicklung, unterstreicht, dass er nicht mit dem modernen Begriff „Nation“ gleichzusetzen ist.
2. Das Millet-System: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Millet-System, das in der Regierungszeit von Sultan Mehmed II. entstand und auf Prinzipien des islamischen Rechts aufbaut, jedoch eine einzigartige osmanische Weiterentwicklung darstellt. Es ermöglichte das friedliche Zusammenleben verschiedener Gruppen über Jahrhunderte, indem es die Bewahrung kultureller, religiöser und sprachlicher Unterschiede förderte. Das Kapitel beschreibt die vier anerkannten Millets (muslimisch, orthodox, armenisch, jüdisch) und die steigende Anzahl an Millets im Laufe der Zeit. Es erklärt die Rolle der Zimmis (Schutzgenossen) und Müstemenler (vorübergehende Bewohner) und betont, dass Nichtmuslime nicht zum Islam gezwungen wurden und einen gewissen Schutz ihrer Rechte und Besitztümer genossen. Das Kapitel erläutert die Selbstverwaltung der Millets in legislativen, judikativen, religiösen und erzieherischen Angelegenheiten unter der Aufsicht ihres Ethnarchen, der vom Staat anerkannt werden musste.
Schlüsselwörter
Osmanisches Reich, Minderheitenpolitik, Millet-System, Religionsfreiheit, Scharia, Zimmet Hukuku, Glaubensgemeinschaften, Zimmi, Cizye, Millet-i Rum, Millet-i Arman, Millet-i Yahud, friedliches Zusammenleben, Toleranz, europäischer Einfluss, Modernisierung.
Häufig gestellte Fragen: Minderheitenpolitik im Osmanischen Reich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Minderheitenpolitik des Osmanischen Reiches, mit besonderem Fokus auf das Millet-System. Sie beschreibt die Mechanismen des Systems, seine Erfolge und Herausforderungen und untersucht den Umgang des Reiches mit religiösen und ethnischen Minderheiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das islamische Rechtssystem und seine Anwendung auf Nichtmuslime, das Millet-System als Instrument der Minderheitenverwaltung, die Rolle der Glaubensgemeinschaften und ihrer Oberhäupter, das friedliche Zusammenleben verschiedener Gruppen im Osmanischen Reich und die Herausforderungen und Veränderungen des Millet-Systems im Laufe der Zeit.
Was ist das Millet-System?
Das Millet-System, entstanden unter Sultan Mehmed II., basiert auf Prinzipien des islamischen Rechts, stellt aber eine einzigartige osmanische Weiterentwicklung dar. Es ermöglichte das friedliche Zusammenleben verschiedener Gruppen über Jahrhunderte, indem es die Bewahrung kultureller, religiöser und sprachlicher Unterschiede förderte. Nichtmuslime wurden nicht zum Islam gezwungen und genossen einen gewissen Schutz ihrer Rechte und Besitztümer. Die Millets verwalteten sich in legislativen, judikativen, religiösen und erzieherischen Angelegenheiten selbst, unter der Aufsicht ihres vom Staat anerkannten Ethnarchen.
Welche Millets gab es?
Anfangs gab es vier anerkannte Millets: muslimisch, orthodox, armenisch und jüdisch. Im Laufe der Zeit stieg die Anzahl der Millets.
Wie wurde die Scharia angewendet?
Die Scharia galt für Muslime. Für Nichtmuslime galt der Zimmet Hukuku, wobei die Konfession, nicht die Ethnie, das entscheidende Kriterium war. Die Bildung von Glaubensgemeinschaften (Millets) ermöglichte dem Staat eine indirekte Kontrolle, während die kulturelle und religiöse Autonomie der Gruppen gewahrt blieb. Die Cizye, eine Kopfsteuer für Nichtmuslime, war eine Ausnahme von diesem System der indirekten Kontrolle.
Welche Rolle spielten die Glaubensgemeinschaften?
Die Glaubensgemeinschaften (Millets) hatten eine große Bedeutung im Osmanischen Reich. Sie genossen eine beträchtliche Autonomie in ihren internen Angelegenheiten und verwalteten sich selbst, unter Aufsicht ihrer Oberhäupter (Ethnarchen).
Wie lange dauerte die Periode relativer Toleranz?
Die Arbeit hebt eine lange Periode relativer Toleranz und Akzeptanz zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert hervor.
Welche Faktoren führten zu Veränderungen des Millet-Systems?
Der spätere Einfluss europäischer Mächte und die Modernisierungsprozesse trugen zur Auflösung des Millet-Systems bei.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Osmanisches Reich, Minderheitenpolitik, Millet-System, Religionsfreiheit, Scharia, Zimmet Hukuku, Glaubensgemeinschaften, Zimmi, Cizye, Millet-i Rum, Millet-i Arman, Millet-i Yahud, friedliches Zusammenleben, Toleranz, europäischer Einfluss, Modernisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur Minderheitenproblematik im Osmanischen Reich und zum Millet-System sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
- Arbeit zitieren
- Gülsüm Coskun (Autor:in), 2014, Das Millet-System. Die Minderheitenpolitik im Osmanischen Reich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298370