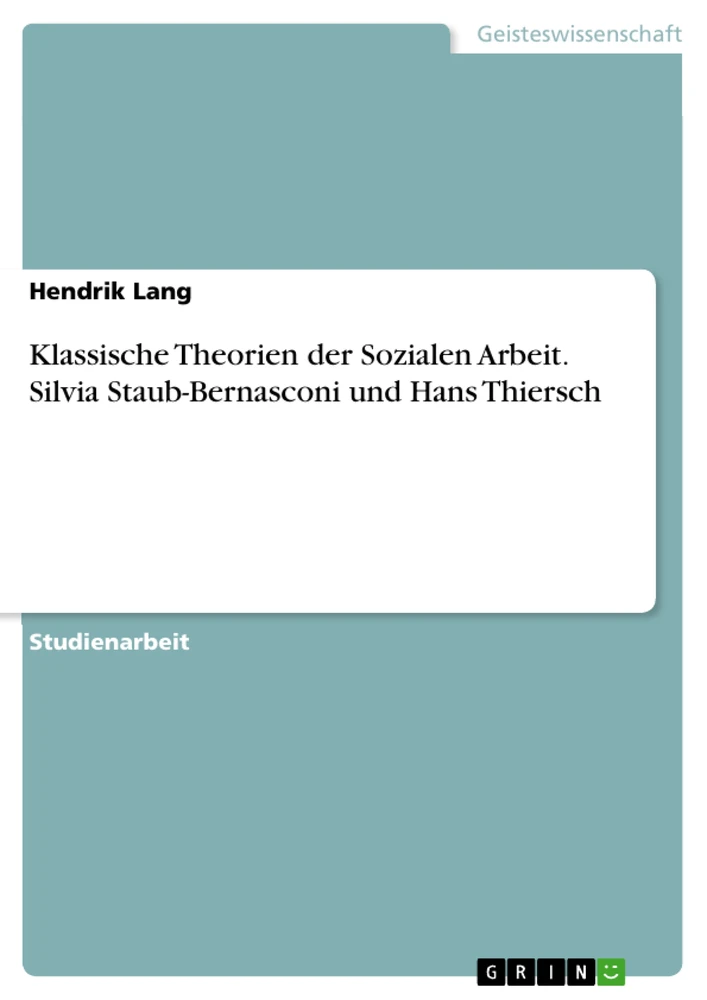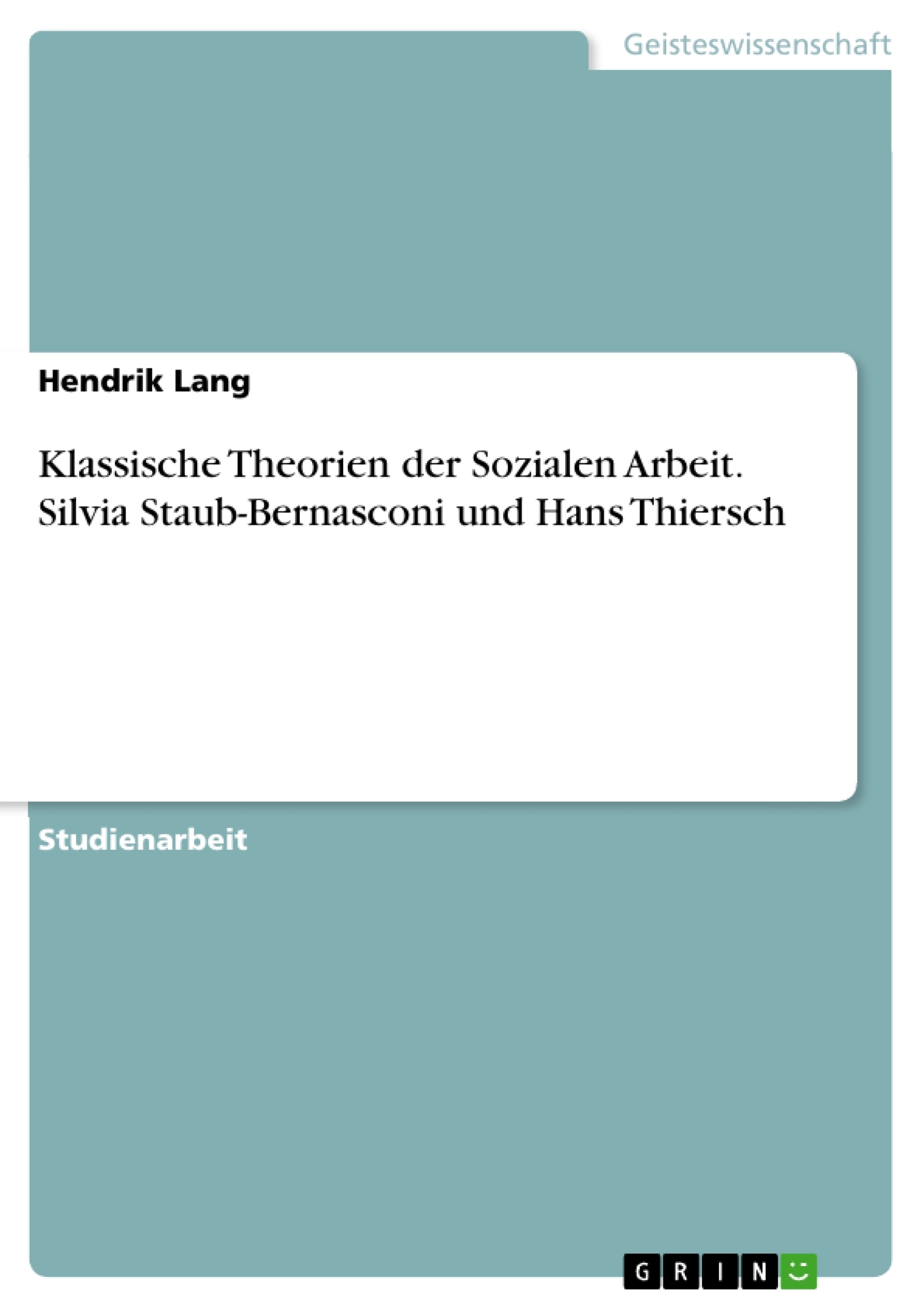In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit den Theorien zweier Klassiker der Sozialpädagogik beschäftigen und zeigen, wie sehr diese Theorien noch heute in der Sozialen Arbeit Anwendung finden. Ich habe mich für den Systemischen Theorieansatz von Silvia Staub-Bernasconi und die lebensweltorientierte Soziale Arbeit von Hans Thiersch entschieden, da ich der Meinung bin, dass dies zwei zeitlose Theorien sind, soziale Probleme, deren Entstehung und deren Lösung bzw. Minderung, zu beschreiben.
Ich habe meinen Schwerpunkt auf die Theorie und das Handlungsmodell von Silvia Staub-Bernasconi gelegt, da dieses für mich eine gute Basis liefert, wie man soziale Probleme angehen sollte. Es liefert Erklärungen, Deutungen und Lösungsschritte für soziale Probleme. Der Lebensweltorientierte Ansatz von Hans Thiersch ist dazu eine gute Ergänzung, da er die Bearbeitung der sozialen Probleme in dem Umfeld der KlientInnen behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Biographie Silvia Staub-Bernasconi
- 3 Biographie Hans Thiersch
- 4 Wissenschaftsverständnis von Staub-Bernasconi
- 5 Prozess und Systemtheorie
- 6 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- 7 Professionelles Sozialarbeiterisches Handeln
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch in der Sozialen Arbeit und deren heutige Relevanz. Der Fokus liegt auf der systemischen Theorie von Staub-Bernasconi und deren Anwendbarkeit auf soziale Probleme, ergänzt durch den lebensweltorientierten Ansatz von Thiersch. Die Arbeit beleuchtet die praktische Anwendbarkeit der Theorien.
- Systemischer Theorieansatz von Silvia Staub-Bernasconi
- Lebensweltorientierter Ansatz von Hans Thiersch
- Anwendbarkeit der Theorien in der Praxis der Sozialen Arbeit
- Analyse sozialer Probleme und Lösungsansätze
- Reflexion des gesellschaftlichen Standpunkts in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt die Auswahl der Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch als zentrales Thema. Die Arbeit zielt darauf ab, die Relevanz dieser Theorien für die heutige Soziale Arbeit aufzuzeigen und deren Anwendung bei der Analyse und Lösung sozialer Probleme zu beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf Staub-Bernasconis Theorie und Handlungsmodell als Grundlage für den Umgang mit sozialen Problemen, ergänzt durch Thierschs lebensweltorientierten Ansatz, welcher die Bearbeitung sozialer Probleme im Kontext der Lebenswelt der Klienten betont.
2 Biographie Silvia Staub-Bernasconi: Dieses Kapitel skizziert die Biografie von Silvia Staub-Bernasconi, ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Laufbahn in der Sozialen Arbeit und Wissenschaft. Es wird hervorgehoben, dass Staub-Bernasconi ihre praktische Erfahrung in der Jugendarbeit, insbesondere mit Straßenjugendlichen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, stets mit ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit verband. Ihr Engagement in der Frauenbewegung und in feministischen Projekten wird ebenfalls beleuchtet, sowie ihr Beitrag zur Etablierung der Sozialen Arbeit als eigenständige Profession mit spezifischen Methoden.
3 Biographie Hans Thiersch: Dieses Kapitel präsentiert die Biografie von Hans Thiersch, seine akademische Karriere und seinen Einfluss auf die Sozialpädagogik. Es unterstreicht seine Bedeutung für die Entwicklung und Verbreitung des Konzepts der Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit, seine zahlreichen Engagements in verschiedenen Institutionen der Jugendhilfe und sein Beitrag zur sozialpädagogischen Theorie und Praxis.
4 Wissenschaftsverständnis von Staub-Bernasconi: Das Kapitel beschreibt Staub-Bernasconis wissenschaftliches Verständnis von Sozialer Arbeit, die Notwendigkeit einer fundierten Theorie für die Praxis und die Abhängigkeit der Sozialen Arbeit von der wissenschaftlichen Reflexion des gesellschaftlichen Kontextes. Es stellt ihr fünfteiliges Wissensmodell (Gegenstandswissen, Erklärungswissen, Wert- oder Kriterienwissen, Verfahrenswissen) vor, welches als Grundlage für eine begründete Handlungstheorie dient. Jedes Wissenselement wird detailliert erläutert und seine Bedeutung für die Analyse und Lösung sozialer Probleme hervorgehoben.
5 Prozess und Systemtheorie: Dieses Kapitel erläutert Staub-Bernasconis prozessual-systemisches Paradigma in der Sozialen Arbeit. Es werden die Kernannahmen des Systemismus, Individualismus und Holismus gegenübergestellt und die Bedeutung des prozessualen Aspekts für das Verständnis gesellschaftlicher Dynamiken und individueller Bedürfnisbefriedigung hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem dynamischen Zusammenspiel von Individuen und Systemen, den sich daraus ergebenden Prozessen und der Rolle der Sozialen Arbeit bei der Bewältigung von Defiziten.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Silvia Staub-Bernasconi, Hans Thiersch, Systemtheorie, Lebensweltorientierung, Prozessualität, soziale Probleme, Handlungstheorie, Professionalisierung, Jugendarbeit, feministische Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Staub-Bernasconi & Thiersch in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch in der Sozialen Arbeit und deren heutige Relevanz. Der Fokus liegt auf der systemischen Theorie von Staub-Bernasconi und dem lebensweltorientierten Ansatz von Thiersch, sowie deren praktische Anwendbarkeit auf soziale Probleme.
Welche Theorien werden im Detail behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den systemischen Theorieansatz von Silvia Staub-Bernasconi, einschließlich ihres fünfteiligen Wissensmodells (Gegenstandswissen, Erklärungswissen, Wert- oder Kriterienwissen, Verfahrenswissen), und den lebensweltorientierten Ansatz von Hans Thiersch. Es wird die praktische Anwendbarkeit beider Theorien in der Sozialen Arbeit analysiert.
Wer sind Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch?
Die Hausarbeit beinhaltet biografische Skizzen beider Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler. Es wird Staub-Bernasconis praktische Erfahrung in der Jugendarbeit, ihr Engagement in der Frauenbewegung und ihr Beitrag zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit beleuchtet. Für Thiersch wird seine akademische Karriere und sein Einfluss auf die Entwicklung der Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit hervorgehoben.
Wie wird das Wissenschaftsverständnis von Staub-Bernasconi dargestellt?
Das Wissenschaftsverständnis von Staub-Bernasconi wird detailliert beschrieben, mit Betonung auf der Notwendigkeit einer fundierten Theorie für die Praxis und der Abhängigkeit der Sozialen Arbeit von der wissenschaftlichen Reflexion des gesellschaftlichen Kontextes. Ihr fünfteiliges Wissensmodell dient als Grundlage für eine begründete Handlungstheorie.
Welche Rolle spielen Prozess- und Systemtheorie in der Arbeit?
Die Hausarbeit erläutert Staub-Bernasconis prozessual-systemisches Paradigma. Kernannahmen des Systemismus, Individualismus und Holismus werden gegenübergestellt. Die Bedeutung des prozessualen Aspekts für das Verständnis gesellschaftlicher Dynamiken und individueller Bedürfnisbefriedigung wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Themen der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Soziale Arbeit, Silvia Staub-Bernasconi, Hans Thiersch, Systemtheorie, Lebensweltorientierung, Prozessualität, soziale Probleme, Handlungstheorie, Professionalisierung, Jugendarbeit, feministische Perspektiven.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist gegliedert in eine Einleitung, Kapitel zu den Biografien von Staub-Bernasconi und Thiersch, ein Kapitel zum Wissenschaftsverständnis von Staub-Bernasconi, ein Kapitel zu Prozess- und Systemtheorie, und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz beschrieben.
Welche praktischen Anwendungen der Theorien werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Anwendbarkeit der Theorien von Staub-Bernasconi und Thiersch auf soziale Probleme und Lösungsansätze in der Praxis der Sozialen Arbeit. Der Fokus liegt auf der Analyse sozialer Probleme und der Reflexion des gesellschaftlichen Standpunkts in der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Hendrik Lang (Author), 2013, Klassische Theorien der Sozialen Arbeit. Silvia Staub-Bernasconi und Hans Thiersch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298513