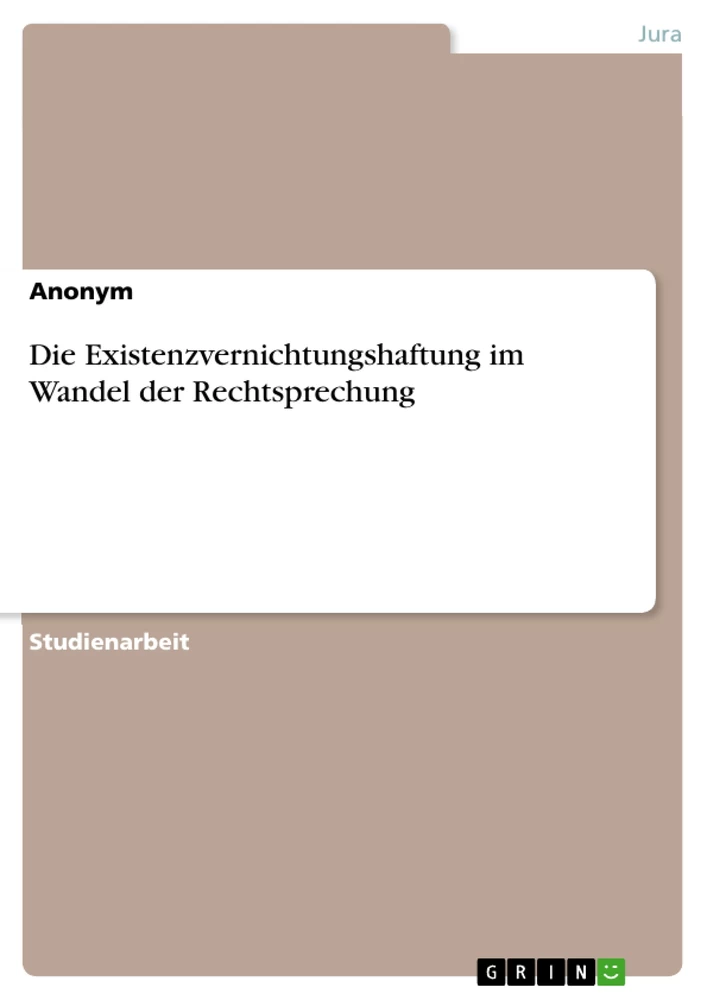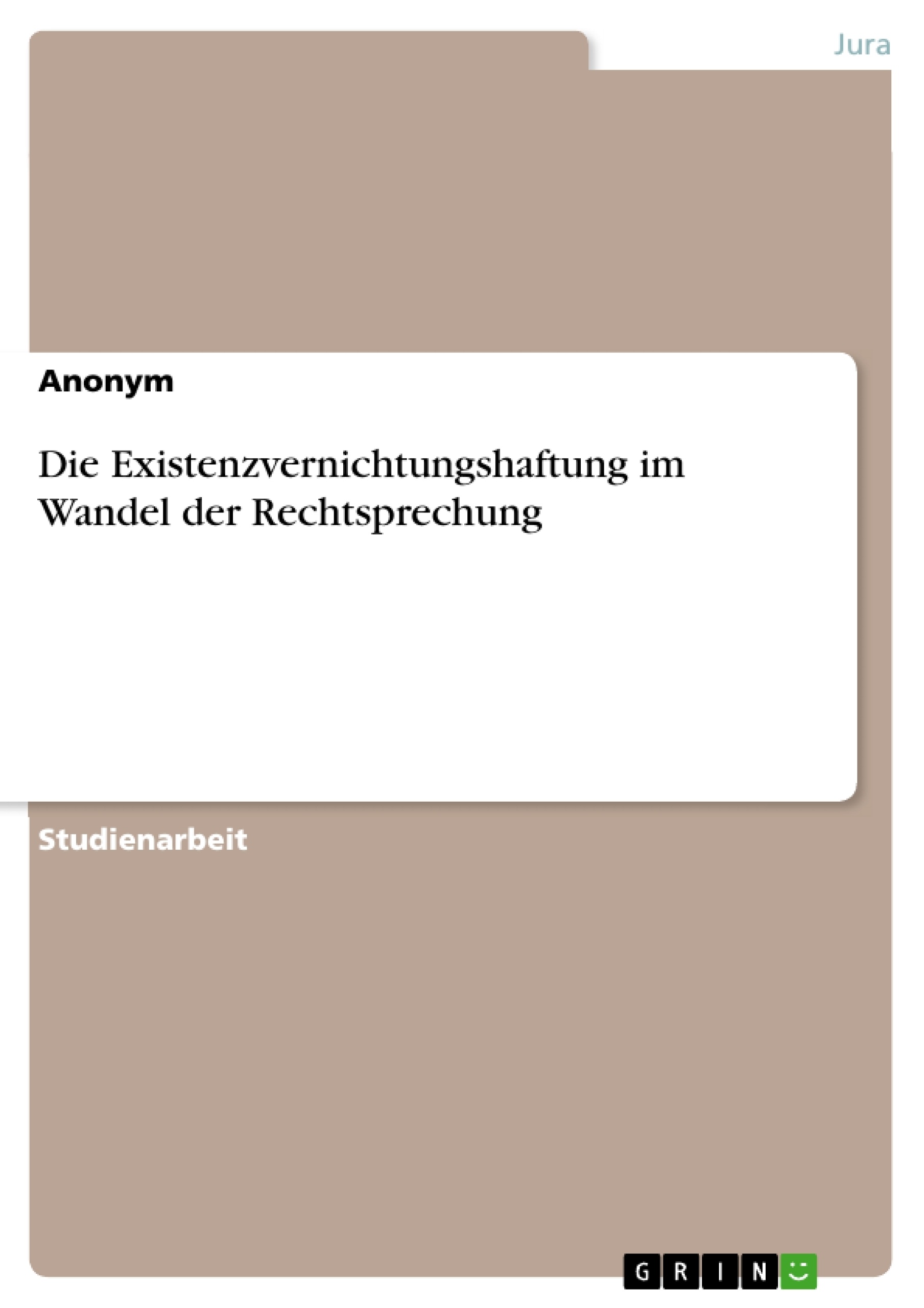Mehrere Meilensteine prägten die Existenzvernichtungshaftung als spezieller Tatbestand der Durchgriffshaftung in der Rechtsprechung. Erster Meilenstein ist das „Autokran“-Urteil von 1985, in welchem die Lehre vom qualifiziert faktischen Konzern vorausging. Eine weitere Wende erfolgte 2001 im „Bremer-Vulkan“-Urteil, in dem erstmals der Bundesgerichtshof die Existenzvernichtungshaftung als nicht-konzernrechtliche Haftungsfigur definierte. Die jüngste tragende Säule ist das „Trihotel“-Urteil 2007, in welchem erstmals von sittenwidriger, vorsätzlicher Schädigung nach § 826 BGB die Rede war. Dies implizierte nun gleichzeitig eine Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft.
Ziel dieser Seminararbeit ist, die Existenzvernichtungshaftung im Wandel der Rechtsprechung darzulegen und die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Tatbestand zu erläutern.
Hierzu werden zunächst die Begriffe „Durchgriffshaftung“ und „Existenzvernichtungshaftung“ erklärt und die einzelnen Meilensteine eingehend behandelt. Daraufhin folgen die Auswirkungen auf den Tatbestand. Abgerundet wird dies durch ein persönliches Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Allgemeine Begriffsbestimmungen
- I. Durchgriffshaftung
- II. Existenzvernichtungshaftung
- C. Verlauf der Existenzvernichtungshaftung
- I. Konzernhaftungstatbestand
- 1. Abgrenzung der Konzernarten
- 2. Das ,,Autokran“-Urteil 1985
- II. Allgemeiner objektiver Durchgriffshaftungstatbestand
- III. Sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB
- 1. Sittenwidrigkeit und Schädigungsvorsatz
- 2. Fall,,Trihotel“
- I. Konzernhaftungstatbestand
- D. Auswirkungen auf den Tatbestand
- I. Zusammenfassung
- II. Praxisfolgen
- III. Reaktionen in der Literatur
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Existenzvernichtungshaftung im Wandel der Rechtsprechung und analysiert die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Tatbestand der Durchgriffshaftung. Die Arbeit beleuchtet die zentralen Meilensteine der Rechtsprechung, die die Entwicklung der Existenzvernichtungshaftung prägten, insbesondere das „Autokran“-Urteil von 1985, das „Bremer-Vulkan“-Urteil von 2001 und das „Trihotel“-Urteil von 2007. Sie untersucht die verschiedenen Haftungsmodelle und ihre spezifischen Voraussetzungen, insbesondere die Unterkapitalisierung, den Missbrauch der Gesellschaftsform, die Vermögensvermischung und den existenzvernichtenden Eingriff. Darüber hinaus betrachtet die Arbeit die Auswirkungen der Rechtsprechung auf die Praxis und die Diskussion in der Literatur.
- Entwicklung der Existenzvernichtungshaftung in der Rechtsprechung
- Analyse der zentralen Meilensteine der Rechtsprechung
- Untersuchung der Voraussetzungen für die Durchgriffshaftung
- Auswirkungen der Rechtsprechung auf die Praxis
- Diskussion der relevanten Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Existenzvernichtungshaftung ein und stellt die zentralen Meilensteine der Rechtsprechung vor. Das Kapitel „Allgemeine Begriffsbestimmungen“ definiert die Begriffe Durchgriffshaftung und Existenzvernichtungshaftung und erläutert die verschiedenen Haftungsmodelle, die im Laufe der Rechtsprechung entwickelt wurden. Das Kapitel „Verlauf der Existenzvernichtungshaftung“ analysiert die einzelnen Meilensteine der Rechtsprechung, beginnend mit dem „Autokran“-Urteil von 1985, über das „Bremer-Vulkan“-Urteil von 2001 bis hin zum „Trihotel“-Urteil von 2007. Die Auswirkungen der Rechtsprechung auf den Tatbestand, die Praxis und die Literatur werden im Kapitel „Auswirkungen auf den Tatbestand“ diskutiert. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Existenzvernichtungshaftung, Durchgriffshaftung, Konzernhaftung, Unterkapitalisierung, Vermögensvermischung, Missbrauch der Gesellschaftsform, Sittenwidrige Schädigung, § 826 BGB, Rechtsprechung, Tatbestand, Praxisfolgen, Literatur.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2012, Die Existenzvernichtungshaftung im Wandel der Rechtsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298528