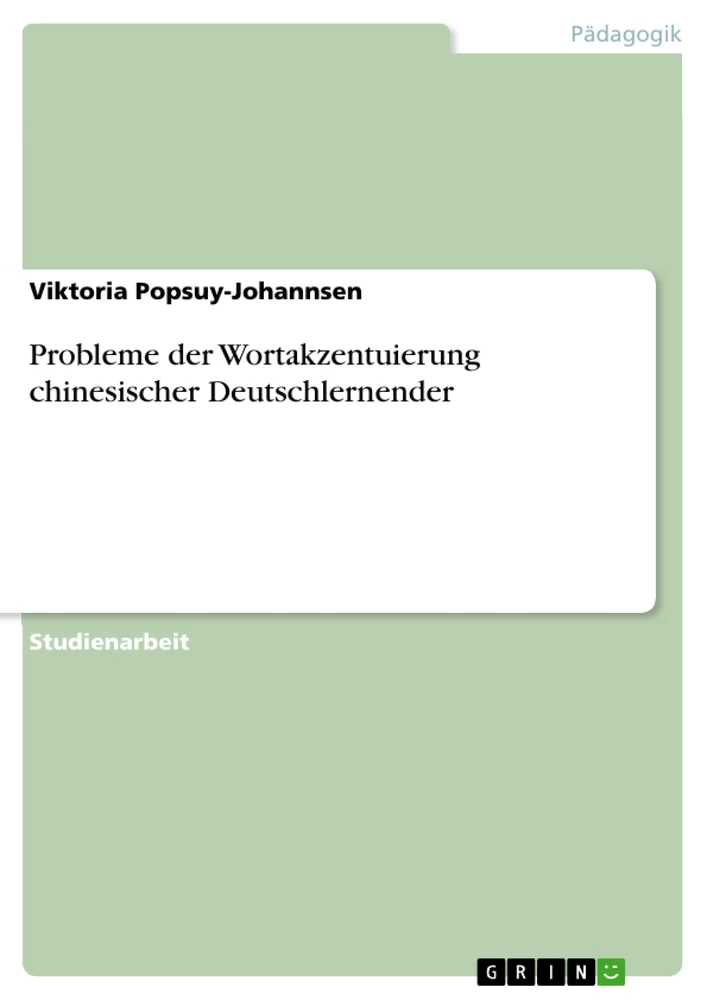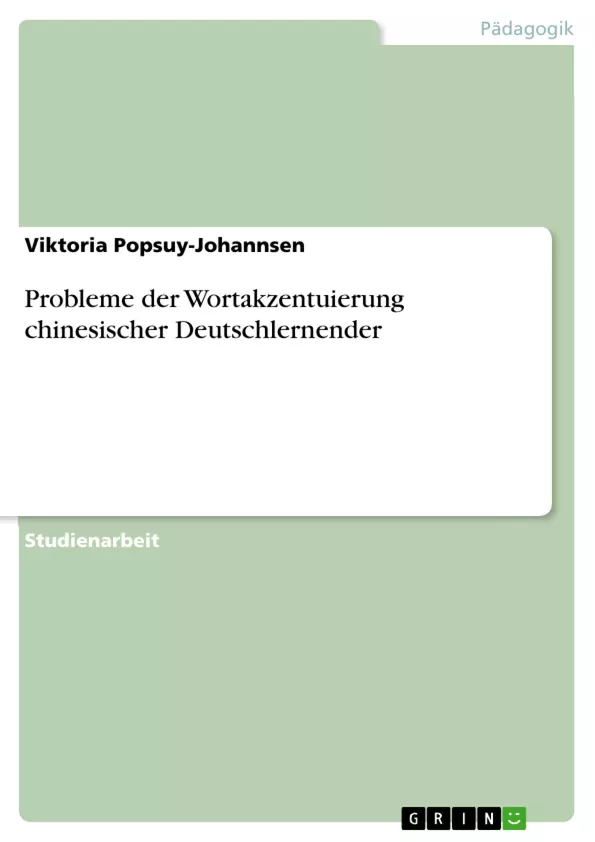Es gibt Akzent-, Ton- oder Tonakzentsprachen. Unter Akzentsprachen versteht man Sprachen, in denen jedes Wort eine Silbe enthält, die den Akzent trägt. Dazu zählen z.B. Deutsch, Englisch oder Russisch. Die Tonsprachen sind diejenigen, bei denen die Tonhöhenverläufe distinktiv „zur Unterscheidung von Wörtern oder Morphemen eingesetzt werden“, z.B. Chinesisch oder Thai. Die Tonhöhen-Akzentsprachen, wie Schwedisch oder Japanisch, verbinden die Eigenschaften von Akzent- und Tonsprachen.
Die deutsche Sprache hat keinen freien Wortakzent, wie z. B. Russisch [pɪ.ˈsɑ.lɪ] – ʻwir, sie schrieben oder ihr schriebtʼ (1., 2. und 3. Person Plural Präteritum Aktiv, unvollendeter Aspekt des Verbes schreiben); und [ˈpi.sa.li] – ʻwir, sie pinkelten oder ihr pinkeltetʼ (1., 2. und 3. Person Plural Präteritum Aktiv, unvollendeter Aspekt des Verbes pinkeln), aber auch keinen festen Akzent, wie Slowakisch, in dem die Betonung immer auf der ersten Silbe liegt. Der deutsche Akzent kann sich ändern, wenn bestimmte morphologische Prozesse stattfinden. Welche Schwierigkeiten dies Lernenden bereitet, soll in der Arbeit am Beispiel von chinesischen Deutschlernenden diskutiert werden, die Deutsch als Fremdsprache erwerben oder erworben haben. Dafür werden die Regeln der Wortakzentuierung im Deutschen dargestellt, die auf Silbenstruktur und metrische Phonologie aufbauen. Um sich ein besseres Bild machen zu können, warum die chinesischen Deutschlernenden Problemen beim Wortakzenterlernen haben, wird im dritten Kapitel die chinesische Silbenstruktur und die Wortakzentuierung präsentiert.
Die Behauptung der Arbeit, dass chinesische Deutschlernende Schwierigkeiten beim Wortakzent haben, wird mithilfe einer Untersuchung von Cordula Hunold diskutiert, die 2009 durchgeführt wurde. Hierbei werden im ersten Teil die Ergebnisse zur Wortakzentuierung dargestellt, die die Autorin mithilfe von zehn Probanden herausarbeitete. Im zweiten Teil des Kapitels wird eine detaillierte Analyse durchgeführt, um die allgemeinen Schlussfolgerungen von Cordula Hunold zu bestätigen oder wiederlegen zu können. Am Schluss wird die Analyse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Silbenstruktur und Wortakzent im Deutschen
- Die deutsche Silbenstruktur in der nichtlinearen Repräsentation und metrischen Phonologie
- Der Wortakzent im Deutschen
- Silbenstruktur und Wortakzent im Chinesischen
- Probleme der Wortakzentuierung chinesischer Deutschlernender
- Ergebnisse zur Untersuchung der Wortakzentuierung nach Hunold (2009)
- Detaillierte Analyse der Untersuchungsergebnisse der Wortakzentuierung chinesischer Deutschlernender
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Schwierigkeiten, die chinesische Deutschlernende bei der Wortakzentuierung der deutschen Sprache haben. Sie untersucht die Unterschiede in der Silbenstruktur und Wortakzentuierung zwischen Deutsch und Chinesisch und analysiert die Ergebnisse einer Untersuchung von Cordula Hunold (2009) zu diesem Thema.
- Unterschiede in der Silbenstruktur und Wortakzentuierung zwischen Deutsch und Chinesisch
- Analyse der Ergebnisse von Hunolds Untersuchung zur Wortakzentuierung chinesischer Deutschlernender
- Identifizierung der spezifischen Schwierigkeiten, die chinesische Deutschlernende bei der Wortakzentuierung haben
- Diskussion der Ursachen für diese Schwierigkeiten
- Entwicklung von möglichen Lösungsansätzen für diese Probleme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Hausarbeit und definiert die Begriffe Akzentuierung und Wortakzent. Sie stellt die Forschungsfrage, ob chinesische Deutschlernende Schwierigkeiten bei der Wortakzentuierung der deutschen Sprache haben. Kapitel 2 beschreibt die deutsche Silbenstruktur und den Wortakzent im Deutschen, wobei die nichtlineare Repräsentation und die metrische Phonologie eine zentrale Rolle spielen. Kapitel 3 präsentiert die chinesische Silbenstruktur und die Wortakzentuierung, um die Unterschiede zu den deutschen Strukturen aufzuzeigen. Kapitel 4 analysiert die Ergebnisse von Hunolds Untersuchung zur Wortakzentuierung chinesischer Deutschlernender und diskutiert die Herausforderungen, die diese Lernenden im Bereich der Wortakzentuierung erleben. Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsbereiche.
Schlüsselwörter
Wortakzentuierung, Silbenstruktur, metrische Phonologie, Deutsch, Chinesisch, Deutschlernende, Hunold, Untersuchung, Schwierigkeiten, Aussprache, Fremdsprache.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Akzent- und Tonsprachen?
In Akzentsprachen (wie Deutsch) trägt eine Silbe pro Wort den Hauptakzent. In Tonsprachen (wie Chinesisch) sind Tonhöhenverläufe distinktiv und dienen der Unterscheidung von Wortbedeutungen.
Warum haben chinesische Lernende Schwierigkeiten mit dem deutschen Wortakzent?
Die Schwierigkeiten resultieren aus den fundamentalen Unterschieden in der Silbenstruktur und den phonologischen Regeln beider Sprachen.
Ist der deutsche Wortakzent fest oder frei?
Deutsch hat weder einen völlig freien noch einen festen Akzent (wie im Slowakischen). Der Akzent kann sich durch morphologische Prozesse (z. B. Wortbildung) verschieben.
Welche Rolle spielt die metrische Phonologie in dieser Arbeit?
Sie bildet den theoretischen Rahmen, um die Regeln der Wortakzentuierung im Deutschen auf Basis der Silbenstruktur zu erklären.
Was ergab die Untersuchung von Cordula Hunold (2009)?
Die Untersuchung analysiert spezifische Fehlermuster chinesischer Deutschlernender bei der Betonung deutscher Wörter und liefert Daten zur Bestätigung der Lernschwierigkeiten.
- Quote paper
- Viktoria Popsuy-Johannsen (Author), 2013, Probleme der Wortakzentuierung chinesischer Deutschlernender, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298614