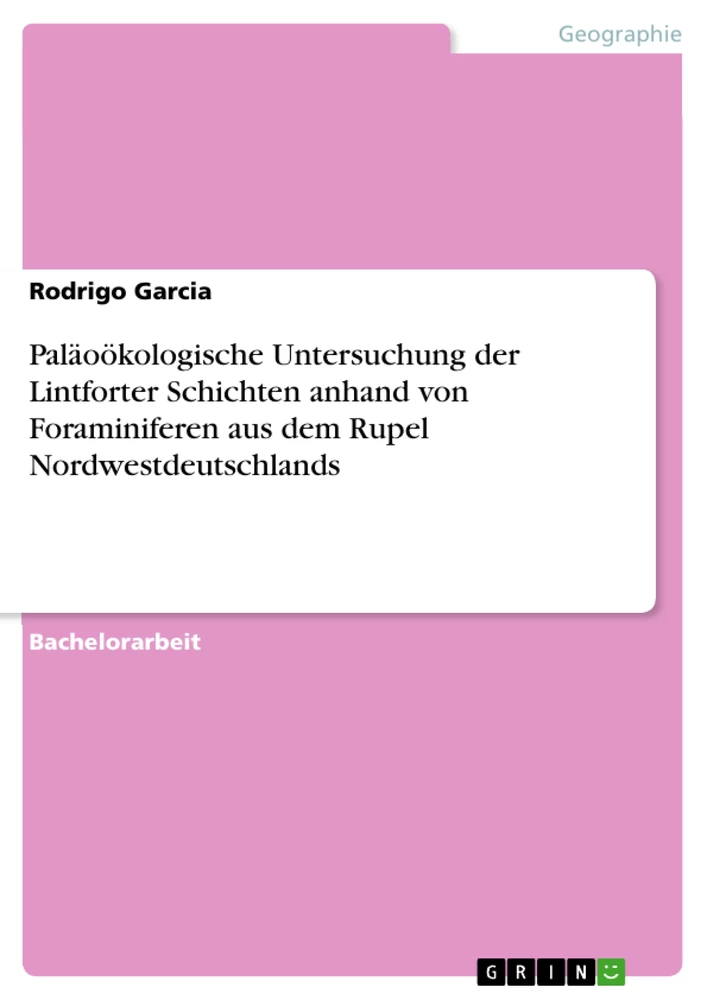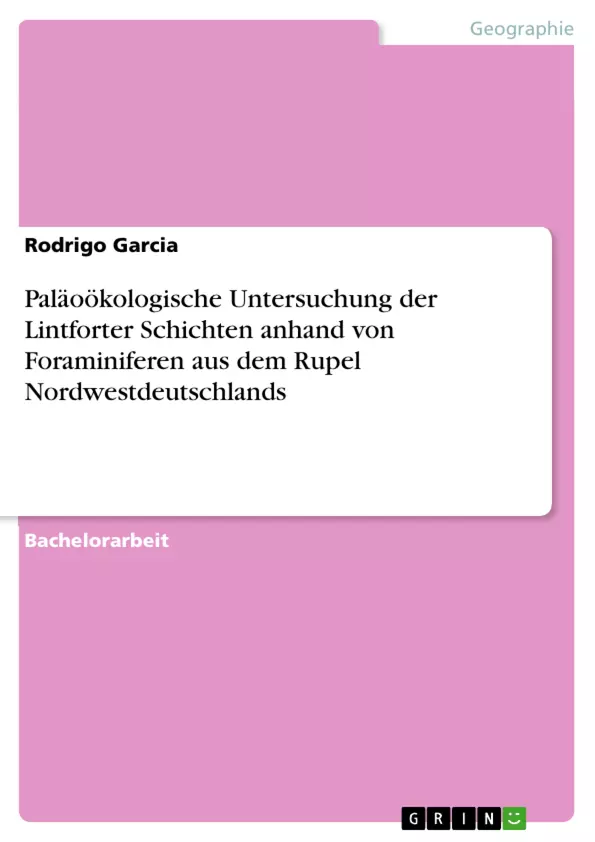Nordwestdeutschland lag im Tertiär in einem Wechselbereich von Land und Meer. Dies macht diese Gegend zum interessantesten Ablagerungsraum des Tertiärs. In dieser Bachelorarbeit werden die Foraminiferenvergesellschaftungen des Unteren Oligozän untersucht. Die Proben dazu stammen aus der Tongrube Mühlenberg Nord bei Dorsten des 5. und 6. Bauabschnitts der Firma Nottenkämper GmbH & Co KG. Durch die paläoökologischen Untersuchungen sollen die Kenntnisse über die Meeresverteilung und die ökologische Situation während des Rupels weiter präzisiert werden.
Foraminiferen sind einzellige Organismen mit heterotrophem Stoffwechsel. Die meisten Formen erreichen eine Größe zwischen 0,1 und 1mm. Einige Großforaminiferen können aber auch größer als 10cm werden. Sie leben als Epi- oder Endobenthos in Meeren oder Lagunen. Einige Foraminiferen besitzen Algensymbionten, sogenannte Zooxanthellen. Einige leben als Zooplankton in der Wassersäule. Viele Foraminiferen bilden Gehäuse. Die Gehäuseformen reichen von primitiven, ungekammerten Röhren bis zu hochkomplexen Formen mit vielen Kammern. Abgesehen vom Prolokulus, der Anfangskammer, nehmen die Kammern von der ältesten zur jüngsten an Größe zu. Die Kammern werden durch Septen getrennt. Das Endoplasma kann durch Öffnungen in den Septen, sogenannte Foramini innerhalb des Gehäuses kommunizieren. Die letzte Kammer verfügt über eine oder mehrere Aperturen, über die Endo- und Ectoplasma kommunizieren können. Form und Lage der Apertur sind besonders wichtig für die taxonomische Einordnung. Bei Aperturen, die nicht an der letzten Kammer liegen, spricht man von Reliktaperturen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einführung in die Foraminiferenkunde
- Gehäuse aus Biopolymer
- Agglutinierte Gehäuse
- Porzellania
- Kalkig-perforierte Gehäuse
- Mikrogranuläre Gehäuse
- Geschichte der mikropaläontologischen Forschung
- Geologischer Überblick
- Profilbeschreibung
- Probennahme
- Phylogenetische Einordnung
- Auszählung
- Paläoökologie
- Index of Oceanity
- Paläoökologie nach Wandungstyp
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Foraminiferenvergesellschaftungen des Unteren Oligozäns aus einer Tongrube bei Dorsten, um die Kenntnisse über die Meeresverteilung und die ökologische Situation während des Rupels zu präzisieren. Die Arbeit befasst sich mit der Paläoökologie des Gebietes und analysiert die Foraminiferen als Indikatoren für die damaligen Umweltbedingungen.
- Foraminiferen-Gehäusetypen und deren Bildung
- Geschichte der mikropaläontologischen Forschung
- Geologische Einordnung des Untersuchungsgebietes
- Paläoökologische Interpretation der Foraminiferen-Vergesellschaftung
- Phylogenetische Einordnung der Foraminiferen
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung: Diese Arbeit untersucht die Foraminiferen-Fauna des Unteren Oligozäns im nordwestdeutschen Raum, um die paläoökologischen Bedingungen dieser Zeit zu rekonstruieren. Der Fokus liegt auf der Analyse von Proben aus einer Tongrube bei Dorsten und der Interpretation der gefundenen Foraminiferen-Arten in Bezug auf die damalige Meeresverteilung und Umweltbedingungen.
Einführung in die Foraminiferenkunde: Das Kapitel beschreibt Foraminiferen als einzellige Organismen mit heterotrophe Stoffwechsel und ihren Gehäusebau. Es werden verschiedene Gehäusetypen detailliert erklärt: agglutiniert, aus Biopolymer, porzellaniös, kalkig-perforiert und mikrogranulär. Die Unterschiede in der Gehäusezusammensetzung und -struktur werden im Detail erläutert und ihre Bedeutung für die taxonomische Einordnung hervorgehoben. Die Beschreibung der Gehäuseanatomie, inklusive Septen, Aperturen und Foramini, bildet die Grundlage für die spätere paläoökologische Analyse.
Geschichte der mikropaläontologischen Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der mikropaläontologischen Forschung von den ersten Beschreibungen durch Herodot und Strabo bis hin zur modernen Mikropaläontologie. Es werden wichtige Persönlichkeiten wie d'Orbigny, Ehrenberg, Dujardin und Reuss erwähnt und deren Beiträge zur Klassifizierung und zum Verständnis von Foraminiferen hervorgehoben. Die Entwicklung der Mikroskopie und ihre Bedeutung für die mikropaläontologische Forschung werden ebenfalls diskutiert. Das Kapitel unterstreicht die wachsende Bedeutung von Foraminiferen als Leitfossilien und ihre Anwendung in der Erdölgeologie und Paläoklimatologie.
Geologischer Überblick: Das Kapitel bietet einen geologischen Kontext für die Untersuchung, indem es die geologische Formation und deren Alter beschreibt. Der Fokus liegt auf der Lintfort Subformation des Niederrheins und ihrer Einordnung in das Rupel. Die Ablagerungsbedingungen während des Rupels werden dargestellt, mit Betonung des Wechselspiels von Land und Meer in diesem Gebiet und seiner Bedeutung als Ablagerungsraum. Die marine Fazies und die geologische Geschichte werden detailliert erläutert und bilden den Rahmen für die Interpretation der paläoökologischen Daten.
Schlüsselwörter
Foraminiferen, Oligozän, Nordwestdeutschland, Paläoökologie, Gehäusebau, Mikropaläontologie, Rupel, Leitfossilien, Meeresverteilung, Umweltbedingungen
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Foraminiferen des Unteren Oligozäns
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Foraminiferen-Vergesellschaftungen des Unteren Oligozäns (Rupel) aus einer Tongrube bei Dorsten, um die Kenntnisse über die Meeresverteilung und die ökologischen Bedingungen während dieser Zeit zu präzisieren. Die Arbeit analysiert die Foraminiferen als Indikatoren für die damaligen Umweltbedingungen und befasst sich mit der Paläoökologie des Gebietes.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Foraminiferen-Gehäusetypen und deren Bildung, die Geschichte der mikropaläontologischen Forschung, die geologische Einordnung des Untersuchungsgebietes, die paläoökologische Interpretation der Foraminiferen-Vergesellschaftung und die phylogenetische Einordnung der Foraminiferen. Sie beinhaltet eine Zusammenfassung, eine Einführung in die Foraminiferenkunde, einen geologischen Überblick, eine Beschreibung der Probennahme und Auswertung, sowie eine detaillierte Paläoökologische Analyse.
Welche Arten von Foraminiferen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Foraminiferen-Gehäusetypen, darunter agglutinierte Gehäuse, Gehäuse aus Biopolymer, porzellaniöse Gehäuse, kalkig-perforierte Gehäuse und mikrogranuläre Gehäuse. Die Unterschiede in der Gehäusezusammensetzung und -struktur werden detailliert erläutert und ihre Bedeutung für die taxonomische Einordnung hervorgehoben.
Wie wird die Paläoökologie der Foraminiferen untersucht?
Die Paläoökologie wird anhand der Analyse der Foraminiferen-Vergesellschaftung untersucht. Es werden Indikatoren wie der Index of Oceanity und die Analyse der Gehäusetypen verwendet, um Rückschlüsse auf die damaligen Umweltbedingungen (z.B. Wassertiefe, Salinität) zu ziehen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die Probennahme, die Auszählung der Foraminiferen und deren phylogenetische Einordnung. Die detaillierten Methoden werden im Haupttext der Arbeit erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der paläoökologischen Analyse der Foraminiferen-Vergesellschaftung aus dem Unteren Oligozän von Dorsten. Diese Ergebnisse liefern Informationen über die Meeresverteilung und die Umweltbedingungen während des Rupels.
Welche Bedeutung haben die Ergebnisse?
Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der paläoökologischen Bedingungen im nordwestdeutschen Raum während des Unteren Oligozäns bei und präzisieren die Kenntnisse über die Meeresverteilung und die ökologische Situation während des Rupels. Die Foraminiferen dienen als wichtige Indikatoren für die damalige Umwelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Foraminiferen, Oligozän, Nordwestdeutschland, Paläoökologie, Gehäusebau, Mikropaläontologie, Rupel, Leitfossilien, Meeresverteilung, Umweltbedingungen
- Citar trabajo
- Rodrigo Garcia (Autor), 2012, Paläoökologische Untersuchung der Lintforter Schichten anhand von Foraminiferen aus dem Rupel Nordwestdeutschlands, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298830