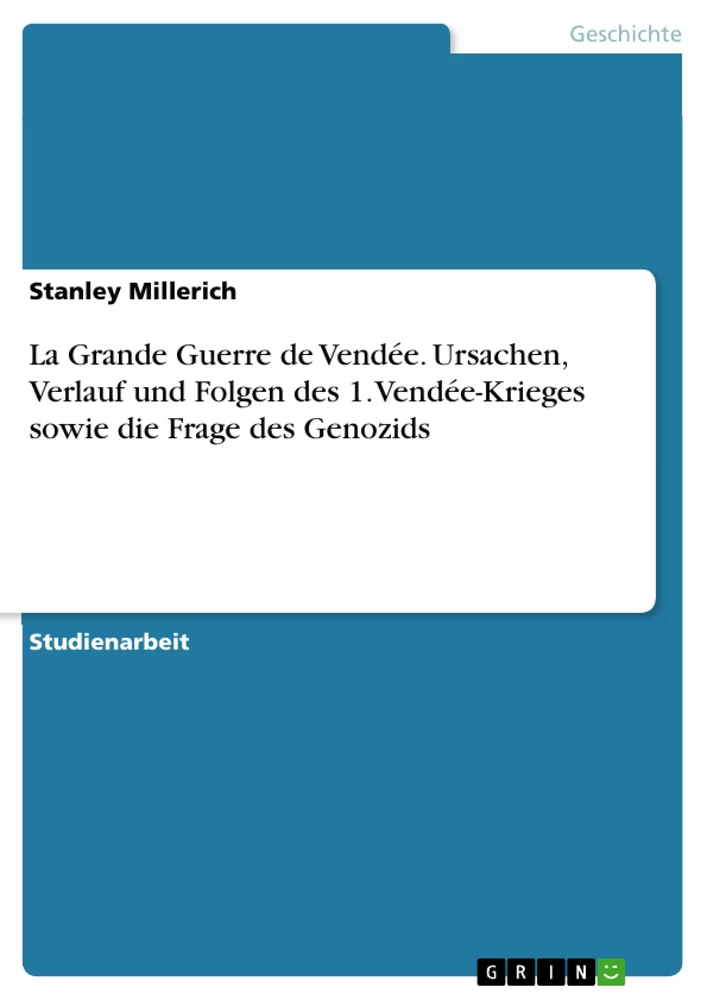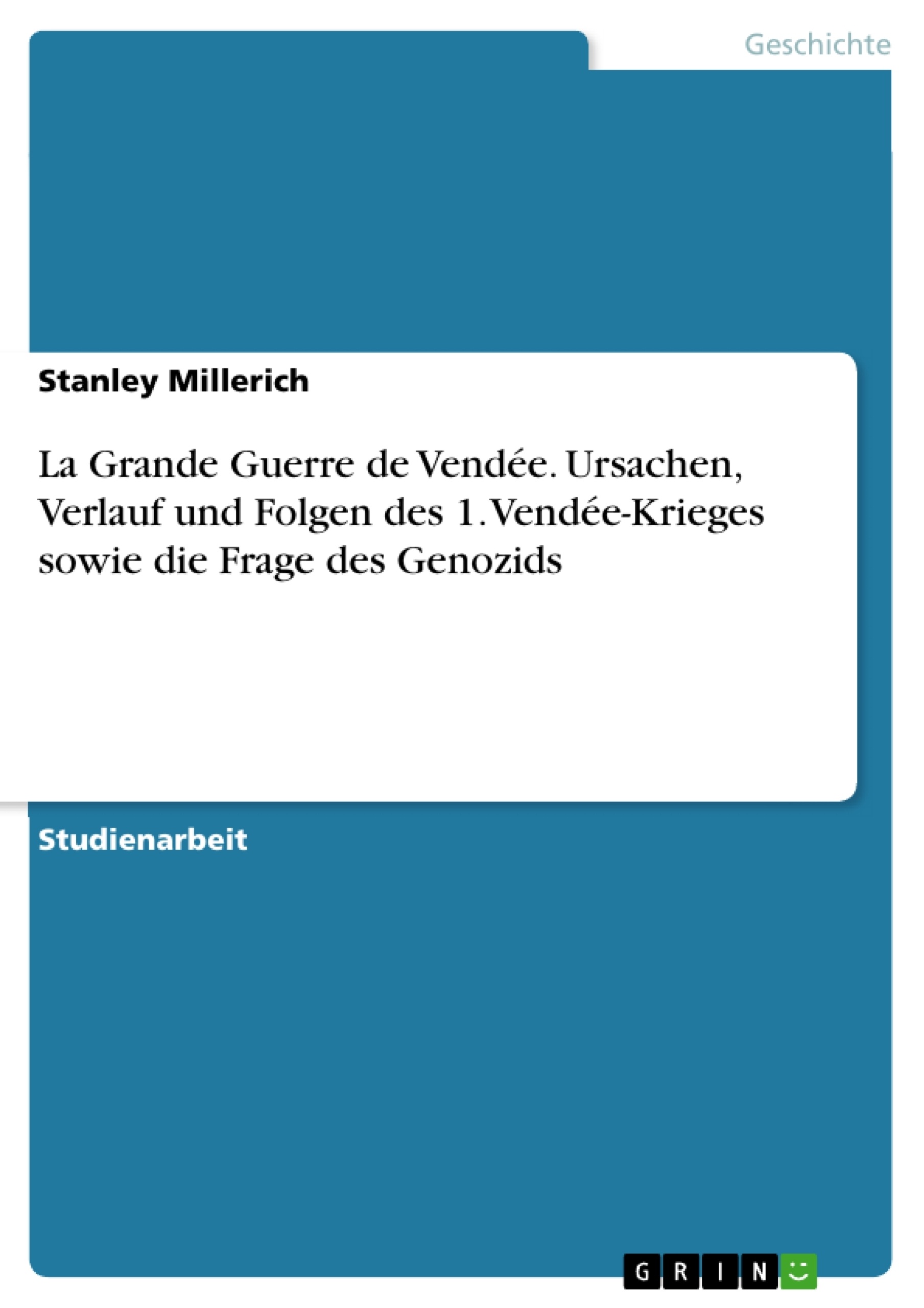Die Französische Revolution wird gemeinhin zu den folgenreichsten Ereignissen der europäischen Geschichte in der Neuzeit gezählt. So gingen die Veränderungen, die sie mit sich brachte, weit über die Grenzen sowohl Frankreichs als auch ihrer Zeit hinaus. Eine wesentliche Errungenschaft der Französischen Revolution war die Beseitigung der Feudalherrschaft in Frankreich, da selbige auch mit ein Grund für die Unzufriedenheit gerade weiter Teile der ländlichen Bevölkerung während der Zeit des Ancien Régime gewesen war.
Dennoch waren die herrschaftlichen Verhältnisse in den meisten Teilen Frankreichs nicht mit denjenigen in der Vendée gleichzusetzen. Diese war ein Departement im Westen Frankreichs, „südlich der Loire, nördlich von La Rochelle, ein
Stück des alten Poitou“, deren Name im Verlauf der Französischen Revolution umfassende Bedeutung erhalten sollte. So wurde sie mehr als ein Ort des gegenrevolutionären Widerstands, sie wurde zum Inbegriff der Gegenrevolution in Frankreich selbst. Der unmittelbare Anlass für den 1. Vendée-Krieg war die durch die Koalitionskriege hervorgerufene Aushebung von 300000 französischen Soldaten gegen die äußeren Feinde. Die beginnenden Aufstände in der Vendée leiteten eine Phase des Widerstands gegen die Französische Revolution ein, die jene selbst überdauern sollte.
Doch wo liegen die tieferen Ursachen für diesen in seiner Bedeutung für die Gegenrevolution beispiellosen Krieg? Wie war das Leben in der Vendée vor dem „Grande Guerre“, wie der erste Vendée-Krieg in Frankreich genannt wird, der mit der
Aushebung Ende Februar 1793 begann und im Dezember 1793 nach der Niederlage der Vendéens bei Savenay endete?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Hauptteil
- Ausgangslage und Ursachen
- Die Vendée im Ancien Régime
- Die Vendée und die Französische Revolution
- Beginn der Aufstände
- Verlauf des Krieges
- Anfängliche Erfolge der Vendéens
- Die Wende
- Der Einfluss Englands
- Umgang mit der Vendée nach Ende des 1. Vendée-Krieges
- Methoden der Niederschlagung
- Frage des Genozids
- Folgen des Krieges
- Ausgangslage und Ursachen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Seminararbeit beleuchtet den 1. Vendée-Krieg in Frankreich während der Französischen Revolution. Sie analysiert die Ursachen und den Verlauf des Aufstandes und untersucht die Frage nach einem möglichen Genozid an der vendéeischen Bevölkerung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Hintergründe des Krieges, die Kriegsführung und die Behandlung der Vendée durch die Revolutionäre zu verstehen.
- Die sozioökonomischen und politischen Verhältnisse in der Vendée vor der Revolution
- Die Reaktion der Vendée auf die Französische Revolution und die Gründe für den Aufstand
- Der Verlauf des 1. Vendée-Krieges: Anfängliche Erfolge der Vendéens, die Wende im Krieg und der Einfluss Englands
- Die Repression durch die "colonnes infernales" und die Frage nach einem Genozid an der vendéeischen Bevölkerung
- Die Folgen des 1. Vendée-Krieges für die Vendée und Frankreich
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Französischen Revolution und die Besonderheiten der Vendée ein. Sie stellt den Kontext des 1. Vendée-Krieges dar und erklärt die Relevanz des Themas.
Der Hauptteil ist in drei Abschnitte gegliedert. Abschnitt 2.1 beleuchtet die Ausgangslage und Ursachen des Aufstands. Hierbei wird auf die besonderen Verhältnisse in der Vendée im Ancien Régime eingegangen und die Reaktion der Bevölkerung auf die Französische Revolution analysiert. Abschnitt 2.2 untersucht den Verlauf des Krieges, die anfänglichen Erfolge der Vendéens, die Wende im Krieg und den Einfluss Englands. Abschnitt 2.3 widmet sich dem Umgang mit der Vendée nach dem 1. Vendée-Krieg und analysiert die Repressionen durch die "colonnes infernales" sowie die Frage nach einem Genozid an der vendéeischen Bevölkerung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Französische Revolution, Vendée, 1. Vendée-Krieg, Gegenrevolution, Ancien Régime, Religion, soziale Verhältnisse, Kriegsführung, Repression, Genozid, "colonnes infernales", Folgen des Krieges.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für den 1. Vendée-Krieg?
Der unmittelbare Anlass war die Anordnung der Revolutionsregierung zur Aushebung von 300.000 Soldaten im Februar 1793, gegen die sich die ländliche Bevölkerung wehrte.
Warum leistete die Vendée Widerstand gegen die Französische Revolution?
Tiefe Ursachen lagen in der religiösen Treue zum katholischen Glauben, der Ablehnung der Kirchenverfolgung durch die Revolutionäre und den spezifischen sozioökonomischen Strukturen der Region.
Was waren die „colonnes infernales“?
Die „Höllenkolonnen“ waren Strafexpeditionen der Revolutionsarmee unter General Turreau, die nach dem militärischen Sieg die Region durch Massenhinrichtungen und Zerstörung befrieden sollten.
Wird die Niederschlagung der Vendée als Genozid betrachtet?
Dies ist eine der umstrittensten Fragen der französischen Geschichtsschreibung. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen die Einstufung der Gräueltaten als Völkermord.
Wann endete der „Grande Guerre“ der Vendée?
Die erste große Phase des Krieges endete im Dezember 1793 nach der vernichtenden Niederlage der Vendéens in der Schlacht bei Savenay.
- Quote paper
- Stanley Millerich (Author), 2015, La Grande Guerre de Vendée. Ursachen, Verlauf und Folgen des 1. Vendée-Krieges sowie die Frage des Genozids, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299070