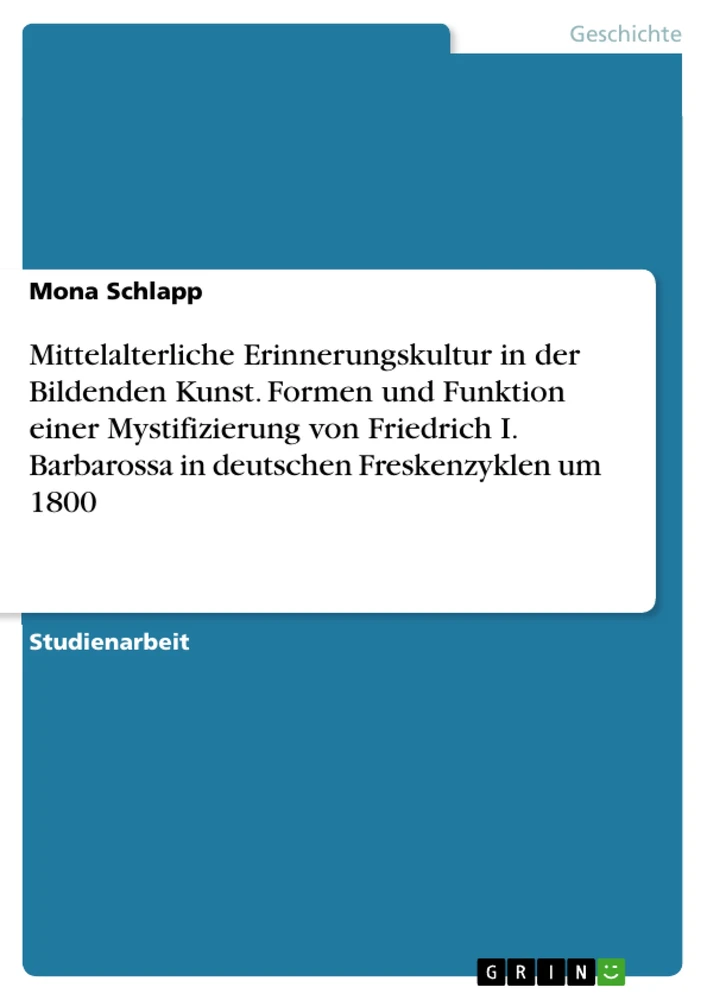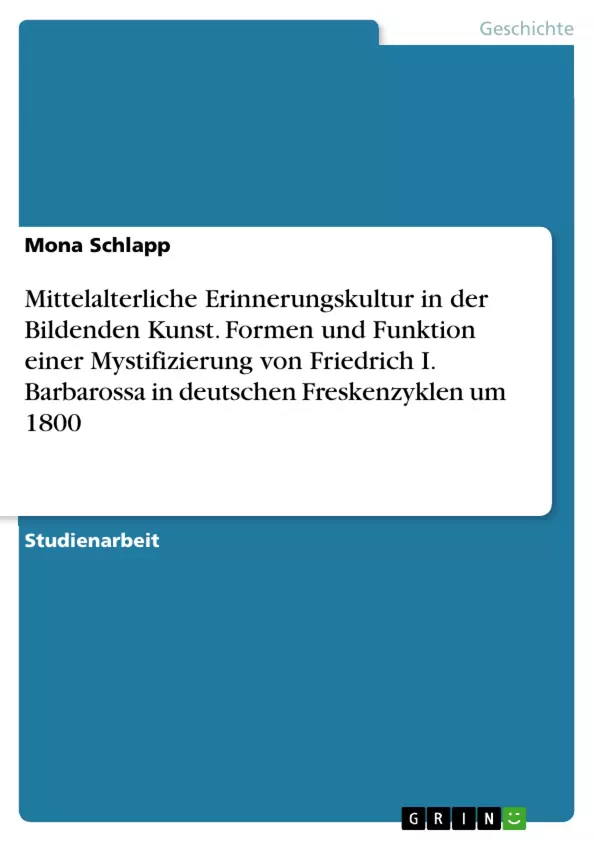Geschichte vermittelt die bildende Kunst ihrem Betrachter selten als "lux veritatis", also als "unverfälscht Wiedergegebenes" aus vergangener Zeit. Gemäß der unausgesprochenen Frage „Welche Vergangenheit braucht deine Zukunft?“, schafft sie mit Geschichtsbildern eine Vergangenheit, die nicht den Abbildungen des Historischen, sondern denen der Zukunftserwartungen entspricht. Der Anspruch an das Gewesene kann dabei von ästhetischem, religiösem oder politischem Interesse sein. Er kann der Legitimation oder zur Identitätsstiftung dienen. Auch die Herrscherpersönlichkeit Kaiser Friederich I. Barbarossa erfüllte jene Funktion als visualisierter Träger der Historie.
Als Symbolfigur in Politik, Geschichte, Literatur und Kunst, steht er als Bild für die nationalen Sehnsüchte der Deutschen. Im 19. Jahrhundert stellte er als einer ihrer Heroen eine leitende Orientierungsgröße in deren Zeitgeschehen dar. Sein Mythos strukturierte die Vergangenheit und hat noch Jahrhunderte danach Einfluss auf die Gegenwart. Innerhalb der Erinnerungskultur ist Barbarossa bis heute in Malerei, Bildhauerei, Denkmälern, Denkmalprojekten, Festen und lebenden Bildern ein Denkmal gesetzt. Das Gedächtnis an den Kaiser hält sich in dieser Hinsicht lebendig.
Fragestellung und Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, vor dem mythologischen Hintergrund des Friedrich Barbarossa sein Nachleben in der Erinnerungskultur des Genres der bildenden Kunst zu betrachten. Anhand dreier großer Projekte für Mittelalterzyklen um 1800 und im Speziellen an den Darstellungen seines Todes, soll herausgearbeitet werden, wie und weshalb er Thema der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts war. Um die Verbindung zwischen der historischen und sagenhaften Gestalt verständlich zu machen und um aufzuzeigen, inwieweit sich die Darstellung mit der tatsächlichen Persönlichkeit Friedrich Barbarossas deckt, wird zu Beginn ein kurzer Abriss über Leben und Person des Stauferkaisers stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Biografischer Hintergrund und Einordnung der historischen Persönlichkeit
- Kurzbiografie
- Die historische Persönlichkeit Friedrich Barbarossa
- Mythos und Tod Barbarossas
- Barbarossa in der deutschen Erinnerungskultur des 19. Jh.
- Der Cappenberger Zyklus
- Die Heltorfer Fresken
- Der Barbarossa-Saal der Münchner Residenz
- Vergleich Heltorfer Fresken und Münchner Residenz
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Nachleben des Friedrich Barbarossa in der Erinnerungskultur der bildenden Kunst. Sie untersucht, wie und weshalb er im 19. Jahrhundert zum Thema der Historienmalerei wurde. Anhand von drei großen Projekten für Mittelalterzyklen um 1800 und insbesondere an den Darstellungen seines Todes, wird die Verbindung zwischen der historischen und sagenhaften Gestalt beleuchtet und aufgezeigt, inwieweit die Darstellung mit der tatsächlichen Persönlichkeit Barbarossas übereinstimmt.
- Der Mythos von Friedrich Barbarossa in der deutschen Erinnerungskultur des 19. Jahrhunderts
- Die Bedeutung von Historienmalerei für die Konstruktion von Geschichtsbildern
- Die Rolle von Kunst als Mittler und Geschmacksverstärker von Botschaften
- Die Verbindung von historischer Persönlichkeit und sagenhafter Gestalt in der bildenden Kunst
- Die Bedeutung von Friedrich Barbarossa als Symbolfigur für die nationalen Sehnsüchte der Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Zielsetzung der Arbeit und stellt die Bedeutung von Kunst als Quelle für das Verständnis historischer Ereignisse heraus. Es wird argumentiert, dass Kunst die Vergangenheit nicht unverfälscht abbildet, sondern eine Vergangenheit schafft, die den Zukunftserwartungen entspricht.
Das zweite Kapitel untersucht den biografischen Hintergrund Friedrich Barbarossas und stellt seine Rolle als Symbolfigur für das deutsche Nationalbewusstsein heraus. Es wird erläutert, dass die Darstellung von Barbarossa in der Kunst stark stilisiert und inszeniert ist und die Mentalitäten der jeweiligen Rezipienten widerspiegelt.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die Darstellung von Barbarossa in drei großen Projekten für Mittelalterzyklen um 1800. Die Kapitel erläutern, wie und weshalb Barbarossa in der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts thematisiert wurde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der deutschen Erinnerungskultur, des Friedrich Barbarossa-Mythos, der Historienmalerei und der Bedeutung von Kunst als Geschichtsquelle. Sie analysiert die Rolle von Kunst als Medium der Geschichtskonstruktion und beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen historischer Persönlichkeit und sagenhafter Gestalt.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Friedrich I. Barbarossa im 19. Jahrhundert so populär?
Er wurde als Symbolfigur für die nationalen Sehnsüchte nach Einheit und Stärke instrumentalisiert. Sein Mythos diente der Identitätsstiftung des neu entstehenden deutschen Nationalstaats.
Was ist ein Freskenzyklus im Kontext der Erinnerungskultur?
Es handelt sich um eine Folge von Wandgemälden, die historische oder sagenhafte Ereignisse darstellen, um politische Botschaften zu vermitteln oder Herrschaft zu legitimieren.
Wie wird Barbarossas Tod in der Kunst um 1800 dargestellt?
Die Darstellungen (z.B. in den Heltorfer Fresken) sind oft mystifiziert und heroisierend, wobei der historische Kern (Ertrinken im Fluss Saleph) künstlerisch überhöht wird.
Was bedeutet "lux veritatis" in der Historienmalerei?
Es bedeutet "Licht der Wahrheit". Die Arbeit zeigt jedoch, dass Kunst Geschichte selten objektiv wiedergibt, sondern sie gemäß den Erwartungen der Gegenwart konstruiert.
Welche Rolle spielten die Münchner Residenz und Schloss Heltorf?
Diese Orte beherbergen bedeutende Mittelalterzyklen, die Barbarossa als Heroen zeigen und so die Verbindung zwischen staufischer Vergangenheit und zeitgenössischem Herrschaftsanspruch verdeutlichen.
- Quote paper
- Mona Schlapp (Author), 2014, Mittelalterliche Erinnerungskultur in der Bildenden Kunst. Formen und Funktion einer Mystifizierung von Friedrich I. Barbarossa in deutschen Freskenzyklen um 1800, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299157