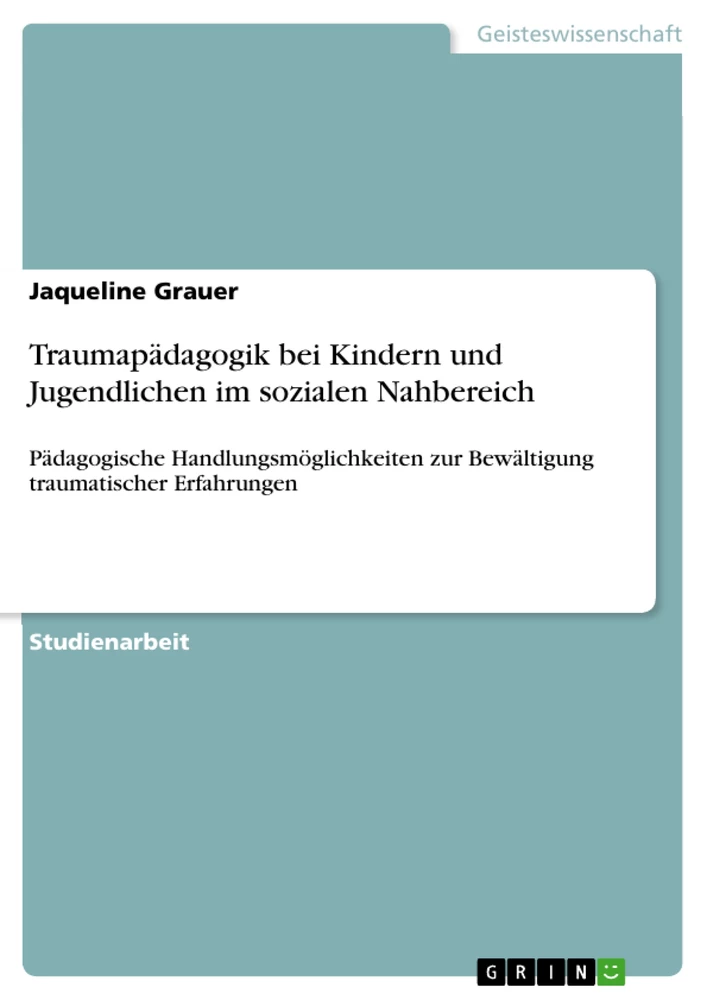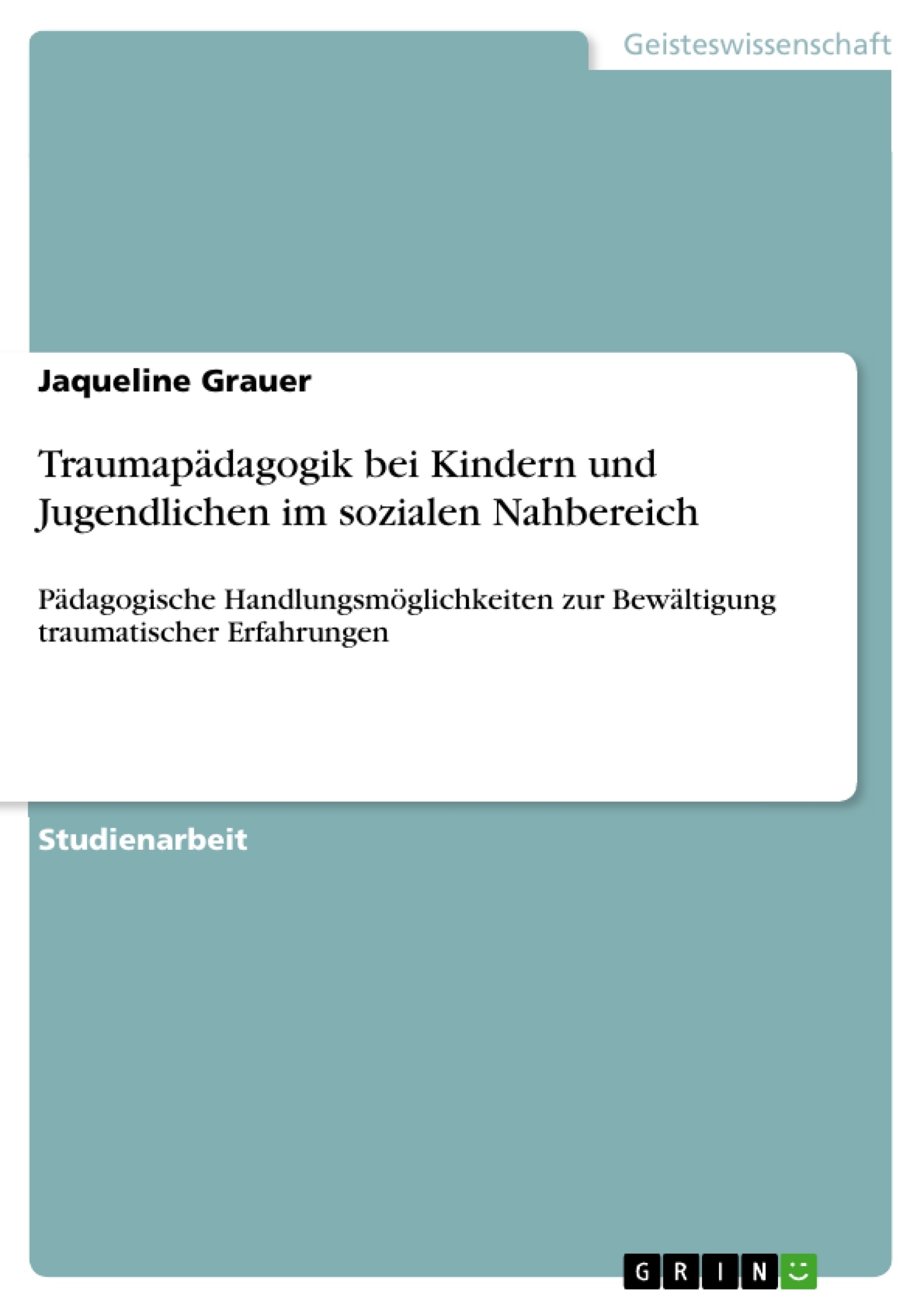Die Traumapädagogik hat sich in den letzten Jahren zu einer neuen, eigenständigen Fachdisziplin entwickelt und etabliert. Denn im Gegensatz zu der Annahme, Traumatisierungen gehören ausschließlich dem therapeutischen Setting an, hat sich herausgestellt, dass auch die Pädagogik für traumatisierte Kinder und Jugendliche Unterstützungsmöglichkeiten bieten kann. Sie ist somit Bestandteil der Pädagogik und bezieht ihr Wissen aus den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie und der Psychotraumatologie.
Die Soziale Arbeit greift in Lebenssituationen, in denen Menschen Schweres geleistet haben. Ihr pädagogischer Arbeitsalltag wird ständig begleitet von traumatischen Erfahrungen der Betroffenen, sodass ein Ausschluss der Traumatisierungen von der Sozialen Arbeit nicht wegzudenken ist. Angesichts der steigenden Vernachlässigungs-, Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen wächst also neben den therapeutischen Verfahren auch die Nachfrage nach traumabasierten pädagogischen Handlungsmöglichkeiten.
Diese Möglichkeiten, welche zur Bewältigung traumatischer Erlebnisse auf pädagogischer Ebene beitragen, und somit den Heilungsprozess der betroffenen Kinder und Jugendlichen aktivieren, möchte ich in meiner Hausarbeit erläutern. Zunächst werde ich auf das Thema „Trauma“ im Allgemeinen und insbesondere auf die schwerwiegenden Ursachen im sozialen Nahbereich eingehen. Anschließend stelle ich die möglichen Folgeerscheinungen dar. Dieses Wissen ist notwendig, um die nachfolgenden Punkte des zentralen Themas der Traumapädagogik und ihre Interventionsmöglichkeiten besser nachvollziehen zu können und diese von den therapeutischen Verfahren zu unterscheiden. Neben den grundlegenden Haltung der Traumapädagogik gehe ich ferner auf den Begriff der Bindung im traumatischen Kontext ein, um die Bedeutung für pädagogisches Handeln zu verdeutlichen.
Table of Contents
- Einleitung
- Trauma
- Begrifflichkeiten
- Ursachen und Entstehung
- Gewalt im sozialen Nahbereich
- Vernachlässigung
- Psychische/Seelische Misshandlung
- Physische Misshandlung
- Sexualisierte Gewalt
- Folgeerscheinungen
- Posttraumatische Belastungsstörung
- Komplexe Traumatisierung
- Entwicklung und Bindung
- Zentrale Lebensbereiche der Folgeerscheinungen
- Traumapädagogik
- Begriffsbestimmung
- Ziele
- Abgrenzung zur Traumatherapie
- Handlungsmöglichkeiten und Methoden der Pädagogik
- Grundhaltungen
- Konzept des guten Grundes
- Wertschätzung
- Partizipation
- Transparenz
- Freude und Spaß
- Ansätze sozialpädagogischer Intervention
- Psychoedukation
- Enttabuisierung
- Traumasensible Biographiearbeit
- Der „Sichere Ort“
- Bindungsorientierung und Neuerfahrung
- Traumatische Übertragung und Gegenübertragung
- Bindungsorientierung zwischen Kind und PädagogIn
- Selbstbemächtigung
- Fazit
Objectives and Key Themes
Die Hausarbeit befasst sich mit der Traumapädagogik und deren Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen bei Kindern und Jugendlichen im sozialen Nahbereich. Sie untersucht die Entstehung von Traumata, insbesondere durch Gewalt im sozialen Nahbereich, und analysiert deren Folgen, einschließlich der posttraumatischen Belastungsstörung und komplexen Traumatisierung. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die grundlegenden Prinzipien und Methoden der Traumapädagogik, darunter die Bedeutung von Bindungsorientierung und Selbstbemächtigung im pädagogischen Handeln.
- Traumapädagogik als eigenständige Fachdisziplin
- Ursachen und Entstehung von Traumata im sozialen Nahbereich
- Folgen von Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen
- Grundhaltungen und Ansätze sozialpädagogischer Intervention
- Bedeutung von Bindungsorientierung und Selbstbemächtigung in der Traumapädagogik
Chapter Summaries
Die Einleitung führt in das Thema der Traumapädagogik ein und stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der Sozialen Arbeit heraus. Sie beleuchtet die zunehmende Bedeutung von traumabasierten pädagogischen Handlungsmöglichkeiten angesichts steigender Vernachlässigungs-, Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen.
Kapitel 2 definiert den Begriff "Trauma" und beleuchtet dessen Ursachen und Entstehung, insbesondere im Zusammenhang mit Gewalt im sozialen Nahbereich. Es werden verschiedene Formen der Gewalt im sozialen Nahbereich wie Vernachlässigung, psychische/seelische Misshandlung, physische Misshandlung und sexualisierte Gewalt erläutert. Darüber hinaus werden die Folgen traumatischer Erfahrungen, wie die posttraumatische Belastungsstörung und die komplexe Traumatisierung, detailliert dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Traumapädagogik als eigenständige Fachdisziplin. Es werden die Ziele, Methoden und Handlungsmöglichkeiten der Traumapädagogik im Vergleich zur Traumatherapie erörtert. Es werden die Grundhaltungen der Traumapädagogik, wie das Konzept des guten Grundes, Wertschätzung, Partizipation, Transparenz und Freude und Spaß, sowie die Ansätze sozialpädagogischer Intervention, wie Psychoedukation, Enttabuisierung und traumasensible Biographiearbeit, behandelt. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Bindungsorientierung und Neuerfahrung im Kontext traumatischer Erfahrungen und die Wichtigkeit von Selbstbemächtigung für traumatisierte Kinder und Jugendliche hervorgehoben.
Keywords
Die Hausarbeit fokussiert auf zentrale Begriffe wie Trauma, Traumapädagogik, Gewalt im sozialen Nahbereich, posttraumatische Belastungsstörung, komplexe Traumatisierung, Bindungsorientierung, Selbstbemächtigung, Psychoedukation, Enttabuisierung und traumasensible Biographiearbeit. Sie untersucht die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und analysiert die Möglichkeiten pädagogischen Handelns im Kontext von Traumatisierung.
- Quote paper
- Jaqueline Grauer (Author), 2014, Traumapädagogik bei Kindern und Jugendlichen im sozialen Nahbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299228