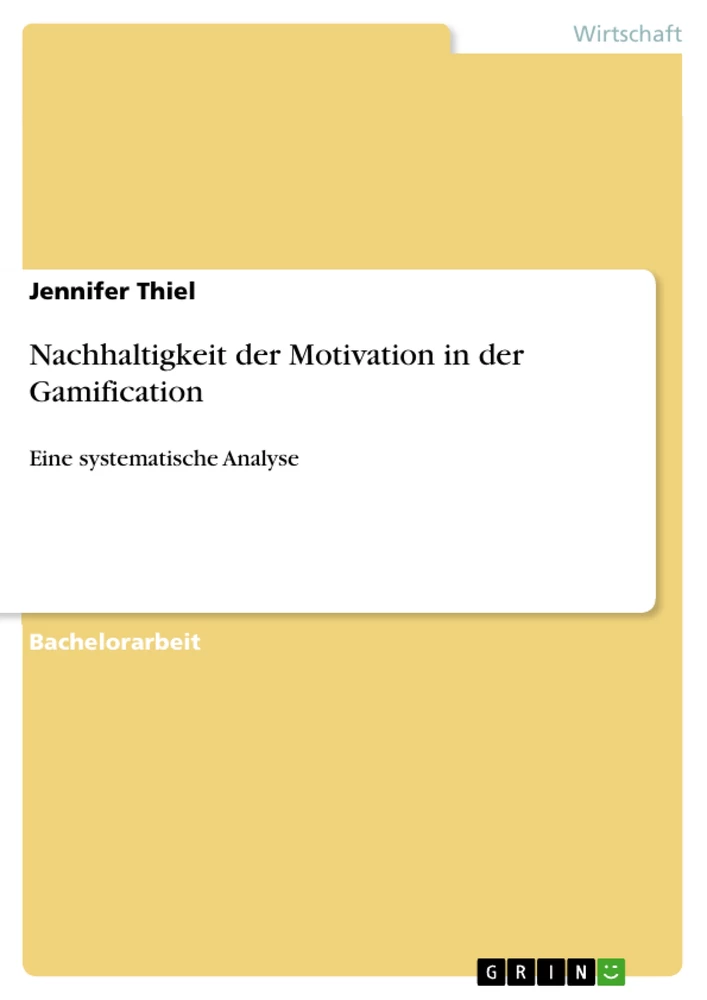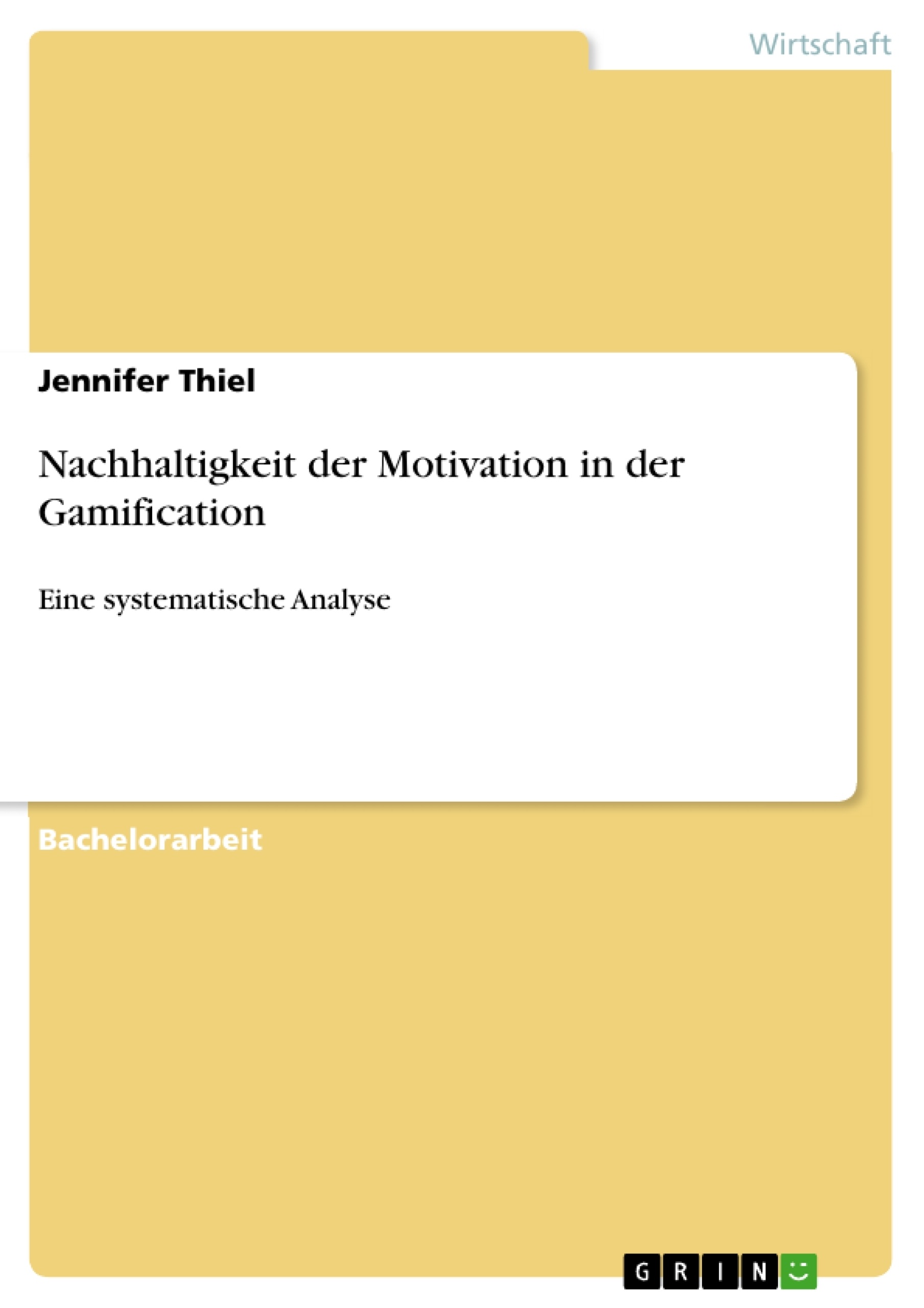Aktuell ist ein aufstrebender Trend in Bezug auf die Gamifizierung von Arbeitsprozessen zu erkennen. Das Ziel von Gamification ist die Nutzung von Spielelementen in einem spielfremden Kontext , um die motivierende Wirkung von Computerspielen für andere Einsatzgebiete zu nutzen. Die Beobachtung von Individuen bei der Nutzung von Computerspielen zeigt, dass diese Spiele animieren und die Spieler emotional involviert sind. Selbst bei der Erledigung von monotonen, repetitiven Spielsequenzen sind die Nutzer motiviert. Einige Personen erfahren beim Spielen einen „Flow-Zustand“.
Der zunehmende Wettbewerbs- und Kostendruck erfordert von Unternehmen eine effektive und effiziente Nutzung aller zur Verfügung stehenden Leistungspotentiale und Ressourcen. Durch die Nutzung der positiven Effekte von Spielelementen der Computerspiele ist Gamification eine innovative Methode um, unter anderem, die Mitarbeitermotivation zu fördern. Dauerhaft motivierte Mitarbeiter sind ein Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Befürworter der Gamification, wie die Spielentwicklerin Jane McGonigal, sind der Ansicht, dass Spiele in der Lage sind Probleme zu lösen und Glücksgefühle bei dem Nutzer zu erzeugen. Die Kritiker hingegen sind der Auffassung, Gamification sei völliger „Bullshit“ und lediglich eine Erfindung von Unternehmensberatungen. Der aktuelle Forschungsstand erfasst allerdings nicht, inwieweit gamifizierte Arbeitsprozesse Mitarbeiter in Unternehmen nachhaltig motivieren können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Gamification
- 2.1.1 Spielelemente der Gamification
- 2.1.2 Beispiele von Gamification
- 2.2 Motivation und Motivationstheorien
- 2.3 Der Flow-Zustand
- 2.4 Nachhaltigkeit
- 3. Untersuchungsrahmen
- 3.1 Mentales Modell
- 3.2 Methodik
- 4. Untersuchung
- 4.1 Einflussfaktoren auf den Employee Motivation Gamification-Circle
- 4.2 Der Employee Motivation Gamification-Circle
- 4.2.1 Die Zielgruppe Employees
- 4.2.2 Gamification und Gamified Work
- 4.2.3 Echtzeit Feedback
- 4.2.4 Flow-Zustand bei der Enterprise Gamification
- 4.2.5 Kurzfristiger Motivationskreislauf
- 4.3 Beyond Gamification
- 4.3.1 Reach Endgame
- 4.3.2 Strategien gegen das Endgame
- 4.4 Kritische Reflektion
- 4.5 Erfolgskriterien
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.2 Limitationen
- 5.3 Implikationen für die Forschung
- 5.4 Implikationen für die Praxis
- 5.5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Motivation durch Gamification nachhaltig gestaltet werden kann. Die Arbeit untersucht die Anwendung von Gamification im Kontext der Arbeitswelt und analysiert die Auswirkungen auf die Motivation von Mitarbeitern.
- Einsatz von Gamification in der Arbeitswelt
- Einfluss von Gamification auf die Mitarbeitermotivation
- Faktoren, die die Nachhaltigkeit der Motivation durch Gamification beeinflussen
- Entwicklung eines Modells für den Employee Motivation Gamification-Circle
- Identifizierung von Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Gamification
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Nachhaltigkeit der Motivation in der Gamification ein. Es werden die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Gamification, der Motivation und des Flow-Zustands. Es werden verschiedene Motivationstheorien vorgestellt und die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Kontext der Gamification diskutiert. Kapitel 3 beschreibt den Untersuchungsrahmen, einschließlich des mentalen Modells und der Methodik. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Einflussfaktoren auf den Employee Motivation Gamification-Circle analysiert und das Modell des Employee Motivation Gamification-Circle vorgestellt. Darüber hinaus werden Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Gamification diskutiert. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert Limitationen, Implikationen für die Forschung und die Praxis sowie einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Gamification, Motivation, Nachhaltigkeit, Employee Motivation Gamification-Circle, Flow-Zustand, Spielelemente, Echtzeit Feedback, Endgame, und Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Gamification.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Gamification am Arbeitsplatz?
Ziel ist die Nutzung von Spielelementen in spielfremden Kontexten, um die Motivation und emotionale Involvierung von Mitarbeitern zu steigern.
Kann Gamification Mitarbeiter nachhaltig motivieren?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert Faktoren, die über den kurzfristigen Motivationsschub hinausgehen, um Langzeiteffekte zu sichern.
Was versteht man unter dem „Flow-Zustand“?
Der Flow-Zustand beschreibt ein tiefes Aufgehen in einer Tätigkeit, bei dem Zeitgefühl und Selbstbewusstsein in den Hintergrund treten, was oft durch Spielelemente begünstigt wird.
Was sind typische Spielelemente in der Gamification?
Dazu gehören unter anderem Ranglisten, Abzeichen (Badges), Erfahrungspunkte und Echtzeit-Feedback.
Was bedeutet das „Endgame“ in gamifizierten Prozessen?
Das Endgame bezeichnet den Punkt, an dem die Motivation nachlässt, sobald alle Belohnungen erreicht sind. Die Arbeit diskutiert Strategien, um diesen Effekt zu verhindern.
- Arbeit zitieren
- Jennifer Thiel (Autor:in), 2015, Nachhaltigkeit der Motivation in der Gamification, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299230