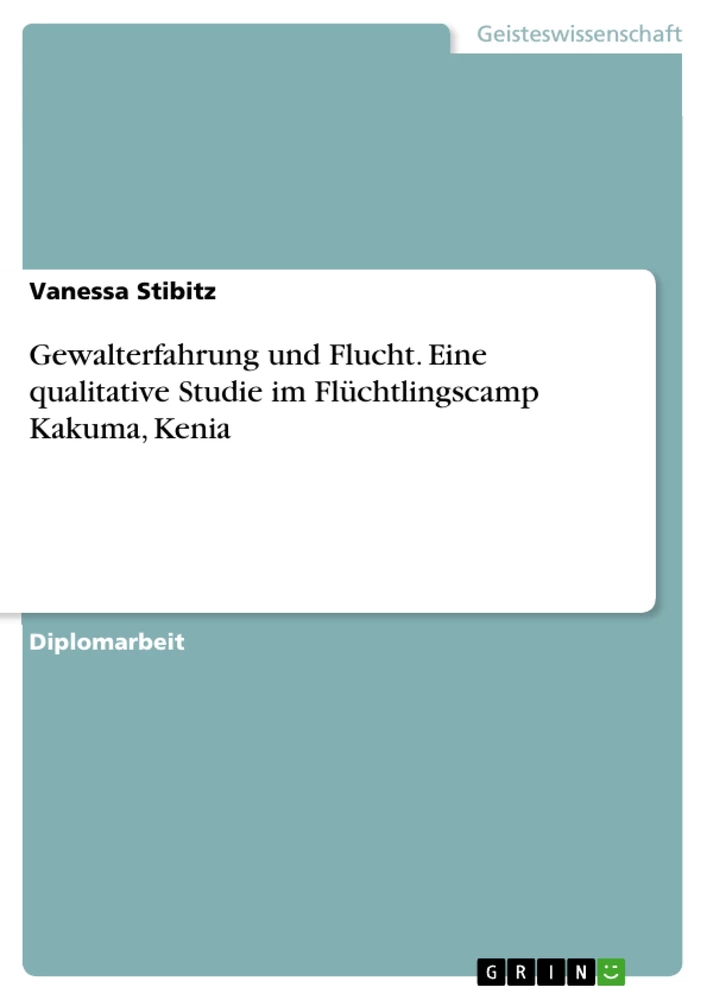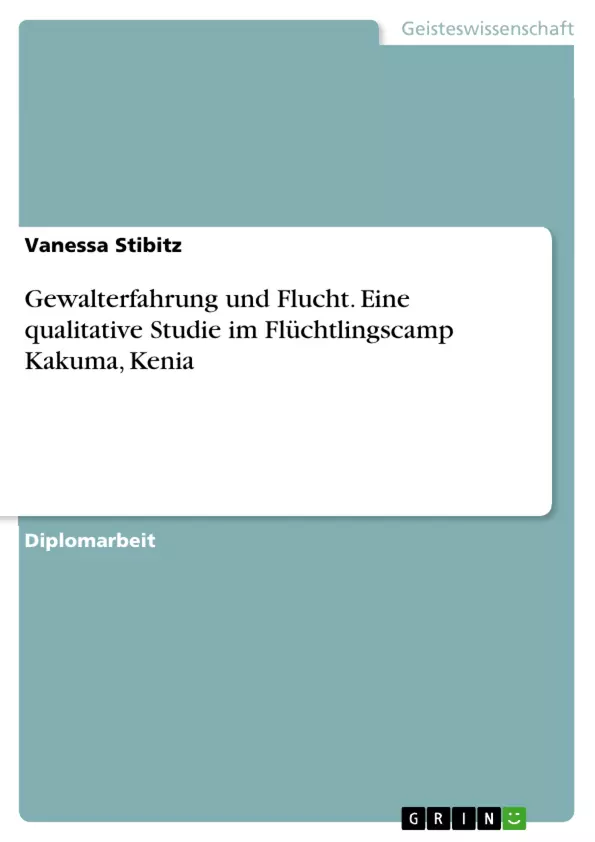Ziel der Arbeit ist es, unter Berücksichtigung des Forschungskontextes und anhand der Inhalte der Interviews, die wahrgenommenen Bedingungen der Gewaltbetroffenheit, ihre Formen und die Strategien des Wehrens gegen Gewalt aufzuzeigen. Dabei werden auch die strukturellen Determinanten, die sich aus der Camporganisation ergeben aufgezeigt und kritisch hinterfragt durch welche Akteure Gewalt im Camp legitimiert oder kriminalisiert wird.
Durch die Analyse der Interviews werden dabei auch Ungleichheiten zwischen weiblichen und männlichen Campbewohnern herausgearbeitet und vor dem Hintergrund der Diskurse über Gewalt, die von den Organisationen der Vereinten Nationen bestimmt werden, reflektiert. Basierend auf den Erzählungen der Interviewten
werden die unterschiedlichen Formen von Gewalt, denen die Flüchtlinge ausgesetzt waren und sind, beschrieben und interpretiert.
Der jeweilige Umgang mit der Betroffenheit
wird anhand der Veränderungen des Handelns im biografischen Verlauf dargestellt, um im Sinne Max Webers´ „soziales Handeln deutend [zu] verstehen und dadurch in seinem
Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich [zu] erklären […]“ (Weber 1972: 1). Durch die Kontrastierungen der Fälle werden analytische Kategorien gebildet, die in unterschiedliche Kontexte eingebettet, Formen des aktiven Schützens vor Gewalt
beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abbildungsverzeichnis
- III. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Vorbemerkungen
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Gliederung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Migration
- 2.2 Zum Gewaltbegriff
- 2.3 Gewalt im Flüchtlingskontext
- 3. Ort der Erhebung: Das Flüchtlingscamp Kakuma
- 3.1 Zugang zum Feld
- 3.2 Gatekeeper
- 3.3 Beschreibung der Zielgruppe
- 3.4 Sampling
- 4. Methodik und Forschungsdesign
- 4.1 Zur Anwendung qualitativer versus quantitativer Forschung
- 4.2 Das narrative Interview
- 4.3 Grounded Theory
- 5. Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Gründe und Ursachen
- 5.2 Formen der Gewaltbetroffenheit
- 5.3 Bewältigungsstrategien - Das aktive Schützen
- 5.4 Rahmenbedingungen
- 5.5 Konsequenzen
- 5.6 Falldarstellung
- 6. Fazit
- IV. Literaturverzeichnis
- V. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Erfahrungen von Flucht und Gewalt im Flüchtlingscamp Kakuma in Kenia. Das Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Formen der Gewalt, die von Flüchtlingen im Camp erlebt werden, zu untersuchen und die Ursachen und Folgen dieser Gewalt zu analysieren.
- Die Rolle von Flucht und Vertreibung in der Entstehung von Gewalt
- Die verschiedenen Formen der Gewalt im Flüchtlingskontext
- Die Bewältigungsstrategien von Flüchtlingen im Umgang mit Gewalt
- Die Auswirkungen von Gewalt auf das Leben und die Lebensbedingungen von Flüchtlingen
- Die Bedeutung von Schutz und Unterstützung für die Betroffenen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und die Gliederung der Arbeit erläutert. Im Anschluss werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere die Konzepte von Migration und Gewalt, sowie die Bedeutung von Gewalt im Flüchtlingskontext, dargestellt. Kapitel 3 beschreibt den Ort der Erhebung, das Flüchtlingscamp Kakuma, und erläutert den Zugang zum Feld, die Gatekeeper und die Zielgruppe der Studie. Kapitel 4 widmet sich der Methodik und dem Forschungsdesign der Arbeit. Hier werden die Anwendung qualitativer Forschung, das narrative Interview und die Grounded Theory als methodische Ansätze erläutert. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie, die sich mit den Gründen und Ursachen von Gewalt, den Formen der Gewaltbetroffenheit, den Bewältigungsstrategien, den Rahmenbedingungen, den Konsequenzen und einer Falldarstellung befassen. Abschließend wird in Kapitel 6 ein Fazit gezogen, das die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und die Relevanz der Thematik für die Praxis hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Flucht, Gewalt, Flüchtlingscamp, Kakuma, Kenia, qualitative Forschung, narrative Interviews, Grounded Theory, Bewältigungsstrategien, Schutz, Unterstützung, humanitäre Hilfe, interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Studie im Flüchtlingscamp Kakuma?
Die Arbeit analysiert Gewalterfahrungen von Flüchtlingen, die Formen der Gewaltbetroffenheit und die Strategien des Wehrens (Bewältigungsstrategien).
Welche Formen von Gewalt treten im Camp auf?
Die Studie beschreibt physische, strukturelle und geschlechtsspezifische Gewalt, die oft durch die Camporganisation und soziale Ungleichheiten beeinflusst wird.
Welche Forschungsmethoden wurden verwendet?
Es wurden qualitative Methoden wie narrative Interviews und die Grounded Theory angewendet, um das soziale Handeln der Betroffenen zu verstehen.
Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern bezüglich Gewalt?
Ja, die Analyse arbeitet Ungleichheiten heraus und reflektiert diese vor dem Hintergrund internationaler Diskurse der Vereinten Nationen.
Wo liegt das Flüchtlingscamp Kakuma?
Kakuma befindet sich im Nordwesten von Kenia und ist eines der größten Flüchtlingslager weltweit.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Stibitz (Autor:in), 2013, Gewalterfahrung und Flucht. Eine qualitative Studie im Flüchtlingscamp Kakuma, Kenia, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299328