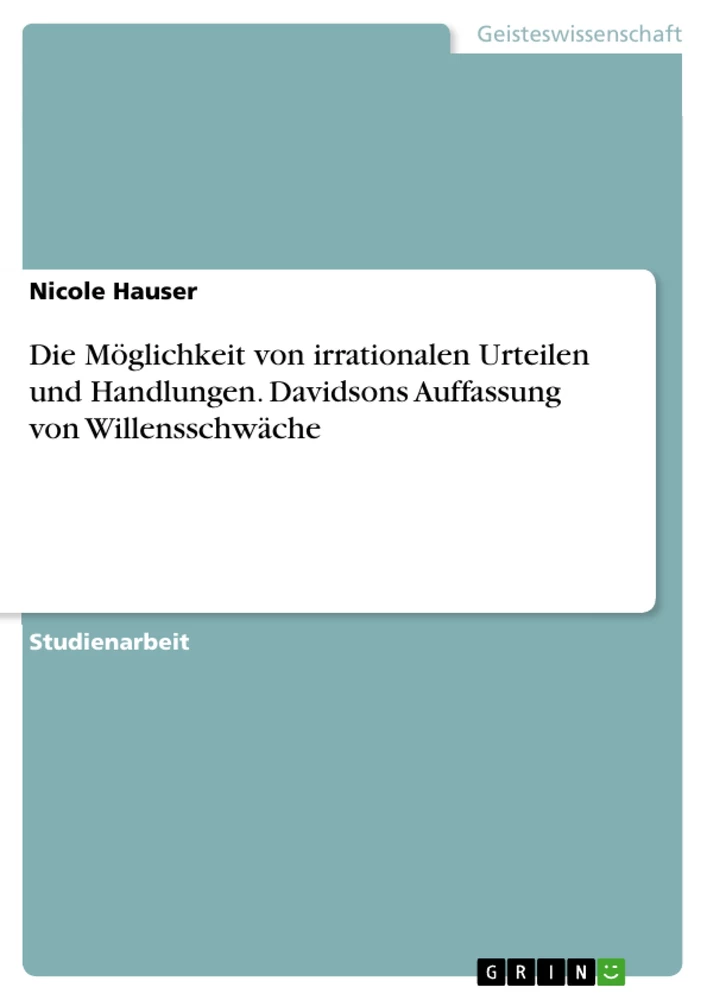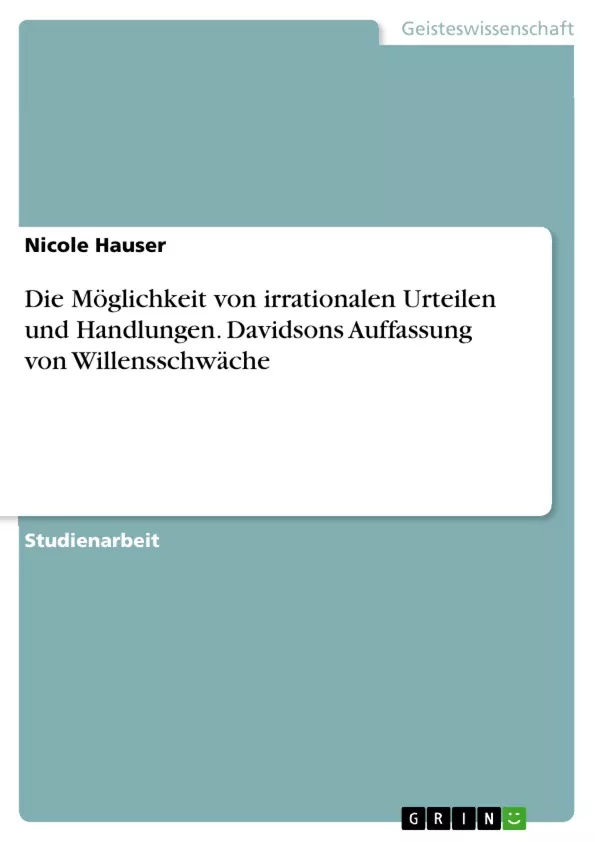Das menschliche Denken wird, soweit wir in der Philosophie zurückblicken können, auf dessen Rationalität untersucht. Vernunft gilt gemeinhin als zentrales menschliches Merkmal, das keinen bedeutenden Philosophen in den letzten Jahrhunderten und gar Jahrtausenden unberührt gelassen hat.
Mit dieser Auseinandersetzung gehen seit jeher Fragen der Grenzen menschlicher Vernunft einher. Der amerikanische Philosoph Donald Davidson sieht Irrationalität als „[...] ein Versagen innerhalb des Hauses der Vernunft“ und beschreibt eine irrationale Handlung als einen „[...] rationale[n] Prozess oder Zustand -, der in die Irre gegangen ist.“ In diesem Sinne setzt er die Rationalität als Grundlage zur Möglichkeit irrationaler Gedanken, Handlungen oder Absichten voraus und stellt sich die Frage, wie besagter Prozess oder Zustand möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Antike Wegbereitung
- Davidsons Willensschwäche als Irrationalität
- Das Unbewusste im Irrationalen
- Kognitive Täuschungen
- Die Überschätzung des eigenen Einflusses
- Abwertung durch Zeit
- Die unbewusste Absicht irrational zu urteilen - ein Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen der Willensschwäche aus der Perspektive des amerikanischen Philosophen Donald Davidson. Sie analysiert Davidsons Argumentation, dass Willensschwäche als eine Form der unbewussten, begrenzten Rationalität verstanden werden kann.
- Die historische Entwicklung des Begriffs der Willensschwäche in der Antike
- Davidsons Theorie der Irrationalität und ihre Anwendung auf das Phänomen der Willensschwäche
- Die Rolle unbewusster Prozesse und kognitiver Verzerrungen bei willenschwachen Handlungen
- Die Auswirkungen unbewusster Einflüsse auf die Rationalität von Urteilen und Entscheidungen
- Eine kritische Analyse von Davidsons These und die Entwicklung einer eigenen Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Willensschwäche vor und erläutert den Ansatz von Donald Davidson, der Irrationalität als ein „Versagen innerhalb des Hauses der Vernunft“ betrachtet. Am Beispiel einer Diät-haltenden Person wird das Phänomen der Willensschwäche illustriert: Die Person entscheidet sich bewusst für eine gesunde Option, handelt aber letztlich entgegen ihrer Entscheidung.
Antike Wegbereitung
Dieses Kapitel beleuchtet die antiken Philosophen Platon, Sokrates und Aristoteles und ihre Ansätze zur Erklärung von Willensschwäche. Es zeigt, wie diese Denker das Phänomen der Willensschwäche bereits in ihren Überlegungen zur menschlichen Natur und zum Verhältnis von Vernunft und Begierde berücksichtigten.
Davidsons Willensschwäche als Irrationalität
Dieses Kapitel konzentriert sich auf Davidsons Theorie der Willensschwäche. Davidson argumentiert, dass Willensschwäche ein Ergebnis von irrationalen Urteilen und Handlungen ist, die durch unbewusste Prozesse beeinflusst werden. Es werden zentrale Konzepte aus Davidsons Werken „Wie ist Willensschwäche möglich?“ und „Paradoxen der Irrationalität“ vorgestellt.
Das Unbewusste im Irrationalen
Dieses Kapitel befasst sich mit den unbewussten Prozessen, die nach Davidson zu irrationalen Entscheidungen und Handlungen führen können. Es werden kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse und psychologische Phänomene aufgegriffen, die das Konzept des „Unbewussten“ beleuchten und die Möglichkeit einer unbewussten, begrenzten Rationalität verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Willensschwäche, Irrationalität, Donald Davidson, unbewusste Prozesse, kognitive Verzerrungen, Rationalität, Entscheidungsfindung, Philosophie, Psychologie, Antike Philosophie, Platon, Sokrates, Aristoteles.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Donald Davidson Irrationalität?
Er sieht sie als ein „Versagen innerhalb des Hauses der Vernunft“ – ein rationaler Prozess, der in die Irre gegangen ist.
Was ist Willensschwäche (Akrasia)?
Es beschreibt das Phänomen, bei dem eine Person ein Urteil über die beste Handlung fällt, aber dennoch entgegen diesem Urteil handelt.
Wie erklärt Davidson die Möglichkeit willensschwacher Handlungen?
Er postuliert eine mentale Struktur, in der unbewusste Prozesse und kognitive Täuschungen dazu führen, dass rationale Urteile nicht umgesetzt werden.
Welche antiken Philosophen befassten sich bereits mit diesem Thema?
Platon, Sokrates und Aristoteles legten die Grundlagen für die Untersuchung des Verhältnisses von Vernunft und Begierde.
Welche Rolle spielt das Unbewusste bei irrationalen Urteilen?
Das Unbewusste kann kognitive Verzerrungen wie die Überschätzung des eigenen Einflusses oder die zeitliche Abwertung von Zielen bewirken.
Was ist das Fazit der Arbeit zur unbewussten Absicht?
Die Arbeit schließt mit der Überlegung, dass willensschwaches Handeln als Ausdruck einer begrenzten, unbewusst beeinflussten Rationalität verstanden werden kann.
- Quote paper
- Nicole Hauser (Author), 2013, Die Möglichkeit von irrationalen Urteilen und Handlungen. Davidsons Auffassung von Willensschwäche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299420