In dieser Arbeit soll der Begriff der Volksaktie exemplarisch definiert und die Motivation für ihre Emission in der BRD anhand des Volkswagenwerkes und der Deutschen Telekom dargestellt und analysiert werden. In einem weiteren Schritt wird die Volksaktie als Anlageform betrachtet und ihr Risiko- und Renditepotential über den historischen Zeitraum bis heute bewertet. Dies wird in Relation zu den üblichen Anlagealternativen der breiten Bevölkerung gesetzt. Dazu zählen Spareinlagen bei Banken und Kapitallebensversicherungen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang interessant, wie sich die Volksaktien im Verhältnis zum gesamten Aktienmarkt entwickelt haben. Die zentrale Fragestellung ist, ob aus historischer Perspektive das Kapitalmarktengagement im Rahmen von Volksaktien eine realistische Maßnahme zum Vermögenserhalt bzw. -aufbau der Bevölkerung sein kann.
Inhalt
I. Einleitung
II. Historische Entwicklung: Von derAktìe zur Volksaktìe
III. Defìnitìon einer Volksaktìe
1. Das Volkswagenwerk und die Volksaktìen der ersten Generatìon
2. Die Deutsche Telekom und die Volksaktien der zweiten Generation
IV. Zur Motivation für die Emission von Volksaktien in der BRD
1. Zur Motivation für die Emission der ersten Generation von Volksaktien
Die Rolle des Eigentums
Ungleichheit aufgrund der Selbstfinanzierung
Wirtschaftspolitische Hintergründe
2. Zur Motivation für die Emission der zweiten Generation von Volksaktien
V. Rendite der Volksaktìen im Vergleich zu alternatìven Anlageformen
Berechnungsgrundlagen
Die Rendite der Volksaktìen
VI. Fazit - Die Zukunft der Volksaktìe
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnisd
Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Versicherung über eigenständiges Abfassen
Anhang
I. Einleitung
„Wohlstand für alle - Eigentum für jeden"[1] lautete Ende der 1950er Jahre die Devise des damaligen Bundeswirtschaftsministers Ludwig Erhard. Es waren die Nachkriegsjahre in der noch jungen Bundesrepublik, das Wirtschaftswachstum war hoch und ermöglichte immer mehr Bürgern ein selbstbestimmtes Leben. Das System der Marktwirtschaft war in den westlichen Besatzungszonen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlage geworden. Es beruht auf dem Wettbewerb unter den Wirtschaftssubjekten, den Produktivkräften des Einzelnen und schließlich auf dem Wachstum der Wirtschaftsleistung. Bildlich gesprochen lautete die Idee, dass sich die Politik nicht primär der Umverteilung des „volkswirtschaftlichen Kuchens" annimmt, sondern die Rahmenbedingungen setzt, um den Kuchen größer werden zu lassen. Wohlstand für alle schließt jedoch Ungleichheit nicht aus, im Gegensatz zum planwirtschaftlichen System des Sozialismus, dessen zentrales Ziel die Gleichheit innerhalb der Gesellschaft ist. Zu jener Zeit des kalten Krieges standen die beiden System noch in ernsthafter Konkurrenz zueinander und es war noch nicht sicher, welches System schließlich dominieren würde. Ein Eigenheim, ein eigenes Auto oder der Jahresurlaub waren Dinge, welche für die meisten Menschen in Deutschland direkt nach Kriegsende unerreichbar schienen. Doch die westdeutsche Wirtschaftspolitik war erfolgreich und ein starker und nachhaltiger Aufschwung setzte ein - das deutsche Wirtschaftswunder, als dessen Vater Ludwig Erhard bis heute bekannt ist. Wenn sich die Lebensumstände im Zuge dessen auch drastisch verbesserten, so war doch bereits in den Anfängen eine Ungleichverteilung der Vermögen erkennbar.[2] Ein soziales Ungleichgewicht drohte, welches das Zusammenwachsen der noch „werdenden Gesellschaft" gefährden konnte.[3] Ludwig Erhard war daher eine der treibenden Kräfte hinter der sogenannten Volksaktie, die den Bürger am Produktivkapital des Landes beteiligen sollte. Der breiten Masse sollte die Möglichkeit zum Vermögensauftau gegeben werden um die „materielle Basis persönlicher Unabhängigkeit" zu legen, „aus der erfahrungsgemäß am ehesten Prägung und kulturelle Kraft bürgerlichen Gemeinwesens erwachsen".[4] Ein hoher Anspruch an die Volksaktie, die so nicht nur ein reines Renditeobjekt ist, sondern auch eine zentrale sozial- und gesellschaftspolitische Bedeutung hat. In diesem Geiste wurden große Staatsbetriebe wie die Preußische Bergwerks- und Hütten AG und das Volkswagen werk als Volks-Aktiengesellschaften in die Privatwirtschaft entlassen. Durch intensive Bewerbung der Volksaktien in den Medien und mit Hilfe von Aussagen aus der Politik entstand das Bild einer risikoarmen Anlageform mit hohen Renditen. In Deutschland herrschte eine Aktieneuphorie, getragen von den zu Beginn steigenden Kursen der Volksaktien.
Das böse Erwachen kam mit der Ölkrise in den siebziger Jahren. Der Wirtschaftsaufschwung erlebte seinen ersten Dämpfer, Dividenden wurden zum Teil ausgesetzt, die Kurse tielen und Anleger verloren ihr Geld. Es wurde still um die einst bejubelte Volksaktie. In der Zeit danach wurde Deutschland von sozialdemokratischen Regierungen geführt, die seit jeher Vorbehalte gegen die Veräußerung von Bundesvermögen an private Interessenten hatten.[5] Erst Ende der achtziger Jahre unter der Regierung Kohl ging ein weiteres großes Staatsunternehmen an die Börse, die Vereinigte Industrieunternehmungen AG, kurz Viag. 1996 folgte dann der große Börsengang der Deutschen Telekom. Wieder machte das Wort der Volksaktie die Runde, wieder vertiel Deutschland in eine Aktieneuphorie, welche sowohl von einer großen Werbekampagne als auch von politischer Unterstützung der Politik und anfänglich steigenden Kursen getragen wurde. Dennoch waren die Vorzeichen diesmal anders. Der Begriff Volksaktie war mehr eine Marketingstrategie zur Stimulierung der Nachfrage nach den Aktien, als dass gesellschaftspolitischen Ziele im Fokus standen. Nach einem vier Jahre andauernden Anstieg der Aktienkurse platzte im Jahr 2000 die sogenannte Dotcom-Blase. Die Börsen brachen ein und mit ihnen die Aktie der Deutschen Telekom. Viele Privatanleger verloren ihr Geld. Mit den Folgen beschäftigen sich die Gerichte noch heute. Der Vorwurf lautet, dass die Aktien der Deutschen Telekom als sichere Anlageform verkauft wurden, ohne dass ausreichend vor den Risiken gewarnt worden wäre. Das Ende der Volksaktie?
In dieser Arbeit soll der Begriff der Volksaktie exemplarisch detiniert und die Motivation für ihre Emission in der BRD anhand des Volkswagenwerkes und der Deutschen Telekom dargestellt und analysiert werden. In einem weiteren Schritt wird die Volksaktie als Anlageform betrachtet und ihr Risiko- und Renditepotential über den historischen Zeitraum bis heute bewertet. Dies wird in Relation zu den üblichen Anlagealternativen der breiten Bevölkerung gesetzt. Dazu zählen Spareinlagen bei Banken und Kapitallebensversicherungen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang interessant, wie sich die Volksaktien im
Verhältnis zum gesamten Aktienmarkt entwickelt haben. Die zentrale Fragestellung ist, ob aus historischer Perspektive das Kapitalmarktengagement im Rahmen von Volksaktien eine realistische Maßnahme zum Vermögenserhalt bzw. -auftau der Bevölkerung sein kann.
Auf der Grundlage literarischer Recherche wird der historische Kontext dargelegt und in seiner Bedeutung erfasst. Die meisten Quellen zu diesem Thema erschienen um das Jahr I960. Zentral für diese Arbeit ist vor allem „Die Kleinaktie" von Theodor Fabri und „Die
Volksaktie" von Klaus Nöldner. Außerdem wurden Zeitungsbeiträge aus den Sechzigern, z.B. aus Die Zeit und Der Spiegel über die jeweiligen Onlinearchive abgerufen und für diese Arbeit genutzt. Quellen, welche sich mit der Telekom-Aktie beschäftigen sind die Dissertation von Nicole Munk, „Die T-Aktie als Marke - staatliche und private Einflussnahme zur Kurspflege einer Volksaktie" und der Titel „Der Börsengang der Telekom" von Sönke Müller aus der Reihe „Hamburger Schriften zur Marketingforschung". Darüber hinaus wurde eine hinaus wurde eine Reihe wissenschaftlicher Aufsätze und Zeitungsbeiträge herangezogen. Zentral war der Aufsatz „Von der Volksaktie zur Altersvorsorge - eine Chronologie" von Thomas Hartmann-Wendels, der in der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen im Jahr 2008 erschienen ist.
Im zweiten Teil werden die historischen Renditen der oben genannten Anlageformen anhand der jeweiligen Zahlenreihen analysiert. Die Zahlenreihen stammen jeweils von der im Internet zugänglichen Datenbank der Bundesbank, von der GESIS-Datenbank des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften und von Thomson Reuters Datastream über die Lizenz der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Die Daten zu der VW- Aktie wurden mir freundlicherweise von der Investor-Relations Abteilung der Volkswagen AG zur Verfügung gestellt. Auf die genaue Behandlung von Aktiensplitts, Dividenden, Inflation und Steuern wird im entsprechenden Kapitel weiter eingegangen. Zahlen werden von Eins bis Zwölf ausgeschrieben, außer sie beziehen sich auf Paragraphen oder auf eine Abbildung oder Tabelle. Abkürzungen werden im Abkürzungsverzeichnis erläutert. Ge- schlechtsspeziflsche Angaben erfolgen der Einfachheit halber nur in männlicher Form.
Die Untergliederung dieser Arbeit gestaltet sich chronologisch von der Entwicklung der allgemeinen Aktie bis zur Volksaktie. Dann werden die Deflnition und die Motivation für die Emission abgehandelt. Darauf folgend wird die Volksaktie als Anlageform bewertet, um abschließend im Fazit herzuleiten, ob sich die mit der Volksaktie verbundenen Ver sprechen erfüllt haben.
II. Historische Entwicklung: Von der Aktie zur Volksaktie
Die Idee der Aktie etablierte si ch i n Europa nach 1498 als da G ama 1498 den Seeweg nach Asien ums Kap der Guten Hoffnung entdeckte. Daraufain etablierte sich hundert Jahre später der Überseehandel, sodass über den Seeweg exotische Waren importiert werden konnten. Aus Asien konnten so beispielsweise Waren billiger und schneller als mit den Karawanen üb er den bisherigen Landweg nach Europa gebracht werden. Pfeffer, Muskatnuss, Nelken, Indigo, Baumwolle, Seide und Tee fanden reißenden Absatz in Europa und erlaubten hohe Gewinne. Dagegen standen die Risiken der Reise, Piratenüberfälle oder Schi№ruch. Doch bei erfolgreicher Rückkehr der Schiffe waren Gewinne zwischen 95 und 230 Prozent möglich.[6] Sowohl Handelsherren wie die Fugger und die Welser als auch fürstliche Kaufmannsgeschlechter wie die Medici haben ihre Handelsimperien aufgebaut und verhalfen Städten wie Genua oder Venedig zu wirtschaftlichem Aufschwung.[7] Die ersten Handelsexpeditionen starteten in Südeuropa, vor allem in Portugal. Die hohen Zöllen und Abgaben von bis zu fünfzig Prozent der Ladung, die die Krone von Portugal erhob, ließ den Seehandel in den freiheitlichen Städten des Nordens erblühen. Amsterdam, Antwerpen, London, Hamburg und andere wurden zu Handelsmetropolen.[8] In diesen Städten entstanden Handelskompanien, in denen sich Kaufleute vereinigten, Kapital für die Ausrüstung der Expeditionen zu sammeln und das Risiko der Reise auf mehrere Schultern zu verteilen. Für die Route nach Asien wurden größere und aufwendigere S chiffe gebraucht, die in der Regel in Flottenverbänden fuhren, bewaffnet sein mussten oder Begleitschutz von der Marine hatten. Die Kosten für eine solche Expedition waren entsprechend doppelt bis viermal so hoch wie für eine Fahrt nach Afrika. Außerdem gingen in der ersten Zeit von 1595 bis 1601 zwanzig Prozent der Flotte verloren oder es dauerte bis zu 15 Jahre bis die Schiffe zurückkehrten.[9] Um diese Risiken zu verteilen, wurde eine größere Zahl an Investoren benötigt. Bisher war für Fahrten nach Italien oder Afrika ein Zusammenschluss von drei bis vier, maximal 15 Kaufleuten üblich, welche gemeinsam entschieden, wie die Expeditionen ausgestattet wurden, welche Reiserouten gewählt wurden und welche Waren mitzubringen seien.[10] Dabei hing das Stimmengewicht davon ab, wie viel Geld jemand zur Finanzierung des Vorhabens einbrachte.[11] Für die Expeditionen nach Asien wurde mehr Kapital benöt'gt, es galt ein höheres Risiko zu verteilen und es lockten höhere Gewinne. Bei einem großen Umfang an Teilhabern war es nicht mehr möglich, die Meinung jedes Einzelnen zu berücksichtigen und viele Investoren hatten auch nicht das Fachwis sen, um sich einbringen zu können. Zum Teil waren Investoren nicht vor Ort, sondern kamen aus dem Binnenland oder aus dem europäischen Ausland, angelockt von der Chance auf hohe Gewinne.[12] Infolgedessen wurden Handelskompanien gegründet, die das Kapital der Investoren bündelten und damit Überseeexpeditionen finanzierten. Die Größten und Wichfigsten dieser Kompanien waren auf dem europäischen Festland die Holländisch-Ostindische Handelskompanie von 1602 und in Großbritannien die Englische Ostndien-Kom- panie von 1600, welche in scharfer Konkurrenz zueinander standen.[13] Diese Kompanien teilten nun zur Finanzierung verbriefte Anteilsscheine aus, in denen dem Kapitalgeber eine Teilhaberschaft an der Unternehmung zugesichert wurde, und zwar im Verhältnis zur Höhe des Kapitals, das er eingezahlt hatte. Der Teilhaber hatte durch dieses Dokument einen Anspruch auf die Auszahlung eines Gewinnanteils, wenn die S chiffe erfolgreich zurückkehrten. Dem entgegen stand das Risiko, dass die Schiffe nicht zurückkehrten und er seinen Anteil nicht wiedererhalten würde. Das heißt die Haftung ist auf genau den eingezahlten Anteil beschränkt. Des Weiteren verzichtete der Teilhaber auf ein direktes Mitspracherecht an den Entscheidungen der Gesellschaft, sondern überließ dies einem Komitee.[14] Der Betrag, mit dem sich der Investor an der Kompanie beteiligte, war der Nennwert. Der Anteil am Gewinn belief sich auf das Verhältnis vom Nennwert zum Gesamtkapital - die Dividende. Damit waren die grundlegenden Eigenschaften einer Aktengesellschaft erfüllt: öffentliche Beteiligung an einem Wirtschaftsunternehmen, Trennung von Beschlussfassung und der Besorgung der Geschäfte, Verbriefung des Nennwertes und des Anspruchs auf eine Dividende sowie die Beschränkung der Haftung auf das eingezahlte Kapital.[15] Die Akten der Kompanien waren frei handelbar. Neben der Gewinnbeteiligung rief das zudem einen anderen Aspekt der Akte ins Leben - die Spekulat'on. Wenn beispielsweise jemand Nachricht von einer zurückkehrenden Flotte erhielt, hatte er ein Interesse daran, noch weitere Anteilsscheine zu kaufen. Dafür war er dann in der Regel bereit, einen höheren Preis als den ursprünglichen Nennwert zu zahlen, weil er si ch eine hohe Gewinnausschüttung versprach. Wenn der Teilhaber Nachricht vom Untergang der Schiffe erhielt, würde er versuchen, seine Anteile zu verkaufen.
Das Aktienkapital der Holländisch-Ostindischen Handelskompanie betrug insgesamt ca. 6,5 Millionen holländische Gulden, die auf 2153 Akten aufgeteilt waren.[16] Das entspricht einem Nennwert von 3019 Gulden pro Akte. Bei ihrer Gründung in Amsterdam waren es 1100 Anteilseigner, bei einer Gesamtbevölkerung von 50000. Die hohen Gewinne, welche die Asienexpeditionen versprachen, hatten ein großes öffentliches Interesse erregt, so- dass sich auch Sparer mit kleineren Beträgen an der Kompanie beteiligten. Es gab noch kein kodifiziertes Aktienrecht und es war erlaubt, einzelne Aktìen zu stückeln und zu kleinen Teilnennwerten zu handeln. So konnte auch das einfache Volk mit kleinen Beträgen t e i l h a b e n u n d vo n st e i g e n d e n Kurse n profite re n. E s e n tsta n d d i e e rste Spekulationsblase.[17] Die Spekulation mit Akten der Holländisch-Ostindischen Kompanie dehnte sich aus auf die Spekulaton mit Tulpenzwiebeln aus und stellte1636-1637 eine der allerersten Finanzkrisen der neueren Geschichte dar.[18] Einen ähnlichen Exzess erlebte der Handel mit Akten als John Law[19] seine Banque Générale mit der Ausgabe von Akten finanzierte und für diese so gar eine Ratenzahlung erlaubte. Er wollte „die Masse der kleinen Kapitalien zu einer Groß macht vereinigen"[20]. Der Umlauf an Akten erhöhte sich rasant und in Folge der Ratenzahlung wurde quasi eine Hebelwirkung eingebaut, welche die Spekulatonen weiter anheizte. 1720 kam es schließlich zum Zusammenbruch, bei dem gerade die armen Bevölkerungskreise um ihr Geld gebracht wurden. Sie hatten sich erst am Ende der Spekulaton am Aktenhandel beteiligt, verleitet von den hohen Gewinnen der Vergangenheit.[21]
Als Folge dieser Exzesse wurden Aktengesellschaften von den damaligen Regierungen erhebliche Schwierigkeiten bereitet, in Frankreich sogar vorübergehend verboten. Im 18. Jahrhundert war die Aktengesellschaft ohne große Bedeutung in Europa. Dies änderte sich erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Die Erfindungen der Dampfma- schine und später der Eisenbahn verlangte nach viel Kapital, für das auf breite Bevölke rungskreise zurückgegriffen werden musste.[22] Die Aktie zeigte abermals ihre entscheidende Rolle in der Finanzierung unternehmerischer Wagnisse. Mit Einführung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches von 1861 gab es erstmals einen allgemeingülf- gen kodifizierten Rechtsrahmen für weite Teile des Deutschen Bundes. Aktiengesellschaften wurden erstmals explizit definiert und einer gesetzlichen Regelung unterworfen. Gesellschaftskapital konnte demnach in Akten zerlegt werden, deren Nennbetrag im Gesellschaftsvertrag bestimmt wurde und untereinander die gleiche Höhe haben sollte.[23] Die tatsächliche Höhe der Nennbeträge war also ursprünglich nicht gesetzlich geregelt. Erst mit der Aktiennovelle von 1870 wurde ein fester Nennbetrag von 50 Vereinstalern auf Namensaktien und 100 Vereinstalern auf Inhaberaktien[24] festgelegt. Auch wenn diese Beträge von der breiten Bevölkerung in der Regel nicht aufgebracht werden konnte, so gab es doch Teile des Volkes, wie kleinere Industrielle, höhere Beamte oder Kaufleute, welche die Möglichkeit hatten, am Aktienhandel teilzunehmen. Bereits in den Jahren 1871 und 1872 wurde mit Hilfe der Aktien eine große Anzahl an Aktiengesellschaften gegründet, der sogenannte Gründerboom. Dies ging mit einem ausgeprägten Aktienschwindel einher und mündete 1873 in einer Krise, die abermals die Ersparnisse, der in Aktien investierten, Bürger vernichtete. Die Schuld wurde dem Aktiengesetz von 1870 und der Aktiengesellschaft an sich zugeschrieben.[25] In der Aktiennovelle von 1884 wurde die Kritk dann über nommen, indem ein Mindestbetrag von 1000 Mark festgeschrieben wurde. Der kleine Anleger sollte vor den Verlockungen der Spekulation geschützt werden, gegen die er aufgrund mangelnden Wissens schutzlos ausgeliefert sei. Er sei nicht dazu in der Lage sein Recht durchzusetzen und sollte vor der Anlage in Aktien bewahrt werden. Es wird aber auch die Frage gestellt, ob es neben dem politischen Argument, den Kleinanleger vor den negativen Folgen der Spekulation zu schützen, auch Interessen gegeben hat, die breite Masse der Bevölkerung von den Erträgen aus dem Produktionskapital fernzuhalten.[26]
Ein zentraler Nachteil des hohen Nennbetrages aus der Aktiennovelle von 1884 war ein deutig die Entfremdung der breiten Bevölkerung von der Aktie. Da nur noch kapitalkräftigen Individuen die Beteiligung am Produktionskapital in Form von Aktien möglich war, erhielt diese den Ruf eines Privilegs für Bessergestellte, welche dadurch allein in den Genuss von Profiten kamen und ihre Macht immer weiter ausbauen konnten. Dies führte zu einem zunehmenden Ungerechfigkeitsgefühl in großen Teilen der Gesellschaft.[27] Mit der Währungsreform von 1924 und der Einführung der Reichsmark wurde die, durch die Hy- perinfiafion illusorisch gewordenen, 1000 Mark Grenze durch kleinere Nennbeträge von mindestens 20 Reichsmark ersetzt.[28] Infolgedessen war die Akfie auch unter Besitzern mit kleinerem Geldvermögen zusehends verbreitet, u.a. weil sie in den Zeiten der Infiafi- on Wertbeständigkeit gezeigt hatte. Die Verbreitung im Volk fand mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten jedoch ein Ende. Der individuelle Aktionär, der ein eigenes Interesse an der Entwicklung seines Unternehmens hat, kollidierte mit der nafionalsozia- lisfischen Auffassung des Unternehmens, das eine ausgewiesene Rolle und besfimmte Aufgaben im Staat hat. Im Sinne des, nach 1933 propagierten, Führerprinzips hat es diese Aufgaben zu sichern, sodass die Wünsche von Akfionären keinen Platz mehr hatten. Um Akfiengesellschaften für Akfionäre unattrakfiv zu machen, wurde die Gewinnausschüttung begrenzt und die Sfimmrechte von Akfionären auf der Hauptversammlung beschnitten.[29] Daneben wurde der Mindestnennbetrag einer Akfie laut §8 des „Gesetz auf Akfiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Akfi'en" vom 30. Januar 1937 auf 1.000 Reichsmark heraufgesetzt.[30] Die erwünschte Wirkung des hohen Nennwertes wurde erreicht. 1934 gab es in Deutschland nur etwa 45.000 Personen, die ein Einkommen von über 20.000 Reichsmark hatten und für die ein Akfieninvestment überhaupt in Frage kam.[31] Nach dem zweiten Weltkrieg war mit der Einführung der Deutschen Mark eine Neubewertung von Vermögensgegenständen notwendig geworden. Im Zuge des DM-Bi- lanzgesetzes vom 21.8.1949 wurde schließlich wieder ein Mindestnennwert von 100 DM eingeführt.[32] Das DM-Bilanzgesetz war eine Übergangslösung, mit der Gesetz auf Akfiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Akfien von 1937 angepasst wurde. Ein eigenes Akfiengesetz bekam die Bundesrepublik erst 1966. In den Reformvorschlägen zum Akfiengesetz nach dem Krieg wurde einhellig zu niedrigen Nennbeträgen tendiert. Der Akfienbesitz sollte nicht mehr als Vorrecht der Reichen wahrgenommen werden, sondern in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Damit sollten einerseits die Arbeitnehmer aus einer sozialpolifischen Mofivafion heraus am Kapital der Unternehmen beteiligen werden. Andererseits sollte der darniederliegenden Wirtschaft auch die kleineren Beträge zur Finanzierung zur Verfügung und der Aktienmarkt belebt werden. Es gab Stimmen, die noch kleinere Nennbeträge forderten, weil es in ihren Augen den Unternehmen selbst überlassen sein sollte, ob sie den dafür notwendigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand auf sich nehmen wollten.[33]
III. Definition einerVolksakti'e
Die Volksaktie wird hier als Sonderform der Kleinaktie eingeführt und schließlich im zeitlichen Kontext definiert. In Deutschland gab es zwei Generationen der Volksaktie, die unter jeweils anderen Umständen emiffiert wurden.
Für die historische Betrachtung ist auf die jeweils geltenden Rechtsgrundlagen abzustellen. Ab 1937 ist dies das „Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz). Vom 30. Januar 1937"[34]. Gemäß §7 ist der Mindestnennbetrag der Aktiengesellschaft 500.000 Reichsmark und gemäß §8 der Mindestnennbetrag einer einzelnen Aktie 1.000 Reichsmark.[35] Da 1949 mit dem DM-Bilanzgesetz die 100 Mark-Aktie eingeführt wurde, war sie im Vergleich zu dem bisher vorherrschenden Mindestnennwert als Kleinaktie anzusehen. Die Kleinaktie ist nie rechtlich als solche kodifiziert worden, sondern kann immer nur als wirtschaftlicher Begriff betrachtet werden. Juristisch gilt für die Kleinaktie die gleiche Definition wie für jede andere Aktie auch. Sie verbrieft das anteilige Eigentum an einer Aktiengesellschaft und die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Pflicht ist, das Kapital in Form des Nennwertes beziehungsweise des Preises der Aktie zur Verfügung zu stellen. Recht sind die Beteiligung am Gewinn des Unternehmens in Form von Dividendenzahlungen und die teilweise Mitsprache auf der Hauptversammlung in einigen Punkten der Unternehmensführung. Die Pflicht, das heißt die unternehmerische Haftung, ist auf die Summe des Nennwertes beschränkt.[36] Das Recht ist ein Residualanspruch, denn der Aktionär als Eigentümer wird nur dann an einem Überschuss aus der Geschäftstätigkeit beteiligt, wenn die Ansprüche aller anderen Anspruchsberechtigten befriedigt sind. Das sind zum Beispiel Kunden, Lieferanten oder Kapitalgeber. Die Kleinak- tie ist spezifisch für den deutschen Sprach- und Wirtschaftsraum, da in anderen Wirtschaftsräumen meist keine Regelungen zum Nennwert zu finden sind oder dieser sehr niedrig festgesetzt ist. Eine sinnvolle Definition ergibt sich aus der Betrachtung des Zwecks der Kleinaktie. Sie ist ein regulärer Anteil an einer Gesellschaft, dient aber explizit dazu, Kapital von einem möglichst weiten Adressatenkreis innerhalb der Bevölkerung zu akquirieren. Diesen Käufern soll mit überschaubarem Risiko im Rahmen ihrer Sparmöglichkeiten das Engagement in eine Aktiengesellschaft und eine Teilhabe an deren Ertrag ermöglicht werden.[37] Zwei wichtige Formen der Kleinaktie sind die Belegschaftsaktie und die Volksaktie. Die Belegschaftsaktie wird von Arbeitnehmern aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses erworben. Entsprechend der Finanzkraft der Arbeitnehmer werden sie meist mit einem günstigen Nennbetrag beziehungsweise einem Rabatt auf den Ausgabekurs versehen.
Der Begriff der Volksaktie wurde Anfang 1957 in Österreich geprägt in Zusammenhang mit der teilweisen Reprivatisierung der verstaatlichten Creditanstalt - Bankenverein und der Österreichische Länderbank AG. Die Volksaktie war in diesem Fall eine Art Vorzugsaktie, welche kein Stimmrecht besaß, aber eine sechsprozentige Dividendengarantie beinhaltete. In Deutschland wurde die erste Volksaktie zwei Jahre später emiffiert. Der erste Börsengang dieser Art war die Preussische Bergwerks- und Hütten- AG, kurz Preußag, am 24. März 1959. Am 15. August 1961 folgte der Volkswagen-Konzern, vier Jahre später, am 9. August 1965, die Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks AG, kurz Veba.[38] Allen diesen Aktien war gleich, dass sie zu bevorzugten Konditionen ausgegeben wurden, die eine breite Verteilung innerhalb der Bevölkerung sicherstellen sollten. Es gab Anfang der sechziger Jahre Überlegungen, die Volksaktie als eigene Aktiengattung ins Aktiengesetz aufzunehmen.[39] Nachdem das nicht geschehen ist, muss eine Definition immer auf die Details der Emission von sogenannten Volksaktien beruhen. Bei der Definition der Volksaktie gilt es, diejenigen Aktien zu erfassen, die zu der Zeit als Volksaktien angesehen wurden und daraus eine gültige Definition herzuleiten.
Die zeitliche Unterscheidung wird notwendig, weil die Volksaktien der ersten Generation mit einer anderen politischen Motivation emiffiert wurden (siehe Kapitel IV) als die Volksaktien der zweiten Generation. Das waren in den fünfziger und -sechziger Jahren Preußag, Veba und VW als erste Generatìon. 1996 und 2000 die Deutsche Telekom und die Deutsche Post als zweite Generatìon. Dazu gehört auch Infineon, die jedoch einen Sonderfall darstellt. Infineon wurde als Volksaktìe angepriesen, unterschied sich aber von den andere, da es sich nicht um ein ehemaliges Staatsunternehmen handelte.
Neben der Motìvatìon unterscheiden sich die Generatìonen auch durch die rechtliche Grundlage. Anfang der sechziger Jahre galt das DM Bilanzgesetz, das den Mindestnennwert von 100 DM festlegte. Bei den Volksaktìen der zweiten Generatìon galt das deutsche Aktìengesetz, welches gemäß §410 am 1. Januar 1966 in Kraft getreten ist.[40] Gemäß des deutschen Aktìengesetzes muss eine Aktìe auf eine Gesellschaft mit einem Mindestnennbetrag des Grundkapitals von fünfzigtausend Euro lauten. Gemäß §8 AktG können diese Aktìen entweder als Nennbetragsaktìen oder Stückakfi'en begründet werden, die jeweils einen Wert von einem Euro nicht unterschreiten dürfen. Stückakfi'en lauten dabei auf keinen Nennbetrag beziehungsweise Nennwert, sondern ihr Wert ergibt sich aus dem Grundkapital im Verhältnis zur Anzahl der ausgegebenen Aktìen.[41] Damit hat sich ein großer Teil der Diskussion um die Volksaktìe, die Preisgestaltung für kleine Einkommen, er übrigt.
1. Das Volkswagenwerk und die Volksaktìen der ersten Generatìon
Gemeinsam ist den Volksaktìen der ersten Generatìon, dass es sich um Unternehmen im Staatsbesitz handelt, die privatìsiert oder teilprivatìsiert werden, indem sie in Aktìenge- sellschaften umgewandelt werden. Deren Aktìen wurden zu einem Nennwert von 100 DM ausgegeben, dem niedrigst möglichen Nennwert laut DM Bilanzgesetz von 1949. Damit wurde das Ziel verfolgt, eine möglichst weite Streuung der Aktìe innerhalb der Bevölkerung zu erreichen.[42] Diesem Ziel unterliegen alle Volksaktìen. Sie werden daher nur an natürliche Personen über 18 Jahren ausgegeben.[43] Es gibt ein ^chststìmmrecht und eine begrenzte Anzahl an Aktìen je Zeichnungsberechtìgtem. Die Konzentratìon vieler Aktìen und ein hohes Stìmmengewicht in einer Hand wird so beschränkt.[44] Für die Preussag war das Stìmmrecht auf ein Tausendstel des Grundkapitals beschränkt, unabhängig davon, wie viele Aktien jemand besaß.[45] Beim Volkswagenwerk hatte man ein Höchststimmrecht von einem Zehntausendstel eingerichtet und zusätzlich dazu die Vertretungsbefugnis auf der Hauptversammlung auf maximal zw ei Prozent beschränkt, sodass beispielsweise B anken, die Aktien in ihren Depots vertreten, keinen entscheidenden Einfluss bekommen konnten.[46] Bei der Teilprivatisierung der Veba wenige Jahre später sollte der übermäßige Einfluss Dritter ebenfalls durch eine Begrenzung auf ein Zehntausendstel beschränkt werden, ohne dass dadurch die Rechte der Kleinaktionäre[47] beschnitten würden.[48] Um ihrem Namen gerecht zu werden, muss sichergestellt sein, dass die Volksaktie auch in die Hände der breiten Bevölkerung gelangt. In allen Fällen wurde dies mit Hilfe einer Einkommensgrenze umgesetzt, im Fall von VW zusätzlich mit der Hilfe von Sozialrabatten.[49] So konnten die Aktien der Preußag nur von Beschäftigten oder von Menschen mit einem Ein kommen unter 8000 DM gezeichnet werden, bei Verheirateten waren es 16000 DM. Außerdem war die Anzahl der zu erwerbenden Aktien auf fünf beziehungsweise 500 DM Nennwert pro Person beschränkt.[50] Die Sozialrabatte im Fall von Volkswagen gestalteten sich dergestalt, dass Menschen mit den eben genannten Einkommensgrenzen hier einen Rabatt von zehn Prozent auf den Ausgabekurs erhielten. Wer weniger verdiente - Alleinstehende 6000 DM, Verheiratete 12000 DM - erhielt gar einen Nachlass von zwanzig Prozent. Die Rabatte erhöhten sich außerdem um fünf Prozentpunkte, wenn drei oder mehr Kinder unter 18 Jahren in dem Haushalt lebten. Außerdem war auch hier der maximale Nennwert an Aktien, die eine Person erwerben konnte, auf 500 DM beschränkt, bei Beschäftigten war es 1000 DM. Wegen der immensen Nachfrage wurden schließlich nur vier Aktien je Preußag-Zeichner und zwei oder drei je Volkswagen-Zeichner zugeteilt.[51] Als 1965 die Zeichnungsfrist für Aktien der Veba begann, hatte man die Einkommensgrenze auf 14000 DM erhöht. Jedoch wurde hier eine Staffelung eingerichtet, sodass diejenigen bei der Zuteilung bevorzugt wurden, die unter 8000 DM und dann unter 11000 DM verdienten, bei Verheirateten das Doppelte. Auch hier war wieder eine maximale Zuteilung von fünf Aktien vorgesehen, was aufgrund der hohen Nachfrage jedoch nicht erreicht wurde.[52] Um die genannten Beträge bewerten zu können, bietet sich ein Vergleich mit den üblichen Einkommen dieses Zeitraums an. Das monatliche Netto-Haushaltseinkom- men eines Arbeiters betrug I960 683 DM, das eines Angestellten- oder Beamtenhaushaltes im selben Jahr 804 DM.[53] Die Verteilung ist in Abbildung 1 zu erkennen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Vergleich der monatlichen Netto-Ein- kommen in der BRD um I960.
Quelle.: Nöldner, Klaus, Die Volksaktie (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialkunde, Reihe A, Heft 3), Opladen 1966, S. 12.
Interessant ist diesbezüglich die offizielle Jahressparleistung, die zu der Zeit bei einem Arbeiter 115 DM und bei einem Angestellten oder Beamten 145 DM betrug. Ein Großteil des verfügbaren Einkommens musste also zur allgemeinen Lebensführung aufgewandt werden. Die Sparleistung, die darüber hinaus noch möglich war, wurde oftmals für kurzfristige Konsumausgaben verwendet wie eine Ferienreise oder einen Fernsehapparat. De mentsprechend musste der Anreiz zur Eigentumsbildung mit der Sparleistung einhergehen, d.h. die Volksaktien mussten zu einem niedrigen Kurs ausgegeben werden, der mög- liehst großen Teilen der Bevölkerung das Aktìensparen ermöglicht.[54] Für die Preußag war ein möglicher Ausgabekurs von 140 bis 180 DM errechnet worden. Der tatsächliche Kurs wurde schließlich auf 145 DM festgelegt. Bei der Emission der Volkswagen-Aktìe 1961 wurde bei einem Nennwert von 100DM ein Ausgabepreis von 350 DM festgelegt. Dieser wurde also so niedrig angesehen, dass die Aktìen mit 85 Prozent überzeichnet wurden.[55] Wer den Sozialrabatt in voller Höhe für si ch i n A nspruch nehmen konnte, bekam die A ktìen sogar für 262,5 DM. Ein weiterer zentraler Punkt zur Defìnitìon der Volksaktìe ist eine stetìge Wertentwicklung, die dem Bürger, der in Volksaktìen investìert, einen Vermögenserhalt und Zuwachs ermöglichen soll. Das Aktìeninvestment fiel unter das Sparprämiengesetz, wenn man die Anlage mindestens fünf Jahre hielt.[56] Spekulatìonen sollten so vermieden, die Bürger zum Sparen und zum langfristìgen Vermögensauftau angeregt werden. Unter anderem in der Presse wurde das Bild vermittelt, dass es sich bei dem Aktìen- engagement um eine Form des sicheren Sparens handelt. Gewinnchancen wurden disku- tìert, Risiken blieben in der Regel unerwähnt. Es wurde bei den neuen Aktionären von „Volkssparern" gesprochen, was einen starken Fokus aufs Sparen setzt und so eine Ähnlichkeit mit dem Sparbuch impliziert.[57] Zur Emission gehörten auch jedes Mal umfangreiche Werbekampagnen in Rundfunk und Zeitungen[58], in Form von Postwurfsendungen[59] oder in eigenen Werbefilmen[60], welche die Bürger zum Aktìensparen animieren sollten. Hinzu wurde das Vorhaben von der Politìk öffentlich unterstützt. Der Schatzministers Werner Dollinger pries z.B. die Preußag-A^'e als „gutes und sicheres Papier für eine lang- fristìge Kapitalanlage"[61] an. Die Ausrichtung der Aktìenemission auf Jedermann trug neben der unterstützenden Aussagen der Politìk dazu bei, dass die Volksaktìe in der Bevölkerung als sichere Anlage angesehen wurde.
[...]
[1] Erhard, Ludwig, Der Bürger auf dem Kanapee?, in: Der Spiegel, Nr. 28,1957
[2] Vgl. Nöldner, Klaus, Die Volksaktie (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialkunde, Reihe A, Heft 3), Opladen 1966, S. 5
[3] Erhard, Der Bürger auf dem Kanapee?
[4] Ebd.
[5] Hartmann-Wendels, Thomas, Von der Volksaktie zur Altersvorsorge - eine Chronologie, in: Kreditwesen, Nr. 13, 2008, S. 10ff., hier S. 11.
[6] Vgl. Irwin, Dougls A., Mercantilism as Strategic Trade Policy: The Anglo-Dutch Rivalry for the East India Trade, in: The University of Chicago Press (Hg.), The Journal of Political Economy, Bd. 99, Nr. 6, Chicago 1991, S.1296-1314, hier S. 1299.
[7] Vgl. Ferrari, Hilger, Volksaktie - Ausdruck der Zeit, Bad Godesberg 1960, S. 5-7.
[8] Vgl. Ebd., S. 8-10.
[9] Vgl. Gelderblom, Oscar/Jonker, Joost, Completing a financial revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market (1595-1612), in: Cambridge University Press (Hg.), The Journal of Economic History, Bd. 64, Nr. 3, New York 2004, S. 641-672, hier S. 648.
[10] Vgl. Ebd., S. 645.
[11] Vgl. Irwin, The Journal of Political Economy, Bd. 99, Nr. 6, S. 1299.
[12] Vgl. Gelderblom/Jonker, The Journal of Economic History, Bd. 64, Nr. 3, S. 649.
[13] Vgl. Irwin, The Journal of Political Economy, Bd. 99, Nr. 6, S. 1299.
[14] Vgl. Gelderblom/Jonker, The Journal of Economic History, Bd. 64, Nr. 3, S. 649.
[15] Vgl. Ferrari, Volksaktie, S. 14-15.
[16] Vgl. Fabri, Theodor, Die Kleinaktie, in: Beste, Theodor (Hg.), Abhandlungen aus dem Industrieseminar zu Köln, Heft 8, Berlin 1959, S. 16.
[17] Vgl. Ebd. S. 20.
[18] Kindleberger, Charles P., Manien, Paniken, Crashs. Die Geschichte der Finanzkrisen dieser Welt, Kulmbach 2001, S. 281.
[19] John Law gründete 1716 die spätere Staatsnotenbank Banque Générale in Paris, die erstmals in großen Umfang anerkanntes Papiergeld einführte. Der Versuch die französische Staatsschuld durch Papiergeldüberfluss zu mindern führte 1720 zur ersten Papiergeldinflation. [Vgl. o.V., Artikel John Law, in: Meyers Taschenlexikon, Bd. 6, Mannheim 1996, S.1982.].
[20] Fabri, Kleinaktie, S. 20.
[21] Vgl. Ebd., S. 21.
[22] Vgl. Ferrari, Volksaktie, S. 22f.
[23] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 23.
[24] Bei Inhaberaktien ist der legitime Eigentümer die innehabende Person. m Gegensatz zu Namensaktien, deren legitimer Eigentümer ein namentlich festgelegter Aktionär ist. [Vgl. Prätsch, Joachim/Schikorra, Uwe/ Ludwig, Eberhard, Finanzmanagement, 3. Aufl., Berlin Heidelberg 2007, S. 41].
[25] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 26.
[26] Vgl. Ebd. S. 27f.
[27] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 29.
[28] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 35.
[29] Ebd. S. 42.
[30] Vgl. O.V., Reichsgesetzblatt, S. 107.
[31] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 45.
[32] Vgl. Ebd.
[33] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 48f.
[34] Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien vom 30.1.1937, in Reichsgesetzblatt Teil 1, Berlin 1937, S. 107ff., hier S. 107.
[35] Vgl. Ebd.
[36] Die Haftungssumme kann vom Nennwert abweichen, da der Aktionär beim Erwerb entweder den Börsenpreis bezahlt bzw. bei der Emission den Emissionspreis. Der Überschuss, der die Summe der Nennwerte übersteigt findet sich in der Bilanz in der Kapitalrücklage und steht damit auch als Haftungsmasse zur Verfügung.
[37] Vgl. Fabri, Kleinaktie, S. 12f.
[38] Hackhausen, Jörg, Die traurige Geschichte der Volksaktie, online verfügbar: http://www.handelsblatt.com/archiv/von-preussag-bis-telekom-die-traurige-geschichte-der-volksaktie/314 1292.html?slp=false&p=2&a=false#image, Zugriff am 28.08.2011.
[39] Vgl. Hartmann-Wendels, in: Kreditwesen, Nr. 13, Jg. 2008, S. 10ff.
[40] Vg. Hüffner, Uwe, Aktiengesetz, 7. Aufl., München 2006, S. 1728
[41] Vgl. Hüffer, Aktiengesetz, S. 36-39.
[42] Vgl. Nöldner, Wirtschafts- und Sozialkunde, S. 11.
[43] Ebd.
[44] Vgl. Hartmann-Wendels, in: Kreditwesen, Nr. 13, Jg. 2008, S. 13.
[45] Vgl. O.V., Privatisierung der Preußischen Bergwerks- und Hütten AG, Hannover (Preußag), in: Kabinettsprotokolle, 14. Sitzung am 2.4.1959, online verfügbar: http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/1000/x/x1958e/kap1_2/kap2_12/para3_3.html, Zugriff am 9.9.2012.
[46] Vgl. Nöldner, Wirtschafts- und Sozialkunde, S. 12.
[47] Kleinaktionäre ist hier nicht auf die oben definierte Kleinaktie zu beziehen, sondern bezeichnet Aktionäre mit einem kleinen Stimmrechtsanteil. Wer viele Kleinaktien besitzt, ist demnach ein Großaktionär.
[48] Vgl. o.V., Teilprivatisierung der Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerks-Aktiengesellschaft (VEBA), in: Kabinettsprotokolle, 141. Sitzung am 28.10.1964, online verfügbar: http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/k/k1964k/kap1_2/kap2_42/para3_6.html, Zugriff am 9.9.2012.
[49] Vgl. Hartmann-Wendels, in: Kreditwesen, Nr. 13, Jg. 2008, S. 13.
[50] Vgl. Peter, Stefanie, Preussag: Vom Staatskonzern zum Privateigentum, online verfügbar: http://www.ndr.de/geschichte/chronologie/fuenfzigerjahre/preussag100.html, Zugriff am 28.8.2012.
[51] Vgl. Nöldner, Wirtschafts- und Sozialkunde, S. 13.
[52] Vgl. o.V., Teilprivatisierung, in: Kabinettsprotokolle, 141. Sitzung am 28.10.1964.
[53] Vgl. Göseke, G./Bedau, K.-D., Verteilung und Schichtung der Einkommen der privaten Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland (1950-1975), Berlin 1974, online verfügbar: http://www.histat.gesis.org/ShowTimeSeries.php?show_hs=02C6D56374B5028AFBBEBAFD40ACC236&add _hs_x=1, Zugriff am 11.09.2012.
[54] Vgl. Nöldner, Wirtschafts- und Sozialkunde, S. 13.
[55] Vgl. Hartmann-Wendels, in: Kreditwesen, Nr. 13, Jg. 2008, S. 11.
[56] Vgl. o.V., Entwurf eines Gesetzes über die Regelung der Rechtsverhältnisse bei der Volkswagen GmbH und die Überführung der Anteilsrechte in private Hand, in: Kabinettsprotokolle, 14. Sitzung am 2.4.1959, online verfügbar: http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/10007x/x1958e/kap1_2/kap2_12/para3_3.html, Zugriff am 9.9.2012.
[57] Vgl. o.V., VW-Aktìen: Schnell auf Touren, in: Der Spiegel, Nr. 13,1961, S. 25-26.
[58] Vgl. Peter, Vom Staatskonzern zum Privateigentum, www.ndr.de.
[59] Vgl. o.V., VW-Aktìen: Spekulanten heraus, in: Der Spiegel, Nr. 40,1960, S. 43-44, hier S.43.
[60] Vgl. Sommer, Ulf, Veba als Lehrbeispiel: Ein Volk macht in Aktìen, online verfügbar: http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/boerse-inside/veba-als-lehrbeispiel-ein-volk-mach t-in-aktìen-seite-all/2580912-all.html, Zugriff am 28.8.2012
[61] Dollinger, Werner, zit. nach: Hackhausen, Die traurige Geschichte, www.handelsblatt.de.
-

-
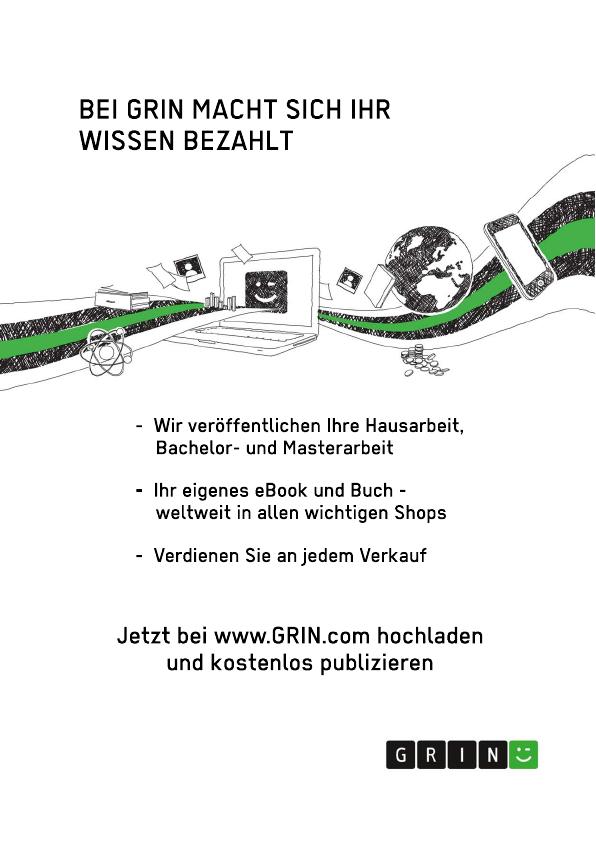
-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.

