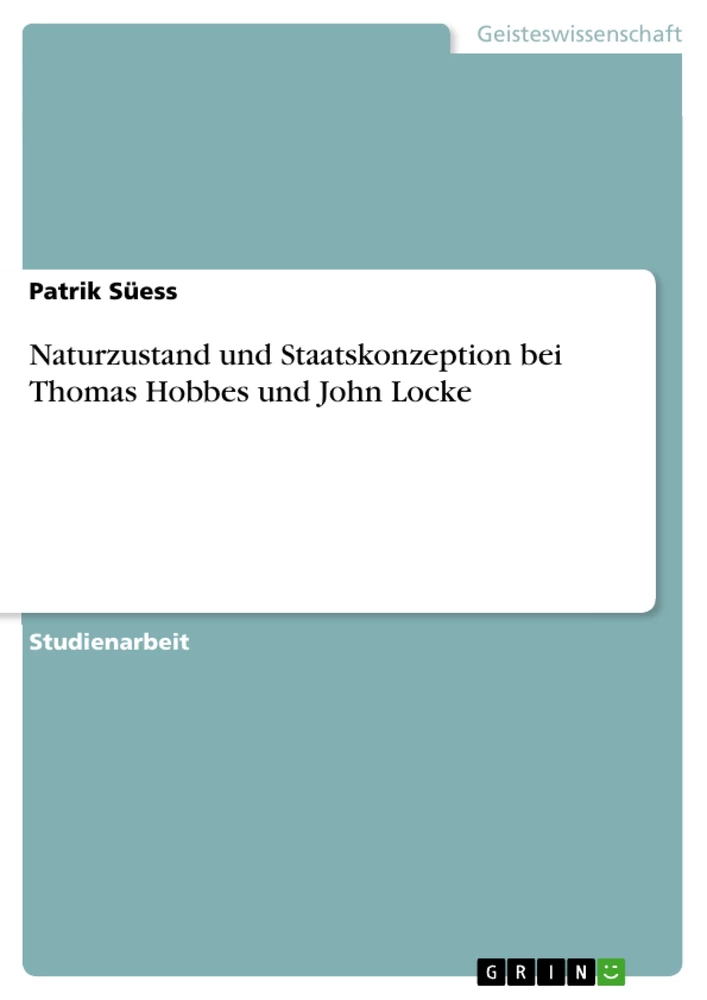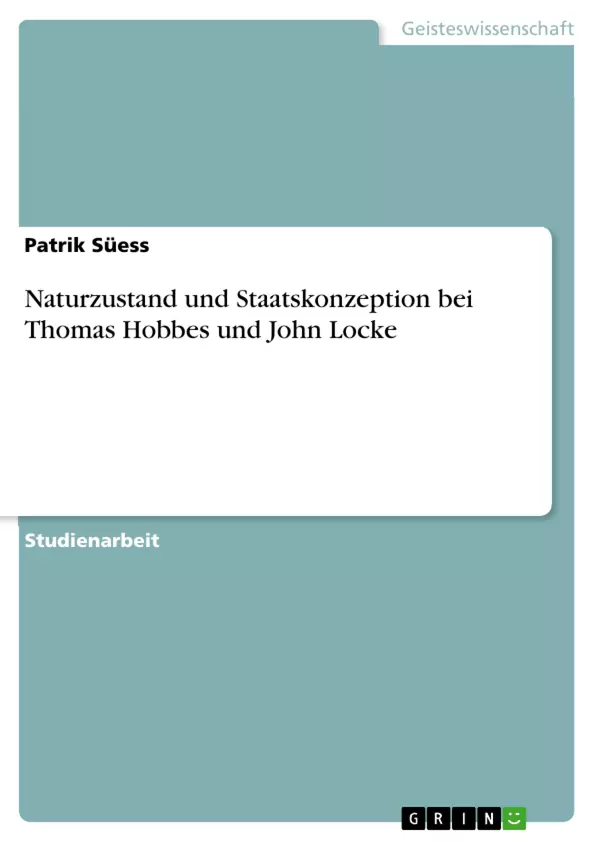Sowohl Thomas Hobbes (1588 – 1679) als auch John Locke (1632 – 1704) haben in ihren politiktheoretischen Hauptschriften (Hobbes: Leviathan, Locke: Second Treatise of Civil Government) zu begründen versucht, warum sich Menschen staatlich organisieren bzw. warum sie es tun sollten.
Das Ziel beider Theorien besteht in der Legitimation staatlicher Herrschaft, d.h. der normativen Begründung dafür, warum es geboten und rational ist, sich Institutionen zu unterwerfen, die die eigene Freiheit beschränken.
Wie sich bereits aus dieser Ausgangslage ersehen lässt, wenden sich beide Theorien an rationale, mündige, d.h. entscheidungsfähige Individuen; keine höhere Macht kann staatlich geforderte Freiheitsbeschränkung einfach anordnen, es geht um freiwillige Unterziehung unter einen staatlichen Zwangszusammenhang.
Diese Freiwilligkeit manifestiert sich in beiden Werken im theoretischen Konstrukt des Vertrages – legitim ist eine staatliche Ordnung dann, und nur dann, wenn sich rationale Individuen aus eigener Einsicht und gemeinsam diesen staatlichen Regeln unterwerfen würden.
Sowohl Hobbes wie Locke müssen also Überzeugungsarbeit leisten. Denn warum sollte ich freiwillig auf Freiheiten verzichten, die mir möglicherweise vorteilhaft erscheinen oder immerhin Freude bereiten könnten? Beide argumentieren für diese Verzichtleistung, indem sie einen hypothetischen Zustand einführen, in dem sämtliche (uns meist zumindest in Ansätzen bekannten) institutionell bzw. staatlich verankerten Regeln nicht gelten, einen Zustand also, in dem die Menschen ohne Bindung an positives Recht und Gesetze leben und indem sie dann beschreiben, wie diese Welt ihrer Meinung nach aussehen würde. Diesen staatslosen Zustand nennen sie Naturzustand. Dabei führen sie uns vor Augen, was in einem solchen Zustand fehlen würde, was uns letztlich fehlen würde, und warum es für uns (d.h. für jedes einzelne Individuum) rational wäre, sich aus diesem Naturzustand mithilfe staatlicher Regelungen zu befreien. Und da wir diesen Naturzustand aus rationaler Einsicht verlassen und in die staatlich-bürgerliche Ordnung wechseln würden, handelten wir freiwillig; immer vorausgesetzt, die anderen würden dasselbe auch tun!
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung
- Einleitung
- Der Naturzustand bei Hobbes
- Der Naturzustand bei Locke
- Zwischenfazit
- Der Staat bei Hobbes
- Der Staat bei Locke
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Naturzustandskonzeptionen von Thomas Hobbes und John Locke und beleuchtet die daraus resultierenden Konsequenzen für den Bürger. Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede in den beiden Philosophen zu verstehen und die Auswirkungen ihrer Denkansätze auf die Legitimation staatlicher Herrschaft zu beleuchten.
- Das Menschenbild und die Natur des Menschen im Naturzustand
- Die Rolle der Vernunft und der Freiheit im Naturzustand
- Die Notwendigkeit und die Art der staatlichen Ordnung
- Die Auswirkungen des Naturzustands auf die Lebensbedingungen des Bürgers
- Die Legitimation von Staat und Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Naturzustandstheorien von Hobbes und Locke ein und stellt die zentrale Frage nach der Legitimation staatlicher Herrschaft. Das erste Kapitel erläutert die naturphilosophische Grundlage von Hobbes' Naturzustand. Es werden die zentralen Elemente des Menschenbildes und die daraus resultierende Vorstellung von einem Krieg aller gegen alle beschrieben. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Lockes Naturzustandskonzeption. Im Gegensatz zu Hobbes sieht Locke im Menschen ein natürliches Recht auf Freiheit und Eigentum. Das Zwischenfazit fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen Hobbes und Locke zusammen und stellt die unterschiedlichen Konsequenzen für den Bürger heraus.
Die folgenden Kapitel behandeln die Staatskonzeptionen von Hobbes und Locke. Es wird erläutert, wie beide Philosophen die Notwendigkeit einer staatlichen Ordnung begründen und welche Art von Staat sie für ideal halten. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Bedeutung der Naturzustandstheorien für die moderne politische Philosophie.
Schlüsselwörter
Naturzustand, Staat, Herrschaft, Legitimation, Menschenbild, Vernunft, Freiheit, Eigentum, Krieg, Vertrag, Bürger, Hobbes, Locke, Leviathan, Second Treatise of Civil Government.
Häufig gestellte Fragen
Was verstehen Hobbes und Locke unter dem "Naturzustand"?
Es handelt sich um ein theoretisches Konstrukt eines staatslosen Zustands ohne Gesetze. Während Hobbes ihn als "Krieg aller gegen alle" beschreibt, sieht Locke ihn als Zustand natürlicher Freiheit und Gleichheit.
Warum ist der Staatsaustritt aus dem Naturzustand rational?
Bei Hobbes dient er der Selbsterhaltung und Sicherheit vor Gewalt. Bei Locke dient der Staat primär dem Schutz des natürlichen Rechts auf Eigentum, Leben und Freiheit.
Wie unterscheiden sich die Menschenbilder der beiden Philosophen?
Hobbes sieht den Menschen als egoistisches Wesen, das von Furcht getrieben ist. Locke sieht den Menschen als vernunftbegabt und an ein natürliches moralisches Gesetz gebunden.
Welche Rolle spielt der "Vertrag" in ihren Theorien?
Der Vertrag ist das Mittel zur Legitimation staatlicher Herrschaft. Er basiert auf der freiwilligen Zustimmung rationaler Individuen, ihre Freiheit zugunsten einer Ordnung zu beschränken.
Welche Staatsform resultiert aus ihren Überlegungen?
Hobbes begründet den absoluten Staat (Leviathan), während Locke die Grundlage für den liberalen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung legt.
- Quote paper
- Patrik Süess (Author), 2014, Naturzustand und Staatskonzeption bei Thomas Hobbes und John Locke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299782