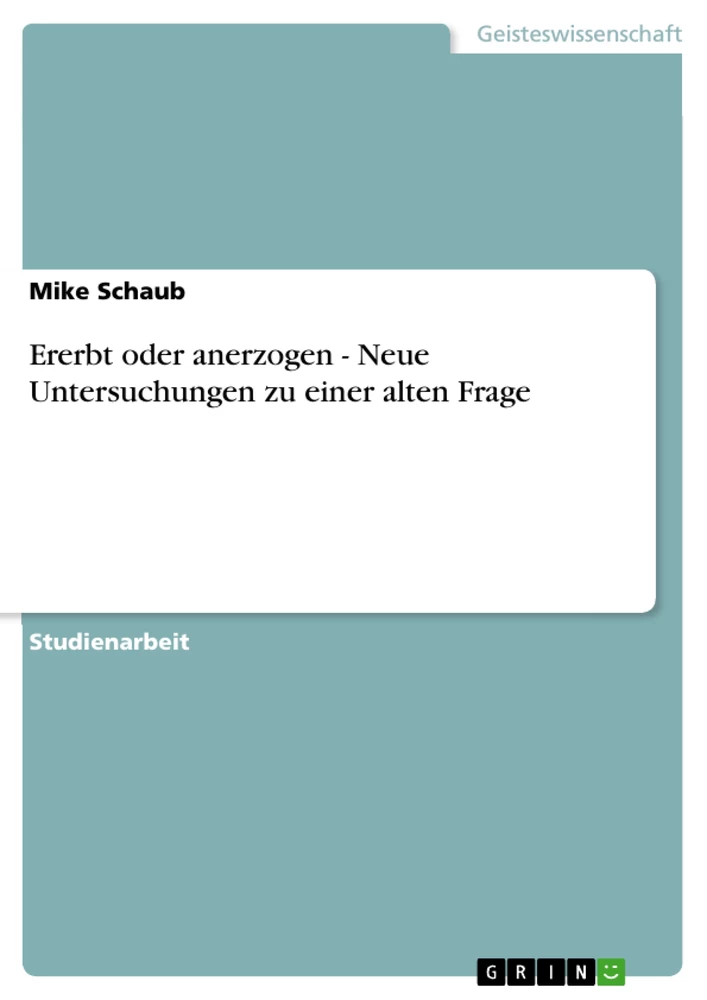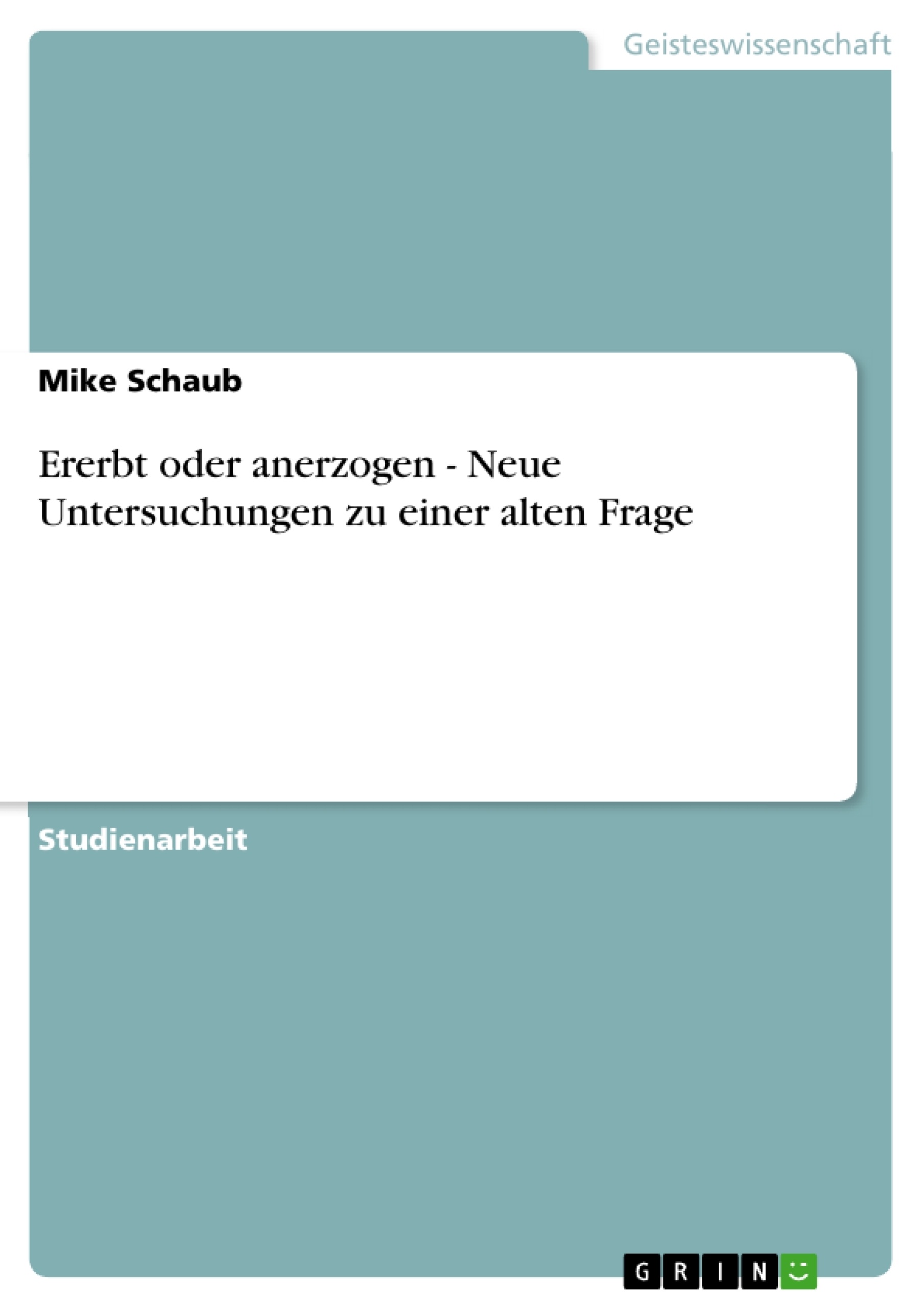In den vergangen Jahrzehnten haben die Sozialwissenschaften die Schuld an mangelhaft erzogenen Kindern den Eltern in die Schuhe geschoben. Die Sozialwissenschaften gingen grundsätzlich davon aus, das Kultur durch die Familie weitervererbt, beziehungsweise weitergegeben wird. Dies hat zur Folge, dass sich Eltern zu viel auf im späteren Leben gesellschaftlich gut herausgekommene Kinder einbilden, respektive sich zu schuldig für missratene Kinder fühlen. Erst die Zwillings- und Adoptionsforschung aus der Genetik sowie Forschungen, welche von einem dynamisch-interaktionistischen Ansatz ausgehen, brachten Licht in die Erziehungs-Vererbungs-Problematik. Die vorliegende Arbeit vermittelt nun ausgehend von den verschiedenen Erklärungsansätzen, von Freuds Theorien bis zu den dynamisch-interaktionistischen Sichtweisen, mögliche Erklärungsansätze dazu. Dabei wird schlussgefolgert, dass in Zukunft vor allem von der Molekulargenetik her noch spezifischere und detailliertere Ergebnisse zu der Ausgangsfrage erwartet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen
- 2.1 Theorie Freuds
- 2.2 Frühe behavioristische Ansätze
- 2.3 Soziale Lerntheorie
- 2.4 Das Eigenschaftsparadigma
- 2.5 Das dynamisch-interaktionistische Paradigma
- 2.5.1 Das Kodeterminationsmodell
- 2.5.2 Das Katapultmodell
- 3 Zwillings- und Adoptionsforschung_ Das Bindeglied zwischen der Persönlichkeit, dem Genom und der Umwelt_
- 4 Die Molekulargenetik
- 5 Exkurs: Die Antisoziale Persönlichkeit
- 6 Koevolutionäres Denken: wie Meme die Gene überholen
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Frage „ererbt oder anerzogen?“ anhand des aktuellen Forschungsstandes zu beantworten. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs der Persönlichkeit sowie die Interaktion zwischen Genom, Umwelt und Persönlichkeit, wobei die drei zentralen Paradigmen der Sozialisationsforschung, der genetischen Forschung und der Persönlichkeitsforschung erörtert werden.
- Die Entwicklung der Konzepte von Umwelt, Persönlichkeit und Genom aus verschiedenen Paradigmen
- Die Rolle der Genetik in der Persönlichkeitsforschung, insbesondere die Zwillings- und Adoptionsforschung sowie die Molekulargenetik
- Die Verbindung von genetischen und umweltbedingten Faktoren in der Entwicklung der Persönlichkeit
- Der Einfluss der Antisozialen Persönlichkeit auf antisoziales Verhalten
- Die Bedeutung des koevolutionären Denkens für die Interaktion von Genom und Umwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Fragestellung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt die Grundlagen der Sozialisationsforschung, wobei die drei zentralen Paradigmen der Freudschen Psychoanalyse, der frühen behavioristischen Ansätze und der Sozialen Lerntheorie vorgestellt werden. Anschliessend werden das Eigenschaftsparadigma und das dynamisch-interaktionistische Paradigma erörtert, die den Fokus auf die Persönlichkeit und deren Interaktion mit Genom und Umwelt richten.
Kapitel 3 widmet sich der Zwillings- und Adoptionsforschung, die wertvolle Erkenntnisse über den Einfluss von Genetik und Umwelt auf die Entwicklung der Persönlichkeit liefert. Kapitel 4 erläutert die Grundlagen der Molekulargenetik und deren Bedeutung für die Erforschung der genetischen Basis von Verhaltensmerkmalen.
Kapitel 5 beleuchtet die Antisoziale Persönlichkeit und deren Einfluss auf antisoziales Verhalten in der Kriminologie. Kapitel 6 widmet sich dem koevolutionären Denken und der Frage, wie Meme die Gene beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Schlüsselbegriffen wie Sozialisation, Persönlichkeit, Genom, Umwelt, Zwillingsforschung, Adoptionsforschung, Molekulargenetik, Antisoziale Persönlichkeit, koevolutionäres Denken, Meme, Freudsches Paradigma, behavioristische Ansätze, Soziale Lerntheorie, Eigenschaftsparadigma, dynamisch-interaktionistisches Paradigma, Kodeterminationsmodell, Katapultmodell.
Häufig gestellte Fragen
Wird die Persönlichkeit eher vererbt oder durch Erziehung geprägt?
Die moderne Forschung zeigt, dass es eine komplexe Interaktion zwischen Genom und Umwelt gibt. Weder Genetik noch Erziehung allein bestimmen die Persönlichkeit.
Welche Rolle spielt die Zwillingsforschung in dieser Debatte?
Zwillings- und Adoptionsstudien sind das Bindeglied, um den Anteil genetischer Faktoren an Persönlichkeitsmerkmalen im Vergleich zu Umwelteinflüssen zu isolieren.
Was ist das "dynamisch-interaktionistische Paradigma"?
Es geht davon aus, dass Mensch und Umwelt sich gegenseitig beeinflussen (Kodetermination), wobei genetische Anlagen die Reaktion auf Umwelteinflüsse steuern.
Was erwartet die Wissenschaft von der Molekulargenetik?
Man erhofft sich spezifischere Ergebnisse darüber, welche Gene konkret für bestimmte Verhaltensmerkmale oder psychische Dispositionen verantwortlich sind.
Was versteht man unter "koevolutionärem Denken"?
Es beschreibt die Theorie, dass kulturelle Informationen (Meme) die biologische Evolution (Gene) beeinflussen und teilweise sogar überholen können.
- Quote paper
- Dr. phil. Mike Schaub (Author), 2002, Ererbt oder anerzogen - Neue Untersuchungen zu einer alten Frage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2998