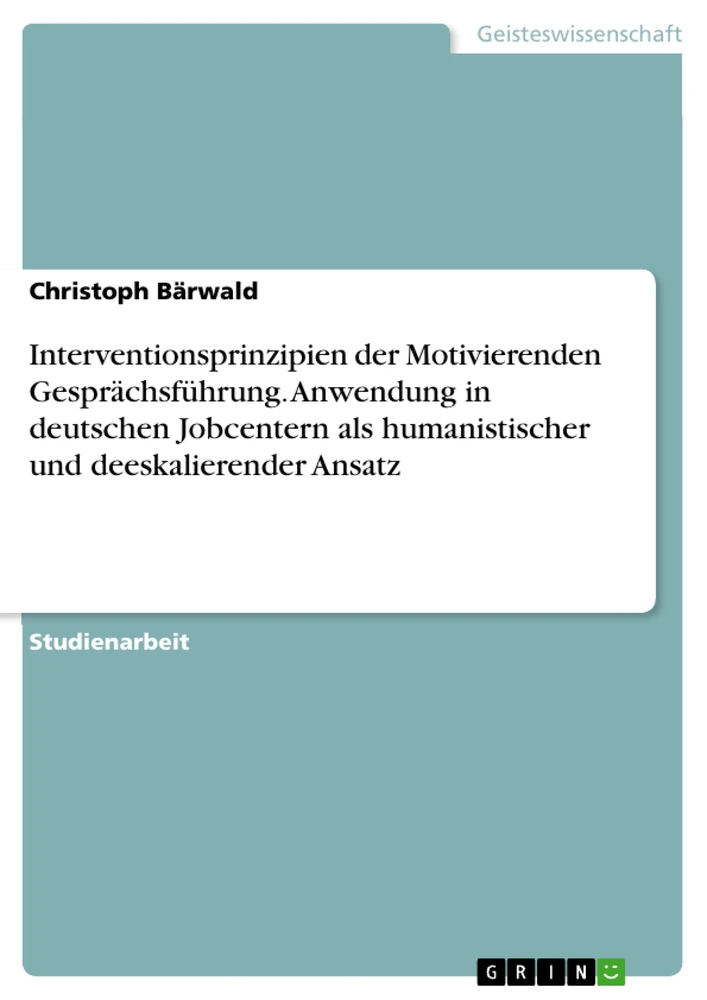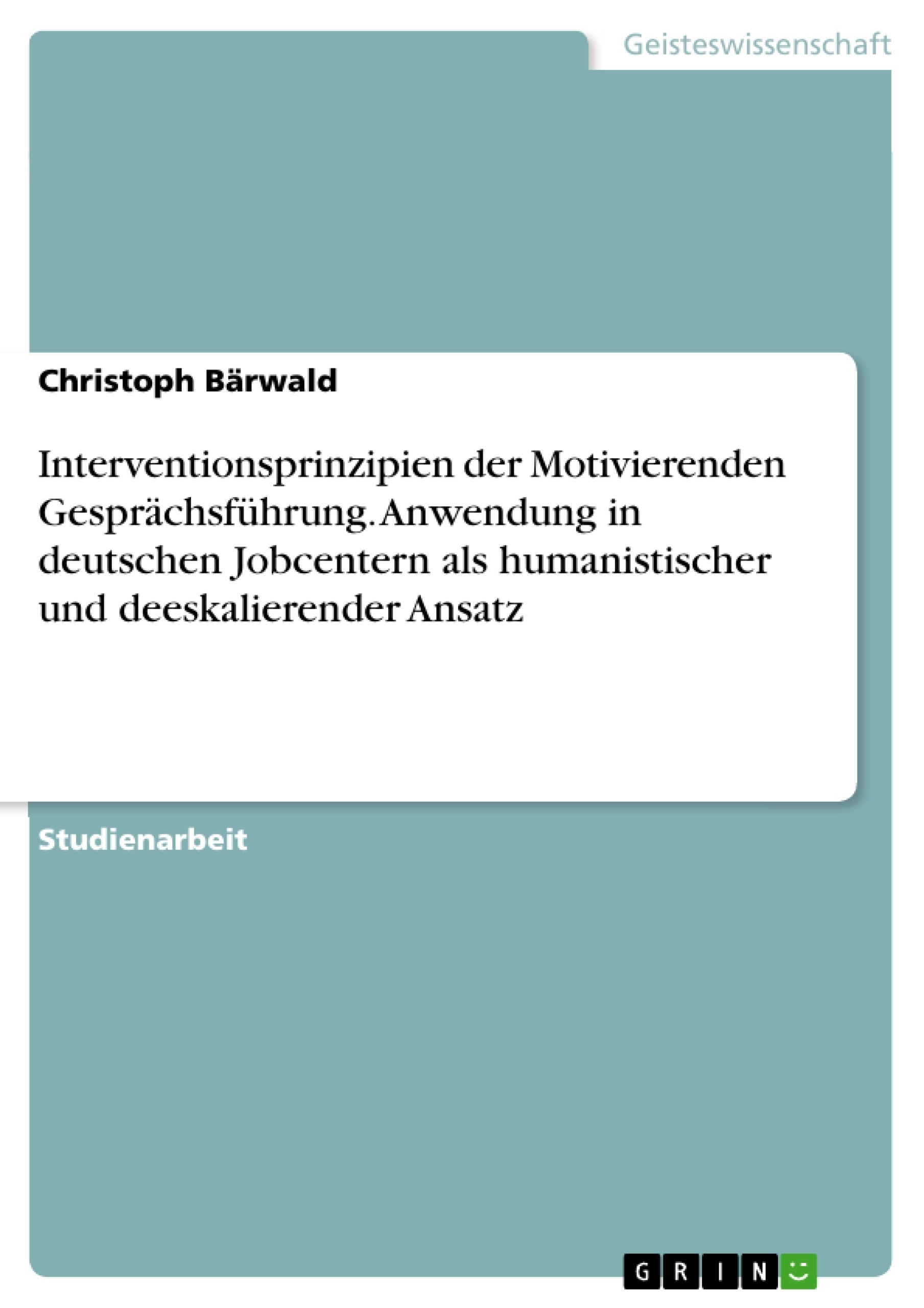Ursprünglich wurde die Motivierende Gesprächsführung (MG) für „Hard-to-Reach“-Klientel aus dem Setting der Suchthilfe entwickelt. Mittlerweile fand die MG Einzug in die verschiedensten sozialen, psychischen und psychiatrischen Fachbereiche. Die Methode der MG vermittelt wertvolles praktisches Wissen, wie eine konstruktive Beziehungsgestaltung zu „Hard-to-Reach“-Klienten gelingen kann. Sie zeigt praxisorientiert auf, wie Fachkräfte ihre Unterstützerrolle adäquat ausfüllen und gestalten können, sodass sinnvolle Veränderungen möglich werden.
Die Begründer, MILLER & ROLLNICK, definieren die MG „als eine klientenzentrierte, direktive Methode zur Verbesserung der intrinsischen Motivation für eine Veränderung mittels Erforschung und Auflösung von Ambivalenz.“
Die MG ist nicht nur als ein Gesprächsstil zu interpretieren, sondern als eine therapeutische Grundhaltung. Ihre Leitmotive der Autonomie, Kooperation und Evokation lassen eine schlüssige beraterisch-therapeutische Grundeinstellung entstehen. Diese Leitmotive finden innerhalb der Praxis ihren Ausdruck in den vier grundlegenden Interventionsprinzipien der MG.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die vier Basisprinzipien der MG prägnant in ihrem Grundverständnis zu erfassen und im Kontext von Langzeitarbeitslosigkeit im Setting deutscher Jobcenter zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundsätze der Motivierenden Gesprächsführung
- Empathie ausdrücken
- Diskrepanzen entwickeln
- Widerstand aufgreifen/umlenken
- Selbstwirksamkeit fördern
- Beispiel ,,Inge Hannemann”
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die vier grundlegenden Interventionsprinzipien der Motivierenden Gesprächsführung (MG) und erläutert deren Bedeutung im Kontext von Langzeitarbeitslosigkeit im Setting deutscher Jobcenter. Die Arbeit zielt darauf ab, das theoretische Fundament der MG im Kontext der Arbeit mit „Hard-to-Reach“-Klienten darzulegen.
- Empathie als Basis für eine konstruktive Beziehungsgestaltung
- Aufzeigen von Diskrepanzen zwischen dem Ist- und Soll-Zustand
- Umgang mit Widerstand und dessen Umleitung in konstruktive Energie
- Fokus auf die Förderung der Selbstwirksamkeit von Klienten
- Die Anwendung der MG im Kontext der Arbeitslosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Motivierende Gesprächsführung (MG) als humanistischen und deeskalierenden Ansatz ein und erklärt deren Entwicklung und Anwendung in verschiedenen Fachbereichen. Sie stellt die vier grundlegenden Interventionsprinzipien der MG vor, die in den folgenden Kapiteln näher betrachtet werden.
- Grundsätze der Motivierenden Gesprächsführung: Dieses Kapitel beleuchtet die vier Interventionsprinzipien der MG: Empathie ausdrücken, Diskrepanzen entwickeln, Widerstand aufgreifen/umlenken und Selbstwirksamkeit fördern. Es werden die theoretischen Grundlagen jedes Prinzips erklärt und Anwendungsbeispiele für die Arbeit mit Langzeitarbeitslosen skizziert.
- Beispiel ,,Inge Hannemann”: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Beispiel für die Anwendung der MG im Kontext der Langzeitarbeitslosigkeit. Es zeigt, wie die Interventionsprinzipien in der Praxis umgesetzt werden können und welche Herausforderungen und Chancen sich dabei ergeben können.
Schlüsselwörter
Motivierende Gesprächsführung, Empathie, Diskrepanzen, Widerstand, Selbstwirksamkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, Jobcenter, „Hard-to-Reach“-Klienten, klientenzentriert, direktiv, Ambivalenz, Veränderung, Autonomie, Kooperation, Evokation, Beziehungsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Motivierende Gesprächsführung (MG)?
MG ist eine klientenzentrierte, direktive Methode nach Miller & Rollnick zur Verbesserung der intrinsischen Motivation durch die Auflösung von Ambivalenzen.
Welche vier Interventionsprinzipien kennzeichnen die MG?
Die Basisprinzipien sind: Empathie ausdrücken, Diskrepanzen entwickeln, Widerstand aufgreifen/umlenken und Selbstwirksamkeit fördern.
Warum ist MG in deutschen Jobcentern sinnvoll?
Sie bietet einen humanistischen und deeskalierenden Ansatz für die Arbeit mit „Hard-to-Reach“-Klienten (Langzeitarbeitslosen), um konstruktive Veränderungen anzustoßen.
Was bedeutet „Diskrepanzen entwickeln“?
Dabei wird dem Klienten geholfen, den Unterschied zwischen seinem aktuellen Verhalten und seinen persönlichen Zielen oder Werten zu erkennen, um Veränderungsenergie zu wecken.
Wer ist Inge Hannemann im Kontext dieser Arbeit?
Inge Hannemann dient als praktisches Beispiel, um die Herausforderungen und Chancen der Anwendung von MG im System der Arbeitsvermittlung zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Christoph Bärwald (Author), 2015, Interventionsprinzipien der Motivierenden Gesprächsführung. Anwendung in deutschen Jobcentern als humanistischer und deeskalierender Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299805