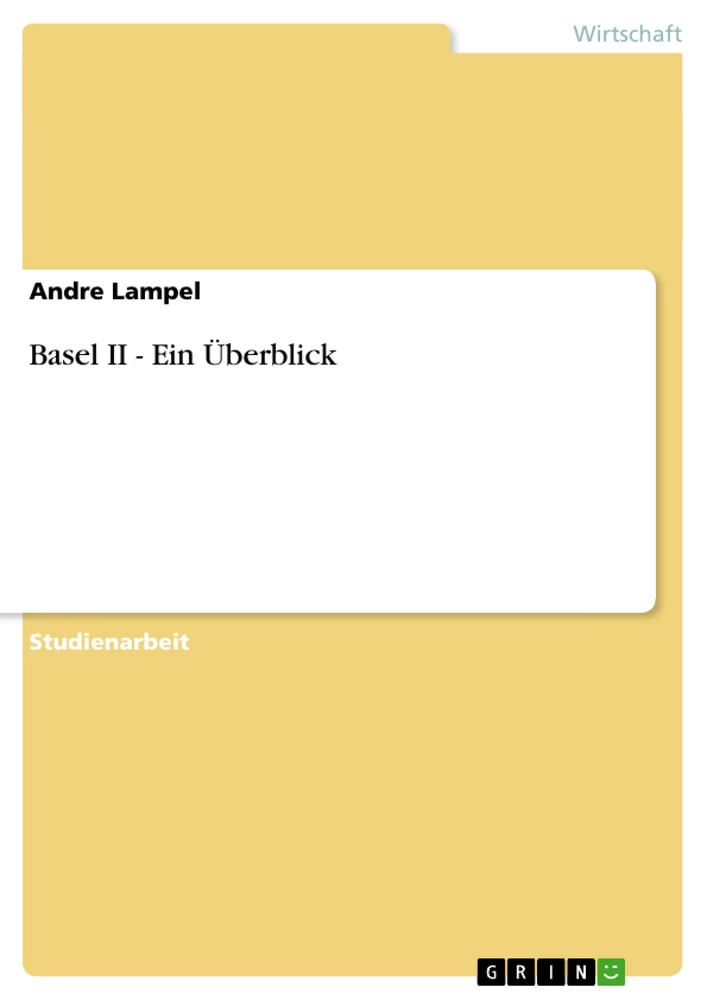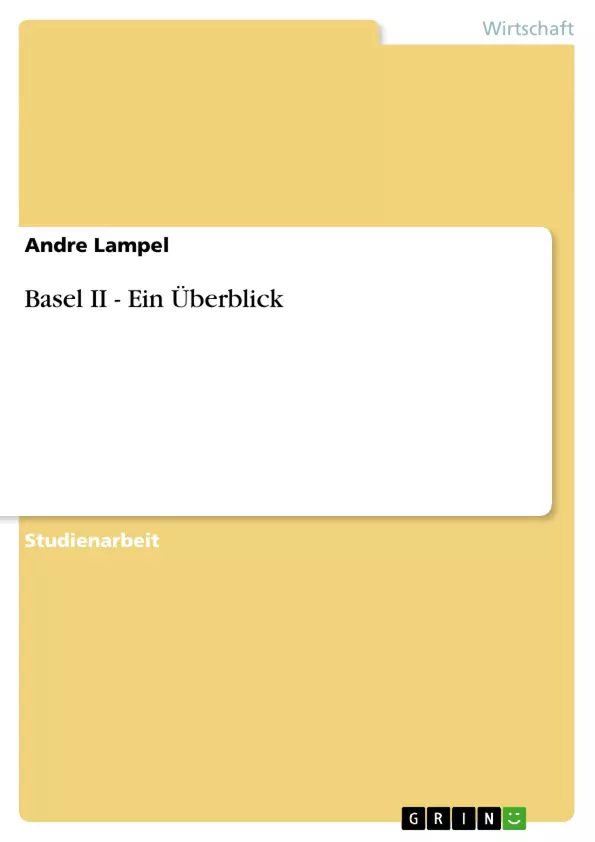Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht wurde 1975 von den Zentralbankpräsidenten der G10 Staaten gegründet und hat seinen Sitz bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel. Er setzt sich aus hochrangigen Vertretern nationaler Bankaufsichtsbehörden und Zentralbanken zusammen, mit dem Ziel, die Harmonisierung des Bankenmarktes auf internationaler Ebene zu verbessern. Ursprünglich wurde die Vereinbarung nur für international tätige Banken aus den G10 Ländern geschlossen, ist aber auch von rein inländischen Banken angenommen und in mehr als 100 Ländern angewandt worden. 1 Bei den erarbeiteten Vorgaben handelt es sich um freiwillige Vereinbarungen zwischen Aufsichtsbehörden und internationalen Großbanken. Die daraus resultierenden Vorgaben gehen allerdings regelmäßig über die EURichtlinien in das nationale Aufsichtsrecht ein und müssen demnach von allen Instituten beachtet werden. Die EU-Eigenkapitalvorschriften lehnen sich eng an die Baseler EKÜbereinkunft an. Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht werden die Baseler-Normen für alle in der EU tätigen Banken verbindlich. Der erste Baseler Akkord von 1988 wurde in der sechsten KWG-Novelle 1992 umgesetzt. 2
Da die Ertragskraft der Banken in den letzten Jahren durch viele Kreditausfälle belastet wurde, versuchte man dieser Entwicklung durch neue Richtlinien bei der Kreditvergabe entgegenzuwirken. Aus diesem Grund legte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht am 3. Juni 1999 einen Entwurf zur Revision der Eigenmittelübereinkunft mit dem Titel: „A new Capital Adequacy Framework“ vor. Daraufhin brachte die Europäische Kommission im November 1999 ein eigenes Papier mit dem Titel: „A Review of Regulatory Capital Requirement for EU Credit Institutions and Investment Firms“ heraus. Die Grundsätze beider Papiere sind weitgehend identisch. Im Mittelpunkt steht die Neuregelung der Risikoaktiva von Banken sowie die Verbesserung der bankaufsichtlichen Standards, um Kreditausfällen und deren Folgen zukünftig besser entgegenwirken zu können.3
Am 16 Januar 2001 legte der Baseler Ausschuss in New York sein zweites Konsultationspapier: „The new Basel Capital Accord“ vor, in dem die EKÜbereinkunft aus dem Jahre 1988 neu geregelt ist.4 Ziel dieses Projetes war es, die EK-Ausstattung der Banken dem amerikanischem Vorbild anzupassen, wo die EK-Quoten der kommunalen mittelständischen Unternehmen (KMU) i.d.R. bei 50 % liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Chronologie von Basel
- 2. Basel I
- 3. Basel II
- 3.1 Rating
- 3.2 Die erste Säule
- 3.2.1 Standardansatz
- 3.2.2 Interner Rating Ansatz (IRB-Ansatz)
- 3.2.2.1 Basisansatz (Foundation Approach)
- 3.2.2.2 Fortgeschrittener Ansatz (Advanced Approach)
- 3.2.3 Retail Business
- 3.2.4 Operationelles Risiko
- 3.3 Die zweite Säule: „Supervisory Review Process“
- 3.4 Die dritte Säule: „Marktdisziplin“
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat „Basel II“ analysiert die neuen Eigenkapitalvorschriften für Banken, die durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht entwickelt wurden. Es geht um die Harmonisierung des Bankenmarktes auf internationaler Ebene und die Verbesserung der bankaufsichtlichen Standards, um Kreditausfällen und deren Folgen zukünftig besser entgegenwirken zu können.
- Chronologie von Basel: Darstellung der Entstehung und Entwicklung der Baseler Vereinbarungen.
- Basel I: Analyse des ersten Baseler Akkords von 1988 und seiner Umsetzung im deutschen Kreditwesengesetz.
- Basel II: Detaillierte Erläuterung der drei Säulen von Basel II: die Eigenkapitalanforderungen, die Aufsichtsüberprüfung und die Marktdisziplin.
- Risikoaktiva und Rating: Erörterung der neuen Methoden zur Bewertung von Risikoaktiva und die Rolle des Ratings.
- Ausblick: Diskussion der geplanten Umsetzung von Basel II und deren Auswirkungen auf die Bankenlandschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung der Baseler Vereinbarungen und skizziert die Motivation für die Einführung von Basel II. Kapitel 2 betrachtet den ersten Baseler Akkord von 1988 und seine Auswirkungen auf das deutsche Kreditwesengesetz. Kapitel 3 stellt die drei Säulen von Basel II vor: die Eigenkapitalanforderungen, die Aufsichtsüberprüfung und die Marktdisziplin. Es wird insbesondere auf die verschiedenen Ratingverfahren und die Methoden zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen eingegangen. Das Kapitel befasst sich auch mit dem operationellen Risiko und den Besonderheiten des Retail Business. Der Ausblick gibt einen kurzen Ausblick auf die geplante Umsetzung von Basel II.
Schlüsselwörter
Basel II, Bankenaufsicht, Eigenkapitalanforderungen, Rating, Risikoaktiva, Kreditwesengesetz, Standardansatz, IRB-Ansatz, operationelles Risiko, Marktdisziplin, Aufsichtsüberprüfung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht?
Ein 1975 gegründetes Gremium der G10-Staaten, das internationale Standards für die Bankenaufsicht (wie Basel I und II) erarbeitet.
Was sind die „drei Säulen“ von Basel II?
Säule 1: Mindesteigenkapitalanforderungen, Säule 2: Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess, Säule 3: Marktdisziplin durch Offenlegung.
Was bedeutet Rating im Kontext von Basel II?
Ratings bewerten die Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern. Je schlechter das Rating, desto mehr Eigenkapital muss die Bank für den Kredit hinterlegen.
Was ist der Unterschied zwischen Standardansatz und IRB-Ansatz?
Im Standardansatz werden externe Ratings genutzt; im IRB-Ansatz (Internal Ratings Based) nutzt die Bank eigene, von der Aufsicht geprüfte Risikomodelle.
Warum wurde Basel II eingeführt?
Um die Eigenkapitalausstattung der Banken risikogerechter zu gestalten und Kreditausfällen sowie systemischen Krisen besser vorzubeugen.
- Arbeit zitieren
- Andre Lampel (Autor:in), 2003, Basel II - Ein Überblick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29992