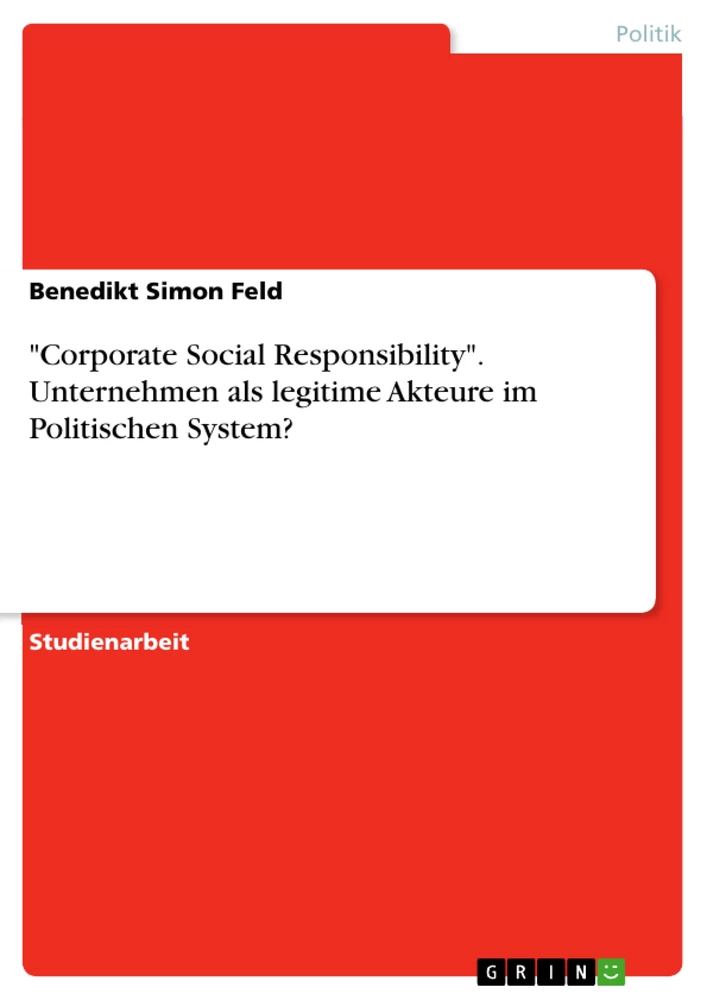Wie kommt es, dass Unternehmen sich auf einmal in die Rolle von Politikern erheben? Waren sie es nicht, die vor allem in den 90er Jahren mit anderen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machten?
Große Unternehmen nutzten die Mechanismen der Globalisierung für ihr eigenes Interesse. Bekannt wurde in dieser Zeit, wie sie sich über Menschenrechte hinwegsetzten, ihre Arbeiter in Drittländern ausbeuteten und Umweltkatastrophen verschuldeten. Dieses Bild befindet sich momentan in einem starken Wandel und geht einher mit dem Begriff der Corporate Social Responsibility (CSR). Ein Begriff, der gerade seit der Jahrtausendwende in der öffentlichen Wahrnehmung Konjunktur hat und immer mehr Aufmerksamkeit findet.
Im Rahmen von CSR-Aktivitäten engagieren sich Unternehmen in sozialen und gesellschaftlichen Themengebieten. Manche Unternehmen gehen sogar soweit ihre komplette Strategie einer nachhaltigen CSR anzupassen. Unternehmen handeln demnach nicht mehr als reine Gewinnmaschinen, bei denen Profit an oberster Stelle steht, sondern nehmen durch ihr Engagement auch bewusst politischen Einfluss auf die Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Grundlage
- Von Steuerung zu Governance
- Neokorporatismus
- Was ist CSR
- CSR eine Frage der Legitimität
- Das Beispiel der BMW Group
- Input-Legitimation
- Throughput-Legitimation
- Output-Legitimation
- Fazit/Handlungsempfehlungen zur Bewertung von CSR Engagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht, wie Unternehmen im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR) in ihrem gesellschaftlichen Engagement legitimiert handeln können. Sie analysiert den Wandel von der Steuerungstheorie hin zu Governance-Ansätzen und setzt diese in Beziehung zum Konzept der CSR. Zudem werden Methoden zur Untersuchung der Legitimität von CSR-Aktivitäten vorgestellt und anhand des Praxisbeispiels der BMW Group angewendet.
- Wandel von Steuerungstheorie zu Governance
- Definition und Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR)
- Legitimität von CSR-Engagement
- Das Beispiel der BMW Group als Fallstudie für CSR-Aktivitäten
- Handlungsempfehlungen zur Bewertung von CSR-Engagement
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar, nämlich die Legitimität von CSR-Engagement. Sie beleuchtet die historische Entwicklung von staatlicher Steuerung hin zu einer stärkeren Einbindung gesellschaftlicher Akteure und dem Konzept der Governance. Zudem wird die Bedeutung von CSR in der heutigen Zeit erörtert.
- Theoretische Grundlage: Dieser Abschnitt beleuchtet den Wandel von Steuerungstheorie zu Governance-Ansätzen und ihre Relevanz für das Verständnis von CSR. Zudem wird der Begriff der Corporate Social Responsibility definiert und in den Kontext von Neokorporatismus eingeordnet.
- CSR eine Frage der Legitimität: Dieser Abschnitt erörtert die Bedeutung von Legitimität für CSR-Aktivitäten und stellt verschiedene Methoden zur Untersuchung der Legitimität von CSR-Engagement vor.
- Das Beispiel der BMW Group: Dieser Abschnitt untersucht die CSR-Aktivitäten der BMW Group anhand der drei Dimensionen der Legitimität: Input-Legitimation, Throughput-Legitimation und Output-Legitimation.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Themen Corporate Social Responsibility, Governance, Legitimität, Steuerungstheorie, Neokorporatismus, Unternehmensethik, Nachhaltigkeit, Stakeholder-Engagement, Politikwissenschaft, BMW Group.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet das soziale und gesellschaftliche Engagement von Unternehmen, das über die reine Gewinnmaximierung hinausgeht.
Sind Unternehmen legitime politische Akteure?
Die Arbeit untersucht, wie Unternehmen durch CSR bewusst politischen Einfluss nehmen und ob dieses Handeln demokratisch legitimiert ist.
Was ist der Unterschied zwischen Input- und Output-Legitimation?
Input-Legitimation fragt nach der Beteiligung der Betroffenen, während Output-Legitimation die Wirksamkeit und Ergebnisse des Engagements bewertet.
Wie setzt die BMW Group CSR um?
Das Beispiel der BMW Group dient als Fallstudie, um CSR-Aktivitäten anhand von Input-, Throughput- und Output-Dimensionen kritisch zu analysieren.
Was versteht man unter dem Wandel von Steuerung zu Governance?
Es beschreibt den Trend, dass nicht mehr nur der Staat steuert, sondern private Akteure wie Unternehmen verstärkt in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
- Quote paper
- Benedikt Simon Feld (Author), 2013, "Corporate Social Responsibility". Unternehmen als legitime Akteure im Politischen System?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300158