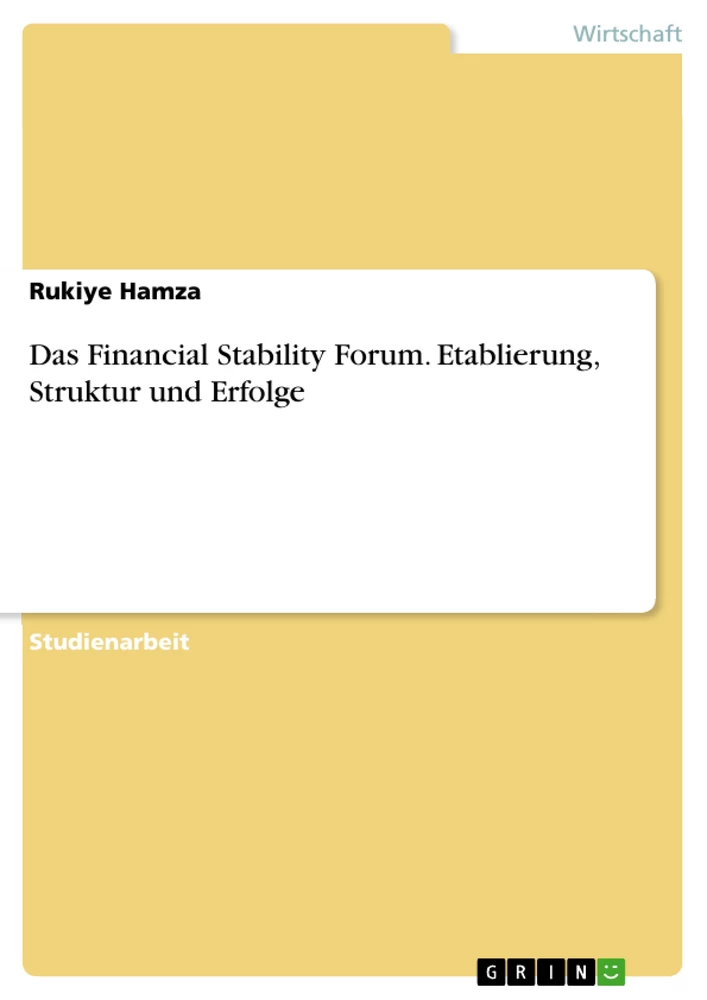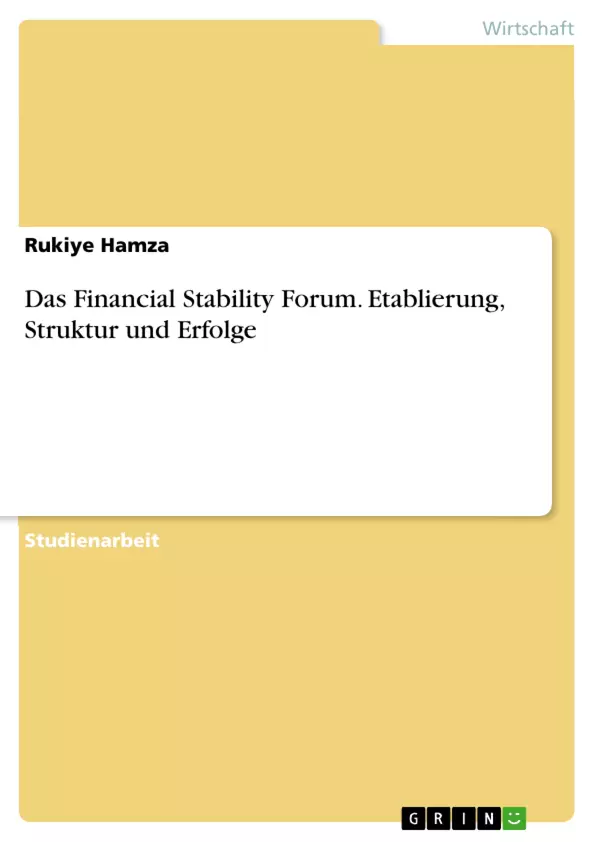Das globale Wirtschaftsgeschehen wird durch zwei große Trends bestimmt: die Globalisierung und die Häufung der internationalen Finanzkrisen. Der internationale Finanzmarkt ist aufgrund der Volatilität der Kapitalströme und aufgrund eines fehlenden institutionellen Rahmens durch zahlreiche systematische und finanzielle Risiken gekennzeichnet. Die Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte wird einerseits als Entwicklungschance und andererseits als wichtigste Ursache der zunehmenden Finanzkrisen gesehen. Die Häufung und Gravität der Finanzkrisen deuten daraufhin, dass es fundamentale Schwächen in der internationalen Finanzarchitektur gibt.
Selbst Länder mit solider Wirtschaftspolitik und gesundem Kapitalmarkt blieben von den Wirtschaftskrisen nicht verschont. Entscheidende Änderungen auf den Kapitalmärkten seit den 70er Jahren waren der Anstieg der privaten Kapitalbewegungen und ein Wandel in der Zusammensetzung der Kapitalströme. Im Jahre 1971 konnten noch 90% der internationalen Finanztransaktionen der Realökonomie zugeordnet werden, während nur 10% spekulativer Natur waren. In den 90er Jahren hingegen waren die Prozentsätze umgekehrt; 1995 betrugen die spekulativen Kapitaltransfers bereits 95% und kurzfristige 80%.
Eine besonders große Gefahr für die finanzielle Stabilität bilden kurzfristige und spekulative Kapitalströme. Eine Wirtschaftskrise ist am wahrscheinlichsten, wenn Kapital plötzlich in hohem Maße aus einer Volkswirtschaft abfließt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einleitung
- II. Das Financial Stability Forum
- 1. Die Etablierung eines internationalen Finanzforums
- 1.1 Die Gründung des Financial Stability Forums
- 1.2 Der Tietmeyer-Bericht
- 2. The Financial Stability Forum
- 2.1 Die Struktur und Mitgliedschaft
- 2.2 Die Aufgaben und das Mandat
- 2.3 Die Financial Stability Standards
- 3. Die Erfolge und Schwächen des Forums
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Financial Stability Forum (FSF), einer internationalen Institution, die im Zuge der Häufung von Finanzkrisen in den späten 1990er Jahren gegründet wurde. Sie analysiert die Entstehung des FSFs, seine Struktur, sein Mandat und die Maßnahmen zur Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte. Darüber hinaus werden die Erfolge und Schwächen des FSFs kritisch beleuchtet.
- Die Globalisierung und die Häufung von Finanzkrisen als treibende Kräfte der internationalen Finanzmarktstabilität
- Die Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte als Chance und Risiko
- Die Herausforderungen der „Unholy Trinity“ für die internationale Finanzarchitektur
- Die Bedeutung von Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren zur Stärkung der Finanzmarktstabilität
- Die Rolle des FSFs bei der Entwicklung von Standards und der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und Bewältigung von Finanzmarktrisiken
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Im ersten Kapitel wird der Entstehungskontext des FSFs dargelegt, wobei die Rolle von Finanzkrisen wie der Mexiko-Krise 1994 und der Asienkrise 1997 hervorgehoben wird. Die zunehmende Anfälligkeit der globalen Finanzmärkte für systemische Risiken führte zu einem verstärkten Interesse der G7-Staaten an der internationalen Finanzmarktstabilität und Reform. Das FSF wurde unter US-amerikanischer Initiative als Reaktion auf diese Herausforderungen ins Leben gerufen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Struktur und Mitgliedschaft des FSFs. Es wird erläutert, dass das Forum aus 35 Vertretern aus G7-Staaten, wichtigen Finanzmärkten, internationalen Finanzinstitutionen, sektorspezifischen Aufsichtsbehörden und Zentralbankenkomitees besteht. Die Aufgaben und das Mandat des FSFs werden vorgestellt, wobei die Entwicklung von Finanzstabilitätsstandards, die Koordinierung der Finanzmarktaufsicht und die Prävention von Finanzkrisen im Vordergrund stehen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Financial Stability Standards, die vom FSF entwickelt werden. Es wird erläutert, wie diese Standards zur Stärkung der Finanzmarktstabilität beitragen und wie sie von den verschiedenen Akteuren umgesetzt werden sollen. Die Bedeutung von Transparenz, Kommunikation und Kooperation bei der Umsetzung dieser Standards wird betont.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Erfolge und Schwächen des FSFs. Es werden die bisher erreichten Fortschritte bei der Stärkung der internationalen Finanzmarktstabilität gewürdigt, aber auch kritische Punkte und Herausforderungen aufgezeigt, die das FSF noch zu bewältigen hat. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie die Wirksamkeit des FSFs in Zukunft noch verbessert werden kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf das Financial Stability Forum (FSF), seine Struktur und sein Mandat sowie die Financial Stability Standards. Die wichtigsten Themen sind: Internationale Finanzmarktstabilität, Finanzkrisen, Globalisierung, Liberalisierung der Finanzmärkte, „Unholy Trinity“, Koordinierung, Zusammenarbeit, Finanzmarktaufsicht, Regulierung, Standards, Erfolge und Schwächen des FSFs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Financial Stability Forum (FSF)?
Das FSF ist eine internationale Institution, die gegründet wurde, um die Zusammenarbeit bei der Aufsicht und Überwachung der Finanzmärkte zur Vermeidung von Krisen zu verbessern.
Warum wurde das FSF gegründet?
Die Gründung war eine Reaktion auf die Häufung internationaler Finanzkrisen in den 90er Jahren (z.B. Asienkrise) und die zunehmende Volatilität spekulativer Kapitalströme.
Was war der Tietmeyer-Bericht?
Ein von Hans Tietmeyer erstellter Bericht, der die strukturelle Grundlage für die Etablierung des Forums legte.
Wer sind die Mitglieder des Financial Stability Forums?
Es besteht aus Vertretern der G7-Staaten, internationalen Finanzinstitutionen, Zentralbanken und sektorspezifischen Aufsichtsbehörden.
Was sind Financial Stability Standards?
Es handelt sich um vom FSF entwickelte Richtlinien, die zur Stärkung der internationalen Finanzarchitektur und zur Transparenz beitragen sollen.
- Quote paper
- Rukiye Hamza (Author), 2004, Das Financial Stability Forum. Etablierung, Struktur und Erfolge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300169