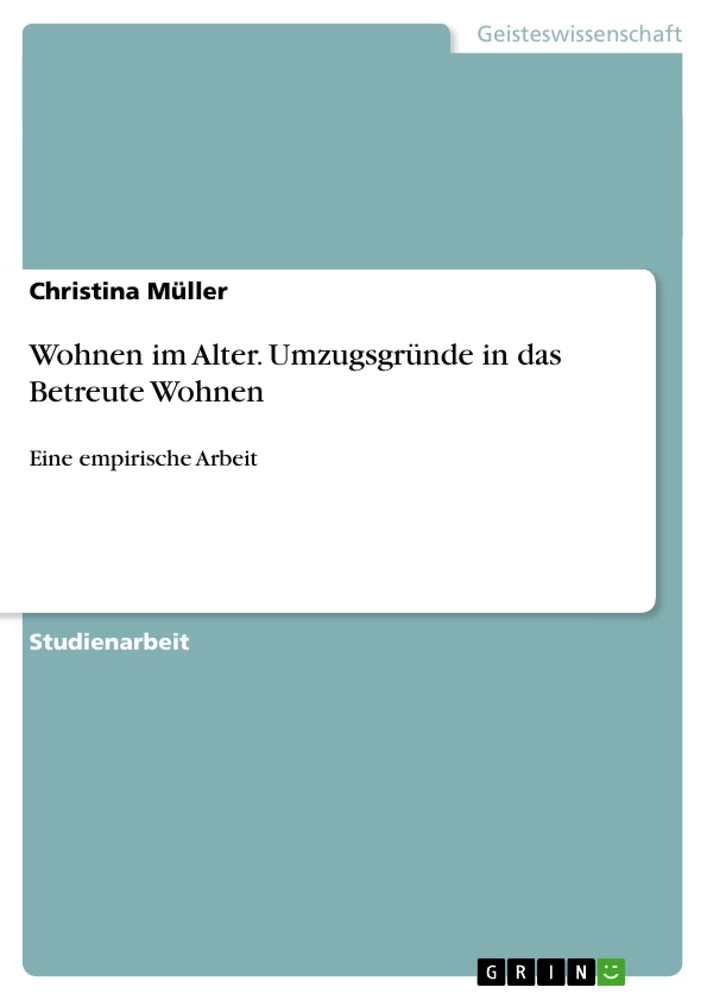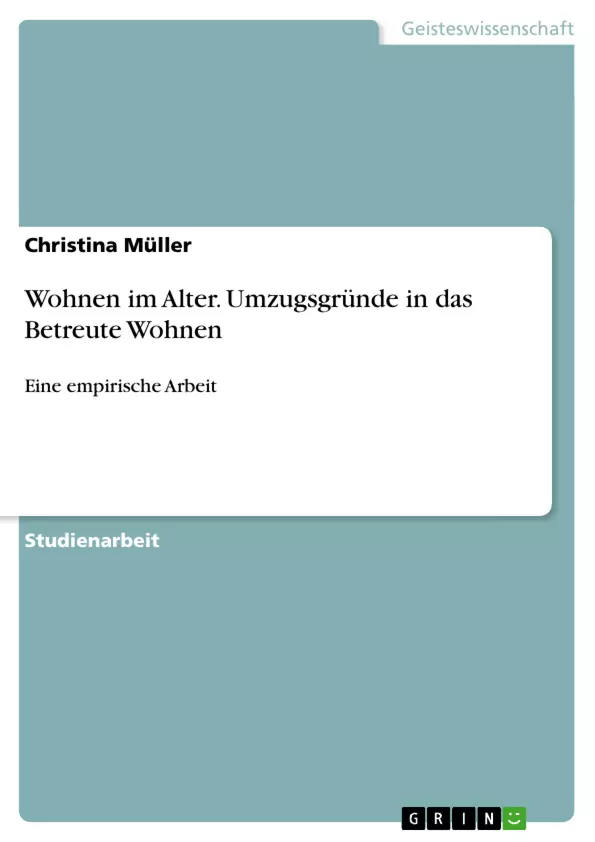In der Vergangenheit haben sich die verschiedenen wissenschaftlichen Zweige der Gerontologie vorwiegend mit dem geistigen und körperlichen Kompetenzabbau beschäftigt, der im Rahmen des menschlichen Alterungsprozesses stattfindet. Jedoch sehen zunehmend mehr ältere Menschen ihr Alter als positive und produktive Lebensphase, die sie sich möglichst lange in Autonomie erhalten möchten. Baltes und Carstensen (1996) betonen in ihrem Beitrag zum erfolgreichen Altern, dass Altern nicht nur Kompetenzverlust bedeuten kann, sondern auch Weiterentwicklung, Aufbau einer neuen, möglicherweise anders gearteten Vitalität und kreative Auseinandersetzung, so dass Altern auch mit Zufriedenheit erlebt werden kann.
Neben dem Wunsch nach langfristiger, selbstständiger Lebensführung wächst mit zunehmendem Alter aber auch das Bedürfnis nach persönlicher Sicherheit und Krisenvorsorge.
Das Betreute Wohnen hat sich in den letzten Jahren als Wohnform herauskristallisiert, die diesen beiden entgegengesetzten Bedürfnissen von Autonomie einerseits und Sicherheit andererseits gerecht werden kann. Die vorliegende Studie gibt neben aktuellen gerontologisch-theoretischen Grundlagen zur Person-Umwelt-Interaktion im Alter einen kurzen Abriss über das Konzept des Betreuten Wohnens für Senioren und untersucht auf Basis empirischer Daten, aus welchen Beweggründen ältere Menschen sich für diese relativ neue Wohnform entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wohnen im Alter
- Begriffserläuterung „Wohnen“
- Begriffserläuterung „Alter“
- Bedeutung des Wohnens im Alter
- Kompetenz und Anpassung
- Umwelt und Anpassung
- Ökopsychologische Betrachtung des Wohnens
- Gerontologische Betrachtung des Wohnens
- Umzug
- Wohnformen
- Betreutes Wohnen
- Begriffserläuterung
- Formen des Betreuten Wohnens
- Bedeutung und Grenzen des Betreuten Wohnens
- Qualitätskriterien für das Betreute Wohnen
- Theorien zum Wohnen im Alter
- Das Umweltanforderungs-Kompetenzmodell von Lawton
- Das Modell des erfolgreichen Alterns: Prozessorientiertes Metamodell (SOK Modell) von Baltes und Baltes
- Empirische Erhebung zum Betreuten Wohnen
- Beschreibung der Einrichtung „Mathilde-Vogt-Haus“ in Heidelberg
- Beschreibung der Bewohnerstruktur
- Beschreibung des Umfelds der Wohnanlage und der Stadtteil-Infrastruktur
- Methode und Durchführung
- Erhebungsinstrument
- Beschreibung der Stichprobe
- Ergebnisse
- Vorheriger Wohnstandort
- Entscheidungsgründe für die Einrichtung
- Entscheidungsgründe der Priorität 1
- Entscheidungsgründe der Priorität 2
- Umzugsgründe
- Umzugsgründe der Priorität 1
- Umzugsgründe der Priorität 2
- Bedeutung der unmittelbaren Wohnumwelt
- Beschreibung der Einrichtung „Mathilde-Vogt-Haus“ in Heidelberg
- Ergebnisdiskussion
- Ergebnisdiskussion im Vergleich mit der Evaluationsstudie von Heeg und Seiler sowie der Augsburger Längsschnittstudie von Saup
- Ergebnisdiskussion im Kontext der Theorien von Lawton sowie Baltes und Baltes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht die Motive, die ältere Menschen zu einem Umzug in eine Einrichtung für betreutes Wohnen bewegen. Die Arbeit stellt neben aktuellen gerontologischen Theorien zum Wohnen im Alter das Konzept des Betreuten Wohnens vor und analysiert empirische Daten, um die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen der Bewohner im Hinblick auf ihre Wohnsituation zu erforschen.
- Gerontologische und ökopsychologische Betrachtung des Wohnens im Alter
- Das Konzept des Betreuten Wohnens und dessen Bedeutung für ältere Menschen
- Empirische Analyse der Umzugsgründe in das Betreute Wohnen
- Verknüpfung der empirischen Ergebnisse mit relevanten Theorien
- Diskussion der Ergebnisse im Vergleich mit anderen Studien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Wohnens im Alter und die Herausforderungen, denen ältere Menschen in Bezug auf ihre Wohnbedürfnisse gegenüberstehen. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Wohnens und dem Aspekt des Alterns. Es analysiert verschiedene Ansätze zur Definition von „Wohnen“ und „Alter“ und beleuchtet die Bedeutung des Wohnens im Alter aus unterschiedlichen Perspektiven, einschließlich der Kompetenz- und Anpassungsfähigkeit, der Umwelt und der ökologischen sowie gerontologischen Betrachtung. Das dritte Kapitel widmet sich dem Betreuten Wohnen als spezifischer Wohnform für Senioren. Es definiert den Begriff, untersucht verschiedene Formen des Betreuten Wohnens und diskutiert deren Bedeutung und Grenzen. Darüber hinaus werden Qualitätskriterien für das Betreute Wohnen beleuchtet. Das vierte Kapitel stellt relevante Theorien zum Wohnen im Alter vor, insbesondere das Umweltanforderungs-Kompetenzmodell von Lawton und das Modell des erfolgreichen Alterns von Baltes und Baltes. Das fünfte Kapitel beschreibt die empirische Erhebung, die in der Einrichtung „Mathilde-Vogt-Haus“ in Heidelberg durchgeführt wurde. Es beinhaltet die Beschreibung der Bewohnerstruktur, des Umfelds der Wohnanlage sowie die Methodik der Datenerhebung. Die Ergebnisse der Erhebung werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Betreutes Wohnen, Wohnen im Alter, Gerontologie, Ökopsychologie, Umweltanforderungs-Kompetenzmodell, erfolgreiches Altern, empirische Studie, Umzugsgründe, Bewohnerstruktur, Wohnumgebung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für einen Umzug in das Betreute Wohnen?
Zentrale Motive sind der Wunsch nach Sicherheit und Krisenvorsorge bei gleichzeitigem Erhalt der Autonomie und Selbstständigkeit.
Wie definiert sich „Betreutes Wohnen“ für Senioren?
Es ist eine Wohnform, die barrierefreien Wohnraum mit optionalen Service- und Betreuungsleistungen kombiniert, um ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu unterstützen.
Was besagt das Umweltanforderungs-Kompetenzmodell von Lawton?
Es beschreibt die Interaktion zwischen den individuellen Fähigkeiten (Kompetenz) und den Anforderungen der Umwelt. Ein Umzug erfolgt oft, wenn die Umwelt zu belastend wird.
Welche Rolle spielt die Infrastruktur des Stadtteils?
Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und sozialen Einrichtungen ist ein entscheidendes Kriterium für die Wahl der Wohnanlage.
Was ist das SOK-Modell von Baltes und Baltes?
Es steht für Selektion, Optimierung und Kompensation und beschreibt, wie Menschen trotz altersbedingter Verluste ein hohes Maß an Lebensqualität und Zufriedenheit erreichen können.
- Quote paper
- Christina Müller (Author), 2004, Wohnen im Alter. Umzugsgründe in das Betreute Wohnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30021