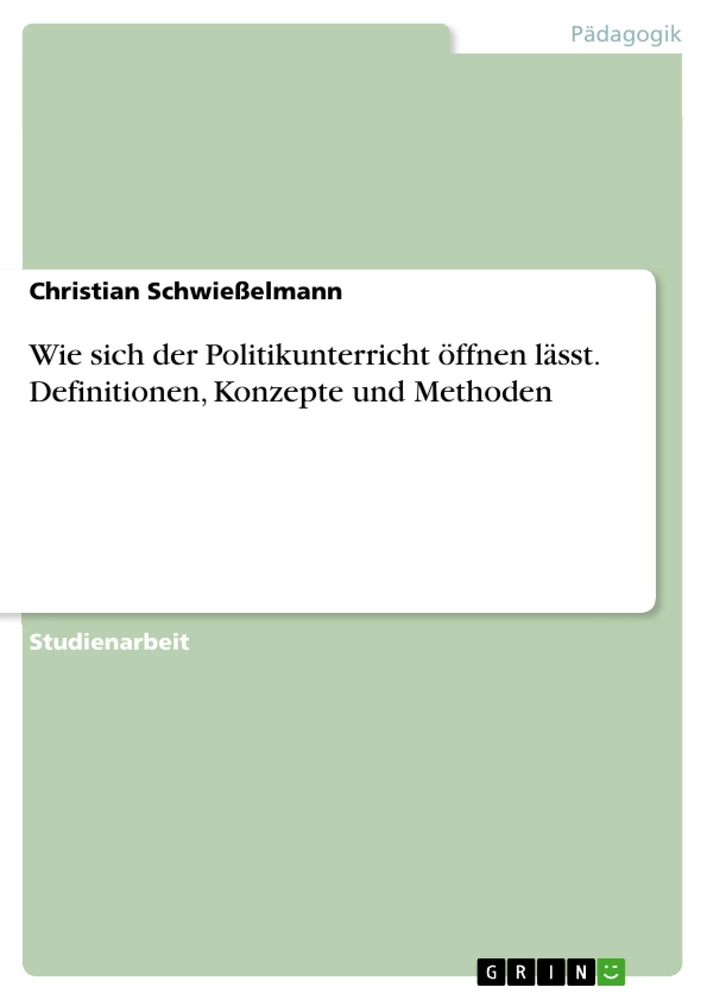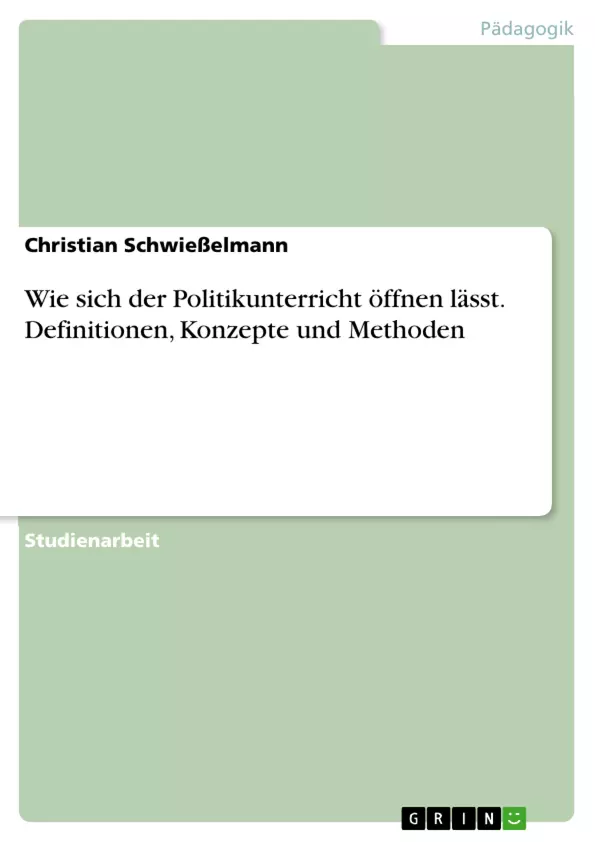Öffnung und Offenheit sind in demokratischen Staaten, die sich nach Karl Popper als offene Gesellschaften verstehen, positiv konnotierte Begriffe. Das gilt gerade für die Schule als die zentrale Sozialisationsinstanz neben dem Elternhaus. Hier soll nach der herrschenden Meinung demokratisches Verhalten, Mitbestimmung, Inklusion und Integration eingeübt werden. Die Öffnung des Unterrichts hat daher auch heute noch einen guten Klang, auch wenn die begriffliche Verschlagwortung früh kritisiert (vgl. Jürgens 1995, S. 16ff) und der reform-pädagogische Optimismus der 1970er und 1980er Jahre durch die Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung stark gedämpft wurde (siehe z. B. Hattie 2013).
Im Nachfolgenden wird das Konzept des Offenen Unterrichts (OU) aus politikdidaktischer Perspektive diskutiert. Es geht um die Frage, wie OU am besten etabliert werden kann und welche Dimensionen der Öffnung dabei im Vordergrund stehen sollen. Dazu werden zunächst Definitionen des OU im Hinblick auf ihre Operationalisierbarkeit erörtert. Im Hauptteil sollen Überlegungen zur schrittweisen Einführung angestellt werden. Das Erkenntnisinteresse richtet sich dabei auf die Frage: Wie muss ein Lehrer vorgehen, der seinen Unterricht inhaltlich und methodisch öffnen, aber keine Einbußen in der Unterrichtsqualität hinnehmen möchte? Zu befragen sind in erster Linie die Literaturbefunde aus der Empirie und Praxis.
Die theoretischen Erörterungen im Rahmen dieser Hausarbeit stehen nicht ohne Grund am Beginn eines Portfolios zu dem Seminar „Neue Lernkulturen im Politikunterricht“, das sich insbesondere der Methodenvielfalt im Fach Politische Bildung gewidmet hat. Angehängt finden sich eine Methoden-Reflexion sowie eine kreative Aufgabe, die das Thema anwendungsorientiert ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
- Offene Gesellschaft
- Offener Unterricht
- Warum öffnen?
- Was öffnen?
- Wie öffnen?
- Schluss: Noch ganz dicht?
- Methodenreflexion
- Kreative Aufgabe
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des offenen Unterrichts (OU) im Politikunterricht aus politikdidaktischer Perspektive. Das Hauptziel ist die Erörterung der besten Vorgehensweise zur Etablierung von OU und die Bestimmung der wichtigsten Dimensionen der Öffnung. Die Arbeit analysiert Definitionen von OU im Hinblick auf ihre Operationalisierbarkeit und erörtert Überlegungen zur schrittweisen Einführung. Ein zentrales Erkenntnisinteresse ist die Frage, wie ein Lehrer seinen Unterricht öffnen kann, ohne dabei Einbußen in der Unterrichtsqualität in Kauf nehmen zu müssen.
- Definition und Operationalisierung des offenen Unterrichts
- Argumente für die Öffnung des Politikunterrichts
- Dimensionen der Öffnung (organisatorisch, methodisch, inhaltlich, politisch-partizipativ)
- Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Umsetzung offenen Unterrichts
- Praxisbezogene Überlegungen zur schrittweisen Einführung von offenem Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Offene Gesellschaft: Die Kapitel erläutert den positiven Beigeschmack des Begriffs "Offenheit" in demokratischen Gesellschaften und dessen Bedeutung für die Schule als Sozialisationsinstanz. Es wird jedoch auch die Kritik an der begrifflichen Verschlagwortung und der gedämpfte reformpädagogische Optimismus aufgrund empirischer Bildungsforschung angesprochen. Die konzeptionellen Grenzen unterrichtlicher Öffnung werden im Kontext von Faktoren wie kurzen Unterrichtseinheiten, starrem Fachlehrersystem und hohen Erwartungen von Eltern und Schülern diskutiert. Das Kapitel führt in die Thematik des offenen Unterrichts ein und kündigt die folgende Auseinandersetzung mit dessen Etablierung und den relevanten Dimensionen der Öffnung an. Der Fokus liegt auf der Frage, wie ein Lehrer seinen Unterricht öffnen kann ohne qualitative Einbußen.
Offener Unterricht: Warum öffnen?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begründung für die Öffnung des Unterrichts. Es werden verschiedene Argumente aus der reformpädagogischen Bewegung, dem Wandel der familiären Lebenswirklichkeit, dem veränderten elterlichen Erziehungsverhalten, dem modifizierten Freizeitverhalten von Jugendlichen und der Pluralisierung der Lebenswelten angeführt. Die Kapitel verdeutlicht, dass der Wunsch nach offenem Unterricht aus unterschiedlichen gesellschaftlichen und pädagogischen Entwicklungen resultiert. Die Argumentation zeigt die Notwendigkeit, den Unterricht an die veränderten Bedingungen anzupassen.
Offener Unterricht: Was öffnen?: Dieses Kapitel adressiert die Problematik einer klaren Definition von offenem Unterricht und diskutiert verschiedene Dimensionen der Öffnung: organisatorische, methodische, inhaltliche und politisch-partizipative Öffnung. Es wird argumentiert, dass nur Unterrichtsformen, die Schüler über die Inhalte mitbestimmen lassen, wirklich offen sind. Das Kapitel betont die Komplexität der Definition von „Offenheit“ im Unterricht und bietet einen Rahmen für die nachfolgende Diskussion über die Implementierung.
Schlüsselwörter
Offener Unterricht, Politikunterricht, Politikdidaktik, Öffnung, Demokratie, Reformpädagogik, Empirische Bildungsforschung, Unterrichtsqualität, Schülerpartizipation, Methodenvielfalt.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Offener Unterricht im Politikunterricht"
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert das Konzept des offenen Unterrichts (OU) im Politikunterricht aus politikdidaktischer Perspektive. Es untersucht die beste Vorgehensweise zur Etablierung von OU und die wichtigsten Dimensionen der Öffnung, wobei der Fokus auf der Frage liegt, wie ein Lehrer seinen Unterricht öffnen kann, ohne Einbußen in der Unterrichtsqualität.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt Themen wie die Definition und Operationalisierung von offenem Unterricht, Argumente für die Öffnung des Politikunterrichts, Dimensionen der Öffnung (organisatorisch, methodisch, inhaltlich, politisch-partizipativ), Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Umsetzung, und praxisbezogene Überlegungen zur schrittweisen Einführung.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel ("Offene Gesellschaft", "Offener Unterricht: Warum öffnen?", "Offener Unterricht: Was öffnen?", "Schluss: Noch ganz dicht?", "Methodenreflexion", "Kreative Aufgabe"), eine Liste mit Schlüsselwörtern und einen Anhang (nicht im Detail beschrieben).
Was sind die wichtigsten Argumente für einen offenen Unterricht?
Argumente für die Öffnung des Unterrichts werden aus der reformpädagogischen Bewegung, dem Wandel der familiären Lebenswirklichkeit, dem veränderten elterlichen Erziehungsverhalten, dem modifizierten Freizeitverhalten von Jugendlichen und der Pluralisierung der Lebenswelten abgeleitet. Der Wunsch nach offenem Unterricht resultiert aus unterschiedlichen gesellschaftlichen und pädagogischen Entwicklungen und der Notwendigkeit, den Unterricht an veränderte Bedingungen anzupassen.
Welche Dimensionen der Öffnung werden diskutiert?
Das Dokument unterscheidet zwischen organisatorischer, methodischer, inhaltlicher und politisch-partizipativer Öffnung. Es wird argumentiert, dass nur Unterrichtsformen, die Schüler über die Inhalte mitbestimmen lassen, wirklich offen sind.
Welche Herausforderungen werden bei der Umsetzung offenen Unterrichts genannt?
Das Dokument thematisiert die konzeptionellen Grenzen unterrichtlicher Öffnung im Kontext von Faktoren wie kurzen Unterrichtseinheiten, starrem Fachlehrersystem und hohen Erwartungen von Eltern und Schülern. Es wird auch der gedämpfte reformpädagogische Optimismus aufgrund empirischer Bildungsforschung angesprochen.
Wie wird der Begriff "Offenheit" im Kontext des Unterrichts definiert?
Die Definition von "Offenheit" im Unterricht wird als komplex dargestellt. Das Dokument diskutiert verschiedene Interpretationen und betont die Bedeutung der Schülerpartizipation bei der Gestaltung der Unterrichtsinhalte für eine wirklich offene Unterrichtsform.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Offener Unterricht, Politikunterricht, Politikdidaktik, Öffnung, Demokratie, Reformpädagogik, Empirische Bildungsforschung, Unterrichtsqualität, Schülerpartizipation, Methodenvielfalt.
- Quote paper
- Christian Schwießelmann (Author), 2015, Wie sich der Politikunterricht öffnen lässt. Definitionen, Konzepte und Methoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300271