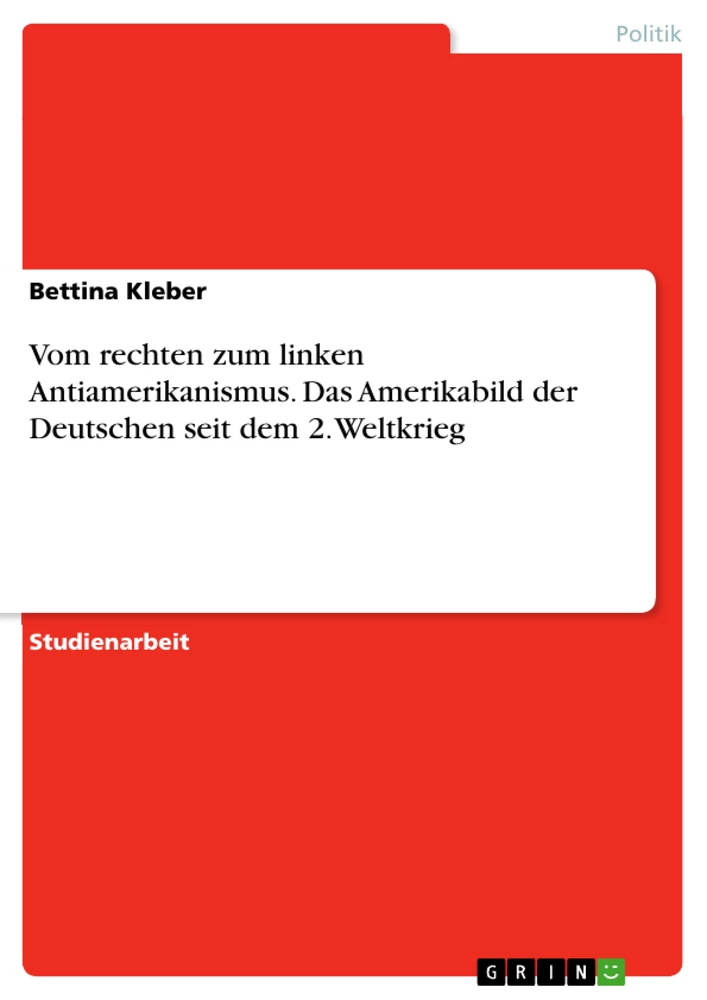Zu Zeiten in denen eine negative Grundstimmung in Deutschland Oberhand gewinnt, kommen meist die immer wieder gleichen Ressentiments zum Vorschein. Doch trotz des konstanten Vorhandenseins antiamerikanischer Ressentiments hat sich in Deutschland nach 1945 doch ein Bruch mit dem bisherigen deutschen Amerikabild abgezeichnet.
Wie es zu diesem Wandel kam und warum nun Amerika nicht mehr wie vor 1945 von rechter Seite aus kritisiert, sondern nun von den Linken in Deutschland kritisiert wurde, soll in dieser Arbeit dargestellt werden.
Dabei ist es wichtig, erstmal auf das Amerikabild in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg einzugehen, um einen besseren Zusammenhang zu dem rechten Antiamerikanismus im Dritten Reich aufzuzeigen, der vorwiegend auf die antiamerikanische Rhetorik der Zwischenkriegszeit anknüpfte.
Bei der Erläuterung des Amerikabildes während des Zweiten Weltkrieges wird herausgearbeitet, weshalb die deutsche Bevölkerung nach Kriegsende trotz des vernichtenden Amerikabildes das von Hitler propagiert wurde, die USA nicht so sehr als Feind, sondern vielmehr als Befreier wahrnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Amerikabild in der Zwischenkriegszeit
- Das Amerikabild im ,,Dritten Reich"
- Das ambivalente Amerikabild im «Dritten Reich »
- Drahtseilakt der Propagandisten: Adaption bei gleichzeitiger Distanzierung
- Das wohlwollende Amerikabild der Friedenszeit - bis die Maske fiel!
- Die propagierte Differenz zwischen einem guten und einem schlechten Amerika
- Auswirkungen des propagierten Amerikabildes auf die breite Bevölkerung Deutschlands
- Das Amerikabild in der Nachkriegszeit
- Das positive Amerikabild - Begründungen aus psychologischer Sichtweise
- Das negative Amerikabild - Begründungen aus psychologischer Sichtweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Antiamerikanismus in Deutschland vom rechten zum linken Antiamerikanismus. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln des Antiamerikanismus in der Zwischenkriegszeit, analysiert die Ambivalenz des Amerikabildes im Dritten Reich und untersucht, wie sich das Amerikabild nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte. Die Arbeit befasst sich mit den psychologischen Begründungen für die positive und negative Wahrnehmung Amerikas in Deutschland.
- Die Entstehung des Antiamerikanismus in der Zwischenkriegszeit
- Die Ambivalenz des Amerikabildes im Dritten Reich
- Der Wandel des Amerikabildes nach dem Zweiten Weltkrieg
- Psychologische Begründungen für die positive und negative Wahrnehmung Amerikas in Deutschland
- Die Entwicklung des linken Antiamerikanismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Antiamerikanismus in Deutschland ein und stellt die zentrale These der Arbeit vor: Der Antiamerikanismus in Deutschland hat sich von einer rechten zu einer linken Kritik gewandelt. Kapitel 2 beleuchtet das Amerikabild in der Zwischenkriegszeit und stellt die beiden gegensätzlichen Perspektiven auf Amerika dar: die proamerikanische und die antiamerikanische Strömung. Kapitel 3 analysiert das Amerikabild im Dritten Reich und untersucht die Ambivalenz, die sich in der Propaganda und der Wahrnehmung der Bevölkerung widerspiegelte. Kapitel 4 befasst sich mit dem Amerikabild in der Nachkriegszeit und analysiert die psychologischen Begründungen für die positive und negative Wahrnehmung Amerikas in Deutschland.
Schlüsselwörter
Antiamerikanismus, Amerikabild, Deutschland, Zwischenkriegszeit, Drittes Reich, Nachkriegszeit, Psychologie, linke Kritik, rechte Kritik, Propaganda, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wandelte sich der Antiamerikanismus in Deutschland?
Der Antiamerikanismus entwickelte sich von einer vorwiegend rechten, völkisch-ideologischen Kritik vor 1945 zu einer eher linken, system- und kulturkritischen Haltung in der Nachkriegszeit.
Wie war das Amerikabild im "Dritten Reich"?
Es war ambivalent: Einerseits gab es Bewunderung für Effizienz, andererseits diffamierte die Propaganda die USA als "kulturlose" und "jüdisch beherrschte" Macht.
Warum wurden die USA nach 1945 oft als Befreier wahrgenommen?
Trotz jahrelanger NS-Propaganda sahen viele Deutsche in den USA eine Chance auf Demokratisierung und wirtschaftlichen Wiederaufbau, was psychologisch als Bruch mit dem Feindbild wirkte.
Was prägte den Antiamerikanismus in der Zwischenkriegszeit?
In dieser Zeit entstanden viele der Ressentiments, die später von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurden, insbesondere die Ablehnung der Modernität und des Kapitalismus.
Was sind psychologische Gründe für ein negatives Amerikabild?
Oft dienen Antiamerikanismus und Ressentiments der eigenen Identitätsstiftung durch Abgrenzung von einer als übermächtig wahrgenommenen Kultur.
- Citation du texte
- Bettina Kleber (Auteur), 2009, Vom rechten zum linken Antiamerikanismus. Das Amerikabild der Deutschen seit dem 2. Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300372