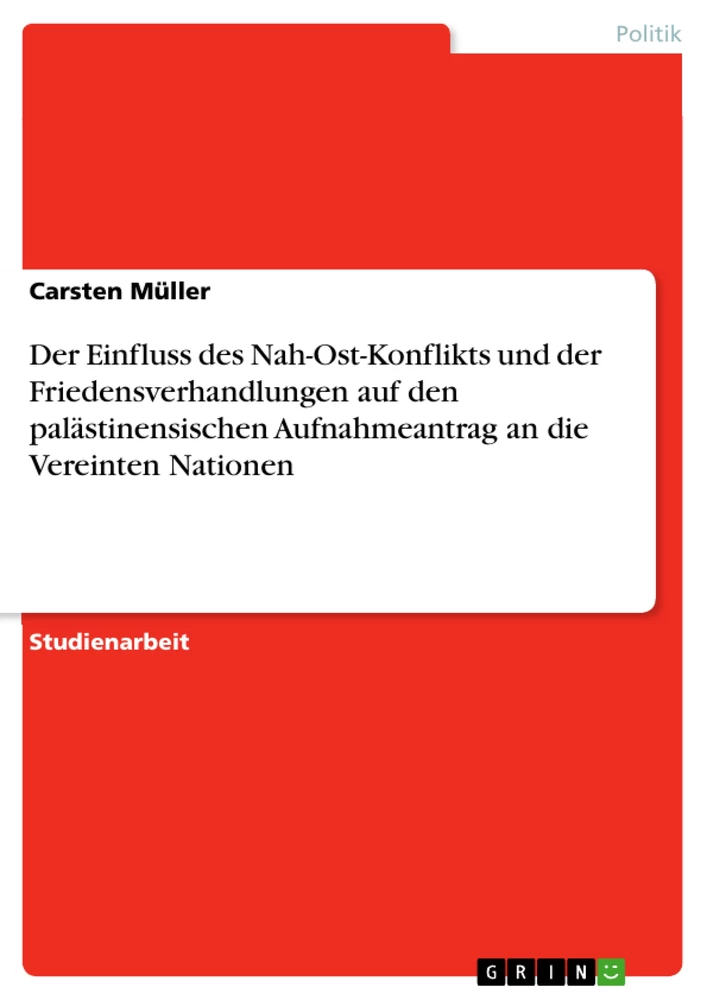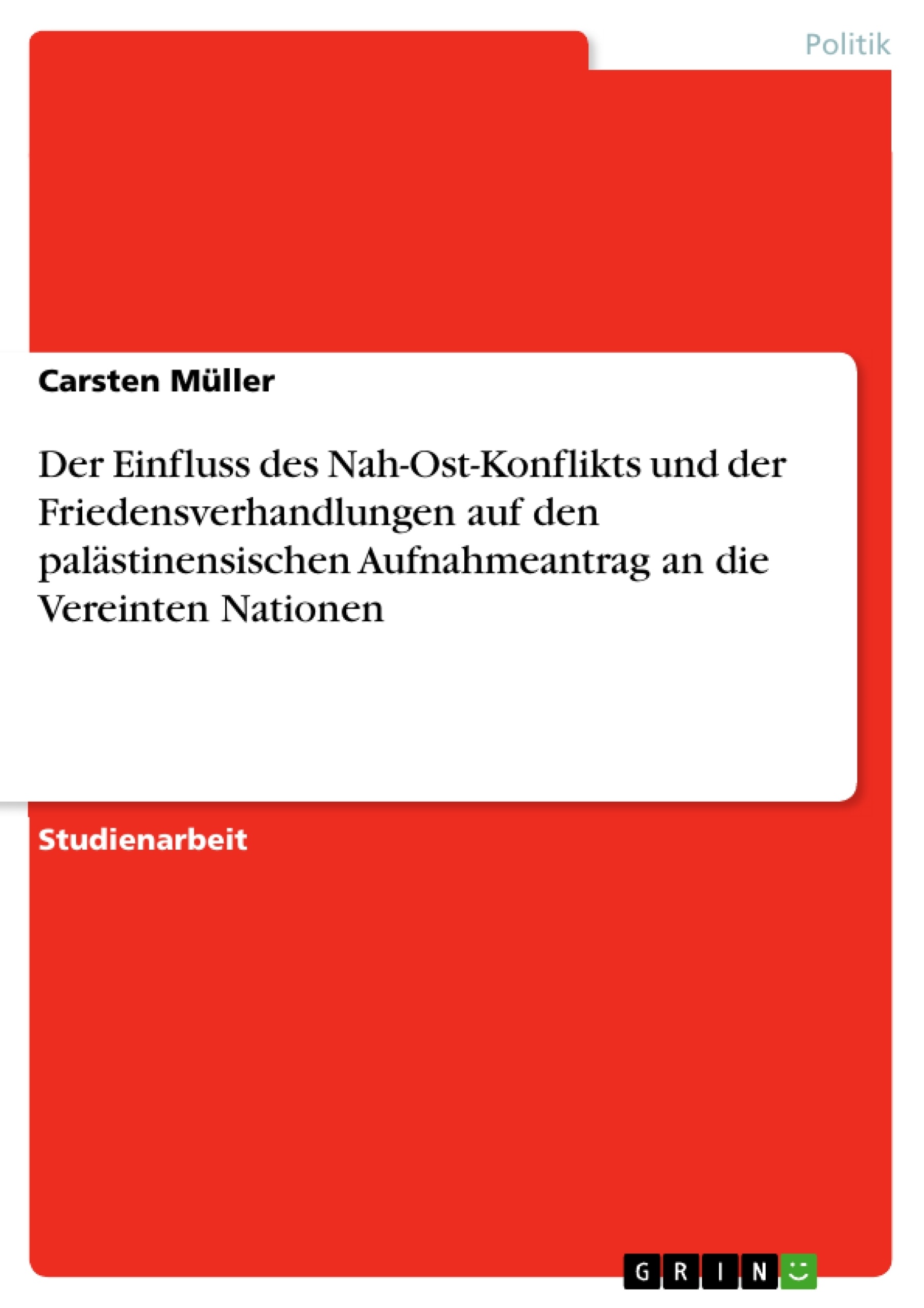Am 23.September 2011 reichte Palästinenserchef Mahmud Abbas vor der UNO Generalversammlung den Antrag ein, den Staat Palästina als 195. Mitglied in die internationale Staatengemeinschaft aufzunehmen.
Den Antrag als rein symbolischen Akt zu verstehen, greift zu kurz. Vielmehr geht es den Palästinensern darum, nach unzähligen gescheiterten Friedensverhandlungen mit Israel, einen neuen Weg in Richtung Selbstbestimmung und Freiheit zu beschreiten.
Demzufolge beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage, welche Ursache und Wirkung der Antrag von Mahmud Abbas auf den Friedensprozess im Nahen- Osten hat und welche Veränderungen durch ihn herbeigeführt wurden.
So soll in einem ersten Schritt der Konflikt an sich untersucht und Gründe für das bisherige Scheitern des Friedensprozesses herausgefunden werden, um dann zu analysieren welche Bedingungen für eine Konfliktlösung erfüllt sein müssen und welchen Beitrag der Antrag hierbei leistet.
Die Determinanten des Konflikts sind facettenreich und machen ihn alles andere als überschaubar, so spielen sowohl geostrategische Interessen als auch die Auseinandersetzung der westlichen mit der arabischen Welt und somit auch religiöse Aspekte eine Rolle.
Die Literatur zu diesem Thema spiegelt diese Vielfalt wieder, es herrscht nicht einmal Einigkeit darüber, dass am Ende eines Friedensprozesses eine Zwei- Staaten- Lösung gefunden werden sollte.
Auch beschäftigen sich viele Arbeiten entweder mit der Frage warum welche Friedenskonferenz scheiterte, ohne dabei eine Antwort zu geben, was nötig ist um zu einer Lösung zu kommen oder es wird untersucht, ob Palästina den Kriterien eines Staates gerecht wird und überhaupt als solcher anerkannt werden kann.
Letztlich geht es darum, dass Israel als direkter Konfliktpartner Palästina anerkennt. Es wird erwartet, dass der neue Ansatz der Palästinenser einen positiven Vorstoß in diese Richtung bewirkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Nah-Ost-Konflikt und der Prozess der Friedensverhandlungen
- Analyse der Friedensverhandlungen
- Einfluss des Aufnahmeantrags
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Ursache und Wirkung der Antrag von Mahmud Abbas auf den Friedensprozess im Nahen Osten hat und welche Veränderungen durch ihn herbeigeführt wurden. Dazu werden zunächst der Konflikt selbst untersucht und Gründe für das bisherige Scheitern des Friedensprozesses herausgefunden. Anschließend werden die Bedingungen für eine Konfliktlösung analysiert und der Beitrag des Antrags in diesem Zusammenhang bewertet.
- Der Nah-Ost-Konflikt: Ursachen, Verlauf und aktuelle Herausforderungen
- Der gescheiterte Friedensprozess: Analyse der bisherigen Verhandlungen und Hindernisse
- Der Aufnahmeantrag Palästinas: Ziele, Auswirkungen und mögliche Folgen
- Bedingungen für eine Konfliktlösung: Analyse der notwendigen Schritte und Kompromisse
- Die Rolle der internationalen Gemeinschaft: Einfluss und Verantwortlichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Aufnahmeantrag Palästinas als Ausgangspunkt der Arbeit dar und beleuchtet dessen Bedeutung für den Friedensprozess im Nahen Osten. Dabei werden die zentralen Forschungsfragen und die methodische Vorgehensweise erläutert.
Der Nah-Ost-Konflikt und der Prozess der Friedensverhandlungen
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln des Nahost-Konflikts und die Entwicklung des Friedensprozesses. Es werden die wichtigsten Ereignisse, Akteure und Konfliktpunkte dargestellt, die die aktuelle Situation prägen.
Analyse der Friedensverhandlungen
In diesem Kapitel werden die bisherigen Friedensverhandlungen analysiert, wobei die wichtigsten Phasen, Akteure und Ergebnisse beleuchtet werden. Es werden auch die Ursachen für das Scheitern der Verhandlungen und die Herausforderungen für eine zukünftige Lösung erörtert.
Einfluss des Aufnahmeantrags
Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss des Aufnahmeantrags auf den Friedensprozess. Es werden die möglichen Auswirkungen auf die Konfliktparteien, die internationale Gemeinschaft und die zukünftige politische Landschaft des Nahen Ostens analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Warum reichte Mahmud Abbas 2011 den UNO-Aufnahmeantrag ein?
Ziel war es, nach jahrelang gescheiterten Verhandlungen mit Israel einen neuen Weg zur internationalen Anerkennung und staatlichen Selbstbestimmung Palästinas zu gehen.
Welche Auswirkungen hatte der Antrag auf den Friedensprozess?
Der Antrag markierte einen Strategiewechsel weg von rein bilateralen Gesprächen hin zu einer Internationalisierung des Konflikts, was sowohl Hoffnung als auch neue Spannungen erzeugte.
Warum sind die Friedensverhandlungen bisher oft gescheitert?
Gründe sind komplexe geostrategische Interessen, religiöse Aspekte, Siedlungsfragen und mangelndes Vertrauen zwischen den direkten Konfliktpartnern.
Was ist die "Zwei-Staaten-Lösung"?
Es ist das Konzept eines unabhängigen Staates Palästina neben dem Staat Israel, wobei in der Literatur Uneinigkeit über deren Umsetzbarkeit herrscht.
Welche Rolle spielt die internationale Gemeinschaft im Nahost-Konflikt?
Die Weltgemeinschaft fungiert als Vermittler, Geber und entscheidet über die diplomatische Anerkennung, was massiven Einfluss auf die Verhandlungspositionen hat.
- Quote paper
- Carsten Müller (Author), 2012, Der Einfluss des Nah-Ost-Konflikts und der Friedensverhandlungen auf den palästinensischen Aufnahmeantrag an die Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300444