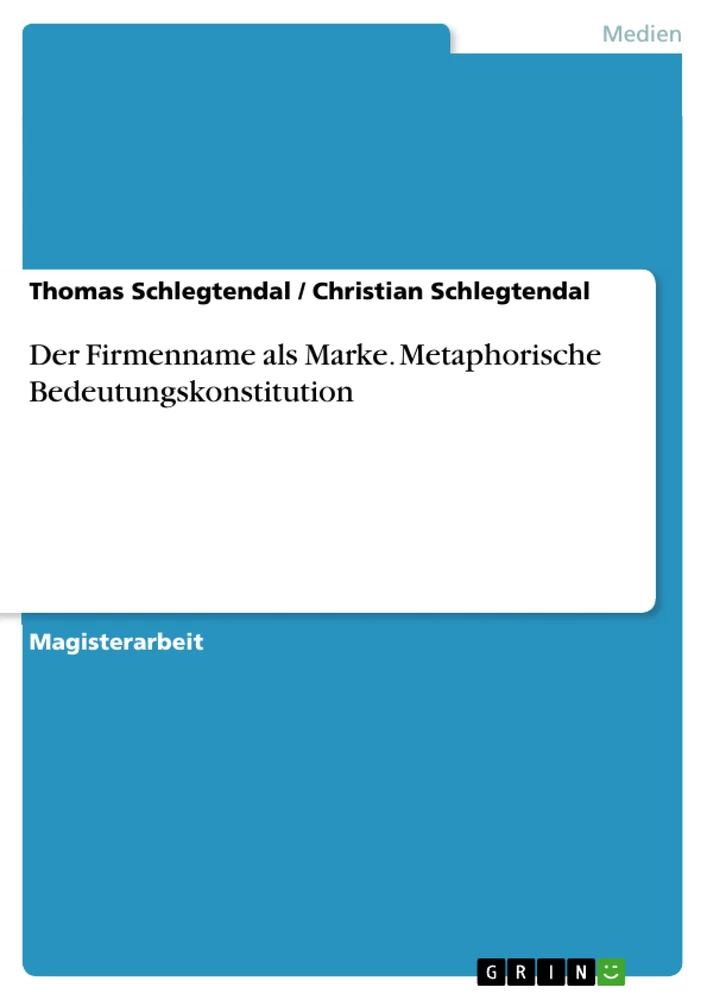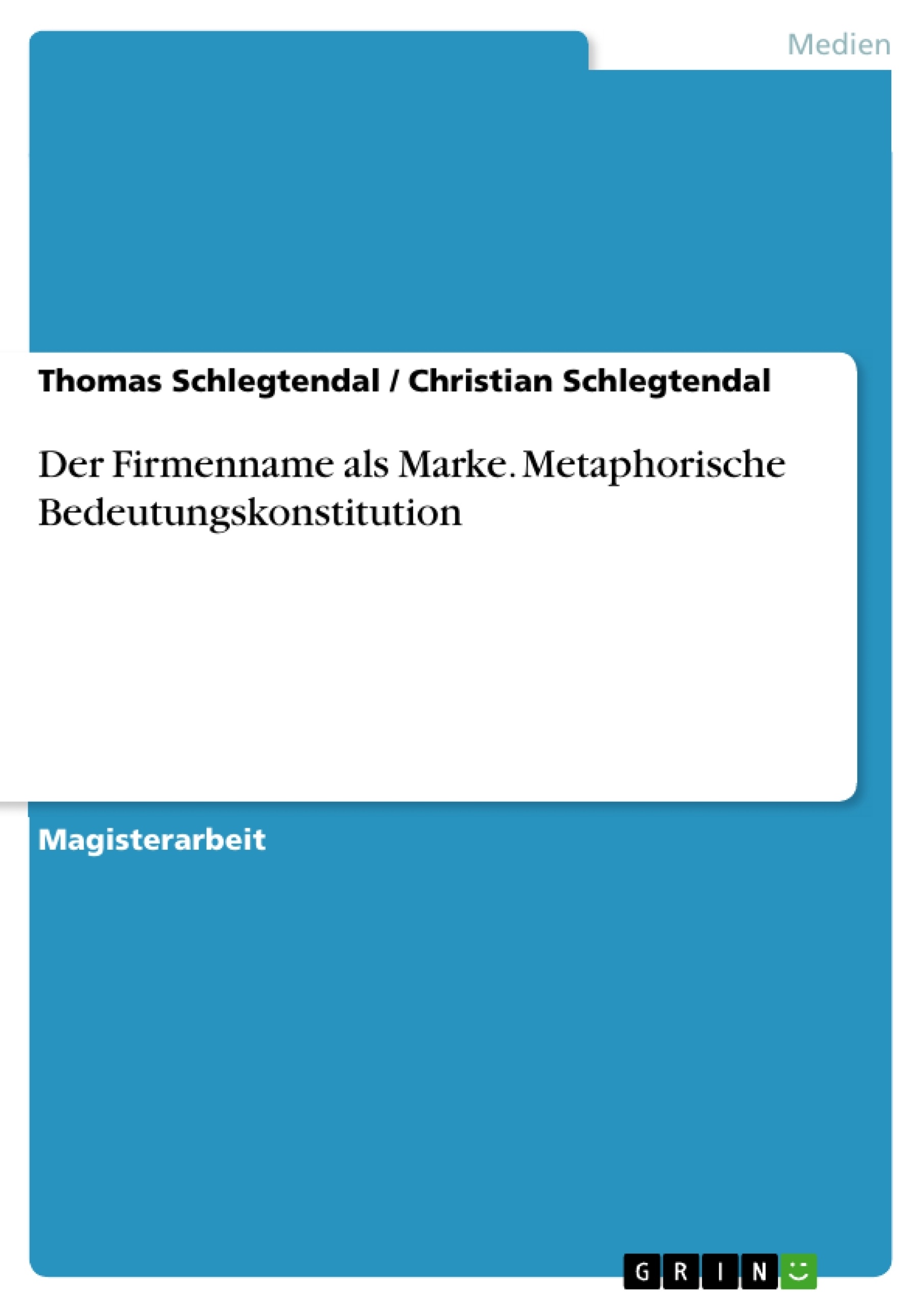Das übergeordnete Thema der vorliegenden Arbeit ist die Diskussion von Methoden zur Herstellung einer Markenidentität für ein Unternehmen.
Die Markenidentität beinhaltet alle Merkmale, in denen sich eine Marke von anderen dauerhaft unterscheidet. Ihre Stärke hängt wesentlich von der Übereinstimmung
zwischen dem Selbstbild eines Unternehmens und der Wahrnehmung des Unternehmens durch Außenstehende (d.h. seiner Fremdwahrnehmung) ab.
Ein Teil dieser Markenidentität wird durch den Namen des Unternehmens bestimmt.
Im Rahmen dieser Arbeit soll für den Namen eines Unternehmens eine gewünschte Bedeutung entstehen, die es im Vorfeld zu bestimmen und sodann
an die Bezugsgruppen zu vermitteln gilt.
Zu diesem Zweck werden wir uns mit der Frage befassen, wie einem neuen, noch nie da gewesenen Begriff (dem Firmennamen) eine spezielle Bedeutung
zugewiesen werden kann und auf welchem Weg sich dieses neu Entstandene in einer Sprachgemeinschaft verfestigen kann.
Der Weg zu diesem Ziel führt nur über Kommunikation.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Axiomatische Fundierung
- 2.1 Einordnung von Karl Bühlers wissenschaftlicher Ausrichtung
- 2.2 Die Axiomatik Bühlers
- 2.3 Die Zukunft der Psychologie und die Schule oder ,,Die Axiomatik des Menschseins"
- 2.3.1 Erste Richtung
- 2.3.2 Zweite Richtung
- 2.3.3 Axiom 1 - Das lebendige Individuum handelt
- 2.3.4 Axiom 2 - Das Leben ist begrenzt in Raum und Zeit
- 2.3.5 Axiom 3 – Die Findigkeit und das schaffende Verhalten
- 2.3.6 Axiom 4 - Die Fortpflanzung
- 2.3.7 Axiom 5 - Das Gemeinschaftsleben
- 2.3.8 Axiom 6 - Das Formproblem
- 2.3.9 Axiom 7 - Das Signalwesen
- 2.3.10 Fazit
- 2.4 Sprachtheorie
- 2.4.1 Axiom A: Das Organonmodell der Sprache
- 2.4.2 Axiom B: Die Zeichennatur der Sprache
- 2.4.2.1 Aliquid stat pro aliquo und das Prinzip der abstraktiven Relevanz
- 2.4.3 Axiom C: Sprechhandlung und Sprachwerk; Sprechakt und Sprachgebilde
- 2.4.3.1 Sprechhandlung
- 2.4.3.2 Sprachwerk
- 2.4.3.3 Sprachgebilde
- 2.4.3.4 Sprechakt
- 2.4.4 Axiom D: Das S-F-System (Symbol-Feld-System) vom Typus Sprache
- 2.4.5 Fazit
- 3. Gerold Ungeheuers kommunikationstheoretischer Ansatz
- 3.1 Anthropologische Komponente (M)
- 3.2 Soziologische Komponente (H)
- 3.3 Die semiotische Komponente (Z)
- 3.4 Fazit
- 4. Die Psychologie der persönlichen Konstrukte
- 4.1 Korollarium der Konstruktion
- 4.2 Korollarium der Individualität
- 4.3 Korollarium der Organisation
- 4.4 Korollarium der Dichotomie
- 4.5 Korollarium der Wahl
- 4.6 Korollarium des Bereichs
- 4.7 Korollarium der Erfahrung
- 4.8 Korollarium der Veränderung
- 4.9 Korollarium der Fragmentierung
- 4.10 Korollarium der Gemeinsamkeit
- 4.11 Korollarium der Teilnahme am sozialen Prozess
- 4.12 Fazit
- 5. Neues Wissen
- 6. Die Metapher
- 6.1 Die kognitive Metapherntheorie
- 6.1.1 Die Ubiquitätsthese
- 6.1.2 Die Domänen-These
- 6.1.3 Die Modell-These
- 6.1.4 Die Diachronie-These
- 6.1.5 Die Unidirektionalitäts-These
- 6.1.6 Die Invarianz-These
- 6.1.7 Die Notwendigkeits-These
- 6.1.8 Die Kreativitäts-These
- 6.1.9 Die Fokussierungs-These
- 6.1.10 Fazit
- 7. Marke
- 7.1 Kurzer historischer Abriss
- 7.2 Markenansätze
- 7.2.1 Der instrumentelle Ansatz
- 7.2.2 Der funktionsorientierte Ansatz
- 7.2.3 Der imageorientierte Ansatz
- 7.2.4 Der technokratisch-strategische Ansatz
- 7.2.5 Der fraktale Ansatz
- 7.2.6 Der identitätsorientierte Ansatz
- 8. Handlungsplan
- 8.1 Skizzierter Fragebogen zur Ermittlung der Selbstsicht
- 8.2 Skizzierter Fragebogen zur Ermittlung der Fremdsicht
- 8.3 Auswertung der Selbstsicht
- 8.4 Auswertung der Fremdsicht
- 8.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
- 9. Strategie
- 9.1 Der Slogan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie der Firmenname als Marke metaphorisch konstituiert wird. Sie analysiert, wie die Bedeutung des Firmennamens durch den Einsatz von Metaphern entsteht und welche Rolle diese für die Markenbildung spielen.
- Die axiomatische Fundierung von Karl Bühler und ihre Bedeutung für die Kommunikationstheorie
- Die Anwendung des kommunikationstheoretischen Ansatzes von Gerold Ungeheuer auf die Markenbildung
- Die Relevanz der Psychologie der persönlichen Konstrukte für das Verständnis der Markenwahrnehmung
- Die Rolle der Metapher in der Markenbildung
- Die Entwicklung einer Handlungsplanung für die metaphorische Konstitution eines Firmennamens als Marke
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 behandelt die axiomatische Fundierung von Karl Bühler und ihre Bedeutung für die Kommunikationstheorie. Kapitel 3 analysiert den kommunikationstheoretischen Ansatz von Gerold Ungeheuer und seine Relevanz für die Markenbildung. Kapitel 4 befasst sich mit der Psychologie der persönlichen Konstrukte und ihrer Bedeutung für das Verständnis der Markenwahrnehmung. Kapitel 5 untersucht die Rolle der Metapher in der Markenbildung. Kapitel 6 entwickelt eine Handlungsplanung für die metaphorische Konstitution eines Firmennamens als Marke.
Schlüsselwörter
Firmenname, Marke, Metapher, Kommunikationstheorie, Karl Bühler, Gerold Ungeheuer, Psychologie der persönlichen Konstrukte, Markenbildung, Markenwahrnehmung, Handlungsplanung.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Thomas Schlegtendal (Autor:in), Christian Schlegtendal (Autor:in), 2008, Der Firmenname als Marke. Metaphorische Bedeutungskonstitution, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300477