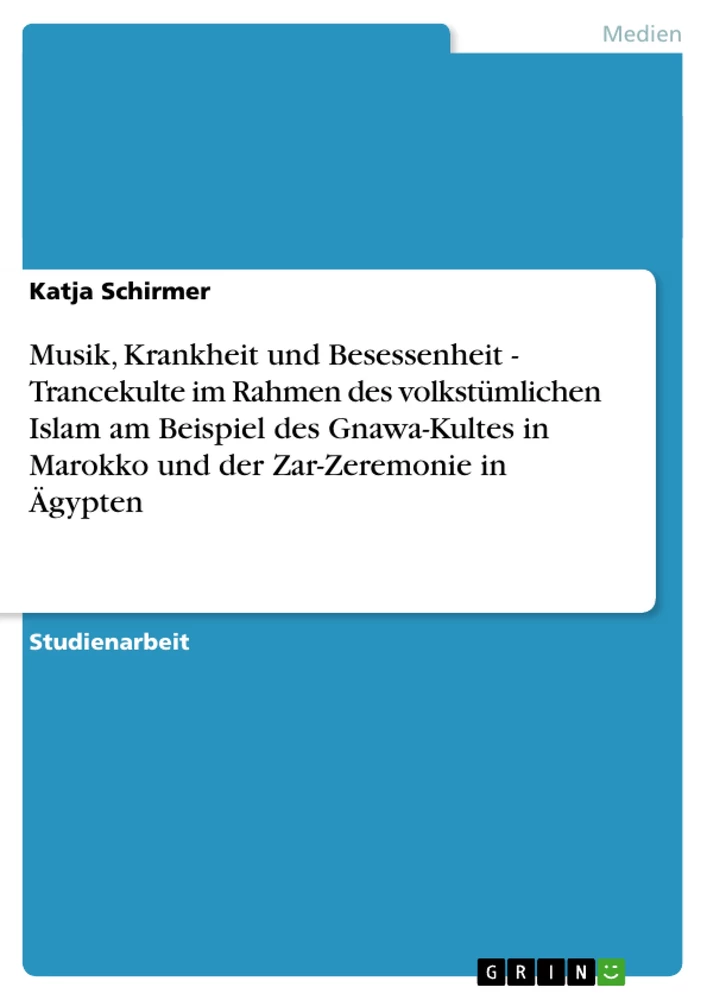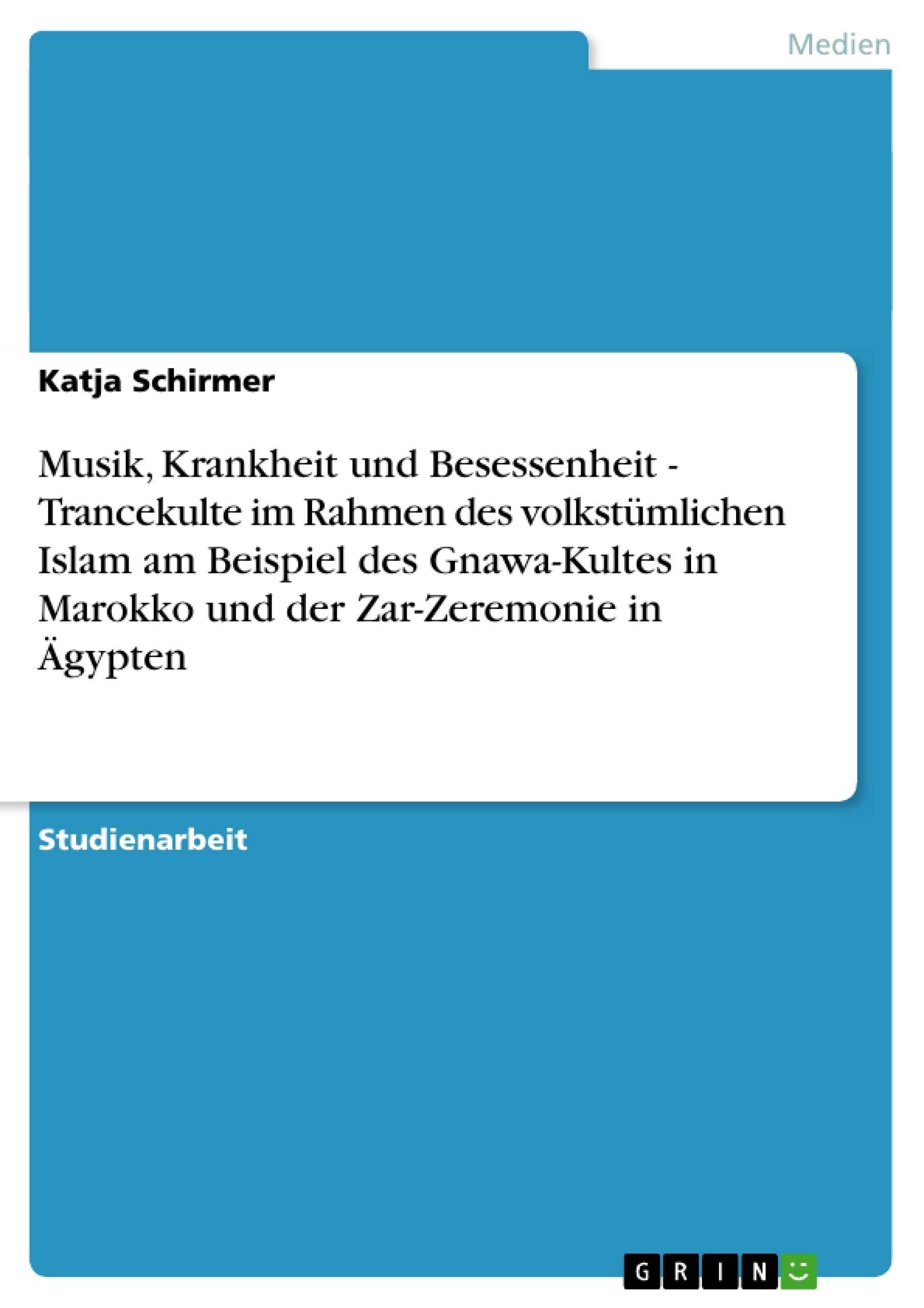In der islamischen Welt wird oft von einer Trennung der Gesellschaft in einen männlichen und einen weiblichen Teil gesprochen. Auf religiöser Ebene entspricht dies dem Gegensatz zwischen „offiziellem“ und „volkstümlichem“ Islam (vgl. Welte, S. 29), dessen Träger zum größten Teil Frauen und männliche Randgruppen, wie Homosexuelle oder Transvestiten, sind. Im Rahmen des volkstümlichen Islam gibt es eine Reihe von Besessenheitskulten und Zeremonien, in deren Mittelpunkt der Glaube an verschiedene Geister steht, von denen die Anhänger des Kultes überzeugt sind „besessen“ zu sein. Diese Besessenheit zeigt sich durch ganz verschiedene „Krankheiten“ des Betroffenen wie zum Beispiel psychische Probleme, physische Krankheiten oder Kinderlosigkeit.
Besessenheitskulte enthalten viele Elemente des Islam, sind aber auch geprägt von Bräuchen vorislamischer Religionen, wie den Naturreligionen der schwarzafrikanischen Bevölkerung, dem Christentum oder dem Judentum.
Da die volkstümlichen Kulte so verschieden sind wie die islamische Lebenswelt selbst, beschränkt sich diese Hausarbeit auf zwei Ausprägungen, die zwar sehr unterschiedlich sind, sich jedoch in ihren Grundzügen ähneln: den Gnawa – Kult in Marokko und die Zar – Zeremonie in Ägypten.
Ersteres bezeichnet eine volkstümliche Bruderschaft, die sich aus Nachfahren westafrikanischer Sklaven zusammensetzt. Sie sind besonders für ihre zwölf – stündigen nächtlichen Geisterbeschwörungen und ihre ganz einzigartige Musik bekannt, die auch von marokkanischen Popgruppen immer wieder imitiert wird.
Der Zar ist ein ägyptisches Frauenheilungsritual. Zar ist dabei der Name der gesamten Zeremonie, steht aber auch für den Geist, von dem der Erkrankte befallen ist.
Zwar ist Musik im Islam umstritten, jedoch spielt sie für die meisten Kulte eine ganz zentrale Rolle, da durch ihren Einsatz die Teilnehmer eines Kultes in einen tranceartigen Zustand verfallen können. Dieser scheint es ihnen zu ermöglichen, mit den Geistern zu kommunizieren, von denen sie sich besessen fühlen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Krankheit und Besessenheit im volkstümlichen Islam
- 2.1. Definition von Krankheit im allgemeinen Sprachgebrauch
- 2.2. Phänomen der Besessenheit - Besessenheitstrance
- III. Der Gnawa-Kult in Marokko
- 3.1. Hintergründe – historische Herkunft und Legenden
- 3.2. Die Gnawa - Musikanten
- 3.2.1. Die Wirkungsbereiche und die Hierarchie der Musiker
- 3.2.2. Der Tagesablauf und die Kleidung
- 3.2.3. Imitation der Gnawa – Rhythmen durch moderne marokkanische Popgruppen
- 3.3. Die Musikinstrumente
- 3.3.1. Die traditionellen Instrumente der Gnawa
- 3.3.2. Die gunbri als „beseeltes“ und wichtigstes Kultinstrument
- 3.4. Die Anhänger des Besessenheitskultes
- 3.4.1. Die Einteilung der Anhänger der Gnawa – Musikanten
- 3.4.2. Die haddamat - die Dienerinnen
- 3.4.3. Die ‘abid – die männlichen Verehrer der Gnawa
- 3.4.4. Die bnat gnawiya, die Gnawa - Töchter
- 3.5. Die Wahrsager/innen des Gnawa - Kultes
- 3.5.1. Funktionen der šuwafa
- 3.5.2. Funktionen des šuwaf
- 3.6. Die hadra - die nächtliche Geisterbeschwörung als bedeutendste Zeremonie der Gnawa
- 3.6.1. Die hadra
- 3.6.2. Der Verlauf einer hadra sgira - der kleinen Geisterbeschwörung
- IV. Die Zar-Zeremonie in Ägypten
- 4.1. Hintergründe des Zar
- 4.1.1. Historische Herkunft des Zar
- 4.1.2. Der Zar als Frauenheilungsritual
- 4.2. Die Schecha - Priesterin und Heilerin
- 4.3. Die Musiker der Zar- Zeremonie und ihre Instrumente
- 4.3.1. Die drei verschiedenen Arten von Musikgruppen
- 4.4. Die Zar - Geister, „djinn“
- 4.4.1. Die verschiedenen Geister
- 4.4.2. Der Geisterglaube im offiziellen Islam
- 4.5. Der kleine Zar
- 4.5.1. Die Sucht nach Trance und Besessenheit
- 4.6. Der große Zar
- 4.6.1. Verlauf einer großen Zar - Zeremonie
- 4.7. Der Zar als Mittel weiblicher Emanzipation
- 4.1. Hintergründe des Zar
- V. Gnawa-Kult und Zar - Zeremonie ein zusammenfassender Vergleich
- 5.1. Die Volksreligion als Mittel weiblicher Emanzipation
- 5.2. Gunbri und Tumbura – die Kultinstrumente im Vergleich
- 5.3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Besessenheitskulte im Kontext des volkstümlichen Islam, am Beispiel des Gnawa-Kultes in Marokko und der Zar-Zeremonie in Ägypten. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Kulturen zu beleuchten und den Stellenwert von Musik in diesen Ritualen zu analysieren.
- Krankheit und Besessenheit im volkstümlichen Islam
- Die Rolle von Musik in Trance-Ritualen
- Der Gnawa-Kult: Geschichte, Musik und soziale Strukturen
- Die Zar-Zeremonie: Heilungsritual und weibliche Emanzipation
- Vergleichende Analyse beider Kulte
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Besessenheitskulte im volkstümlichen Islam ein und stellt den Gegensatz zwischen "offiziellem" und "volkstümlichem" Islam dar. Sie grenzt die Arbeit ein auf den Gnawa-Kult in Marokko und die Zar-Zeremonie in Ägypten, zwei Kulturen die sich in ihren Grundzügen ähneln, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Die zentrale Rolle von Musik in diesen Ritualen zur Erzeugung tranceartiger Zustände wird hervorgehoben.
II. Krankheit und Besessenheit im volkstümlichen Islam: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Krankheit" im Kontext der untersuchten Kulte und differenziert ihn von der medizinischen Definition der WHO. Es wird die Bedeutung sozialer Faktoren und Unterdrückung als Ursachen für die "Krankheitssymptome" erörtert und das Phänomen der Besessenheitstrance als zentralen Aspekt der untersuchten Rituale beleuchtet. Die kulturellen und individuellen Funktionen dieser Trancezustände werden angesprochen.
III. Der Gnawa-Kult in Marokko: Dieser Abschnitt befasst sich ausführlich mit dem Gnawa-Kult, seinen historischen Wurzeln und Legenden. Es werden die Gnawa-Musiker, ihre Hierarchie, ihr Tagesablauf, ihre Kleidung und ihre Musikinstrumente detailliert beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt auf der gunbri als zentralem Kultinstrument. Die verschiedenen Gruppen von Anhängern des Kultes, einschließlich der Wahrsager, werden vorgestellt, und die hadra, die nächtliche Geisterbeschwörung, wird als wichtigste Zeremonie erläutert.
IV. Die Zar-Zeremonie in Ägypten: Dieses Kapitel beschreibt die Zar-Zeremonie als ägyptisches Frauenheilungsritual. Es beleuchtet die historische Herkunft des Zar, die Rolle der Schecha (Priesterin und Heilerin), und die verschiedenen Musikgruppen und Instrumente, die in der Zeremonie verwendet werden. Die verschiedenen Zar-Geister ("djinn") und der Geisterglaube im Kontext des offiziellen Islam werden diskutiert. Schließlich wird der Verlauf des "kleinen" und "großen" Zar beschrieben, und die Zeremonie wird im Hinblick auf die weibliche Emanzipation analysiert.
V. Gnawa-Kult und Zar - Zeremonie ein zusammenfassender Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht den Gnawa-Kult und die Zar-Zeremonie, unter Berücksichtigung ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Volksreligion wird als Mittel weiblicher Emanzipation analysiert, und ein Vergleich der wichtigsten Kultinstrumente (Gunbri und Tumbura) wird durchgeführt. Eine zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse schließt den Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Gnawa-Kult, Zar-Zeremonie, volkstümlicher Islam, Besessenheit, Trance, Musik, Heilungsritual, Geisterglaube, weibliche Emanzipation, Marokko, Ägypten, gunbri, Tumbura.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Gnawa-Kult und Zar-Zeremonie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Besessenheitskulte im Kontext des volkstümlichen Islam, insbesondere den Gnawa-Kult in Marokko und die Zar-Zeremonie in Ägypten. Sie analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Kulturen und die Rolle der Musik in den Ritualen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Krankheit und Besessenheit im volkstümlichen Islam, die Rolle von Musik in Trance-Ritualen, den Gnawa-Kult (Geschichte, Musik, soziale Strukturen), die Zar-Zeremonie (als Heilungsritual und im Hinblick auf weibliche Emanzipation) und einen vergleichenden Analyse beider Kulte.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Krankheit und Besessenheit im volkstümlichen Islam, Der Gnawa-Kult in Marokko, Die Zar-Zeremonie in Ägypten und ein zusammenfassender Vergleich beider Kulte. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Gnawa-Kult und der Zar-Zeremonie aufzuzeigen und den Stellenwert von Musik in diesen Ritualen zu analysieren, wobei der Fokus auf Trance-Zuständen liegt.
Wie wird der Gnawa-Kult beschrieben?
Das Kapitel zum Gnawa-Kult beschreibt dessen historische Wurzeln und Legenden, die Gnawa-Musiker (ihre Hierarchie, ihren Tagesablauf, Kleidung und Instrumente), die verschiedenen Anhängergruppen (einschließlich Wahrsager) und die Hadra (nächtliche Geisterbeschwörung) als wichtigste Zeremonie.
Wie wird die Zar-Zeremonie beschrieben?
Die Zar-Zeremonie wird als ägyptisches Frauenheilungsritual dargestellt. Die Arbeit beleuchtet die historische Herkunft, die Rolle der Schecha (Priesterin und Heilerin), die Musikgruppen und Instrumente, die verschiedenen Zar-Geister ("Djinn"), den Geisterglaube im Kontext des offiziellen Islam, den Verlauf des "kleinen" und "großen" Zar und die Zeremonie im Hinblick auf weibliche Emanzipation.
Welchen Vergleich stellt die Arbeit an?
Der Vergleich konzentriert sich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Gnawa-Kult und der Zar-Zeremonie, analysiert die Volksreligion als Mittel weiblicher Emanzipation und vergleicht die wichtigsten Kultinstrumente (Gunbri und Tumbura).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Gnawa-Kult, Zar-Zeremonie, volkstümlicher Islam, Besessenheit, Trance, Musik, Heilungsritual, Geisterglaube, weibliche Emanzipation, Marokko, Ägypten, Gunbri, Tumbura.
Wie wird Krankheit und Besessenheit definiert?
Die Arbeit differenziert zwischen der medizinischen Definition von Krankheit und der im Kontext der untersuchten Kulte. Soziale Faktoren und Unterdrückung werden als mögliche Ursachen für die "Krankheitssymptome" erörtert, und die Besessenheitstrance wird als zentraler Aspekt der Rituale beleuchtet.
- Quote paper
- Katja Schirmer (Author), 2003, Musik, Krankheit und Besessenheit - Trancekulte im Rahmen des volkstümlichen Islam am Beispiel des Gnawa-Kultes in Marokko und der Zar-Zeremonie in Ägypten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30062