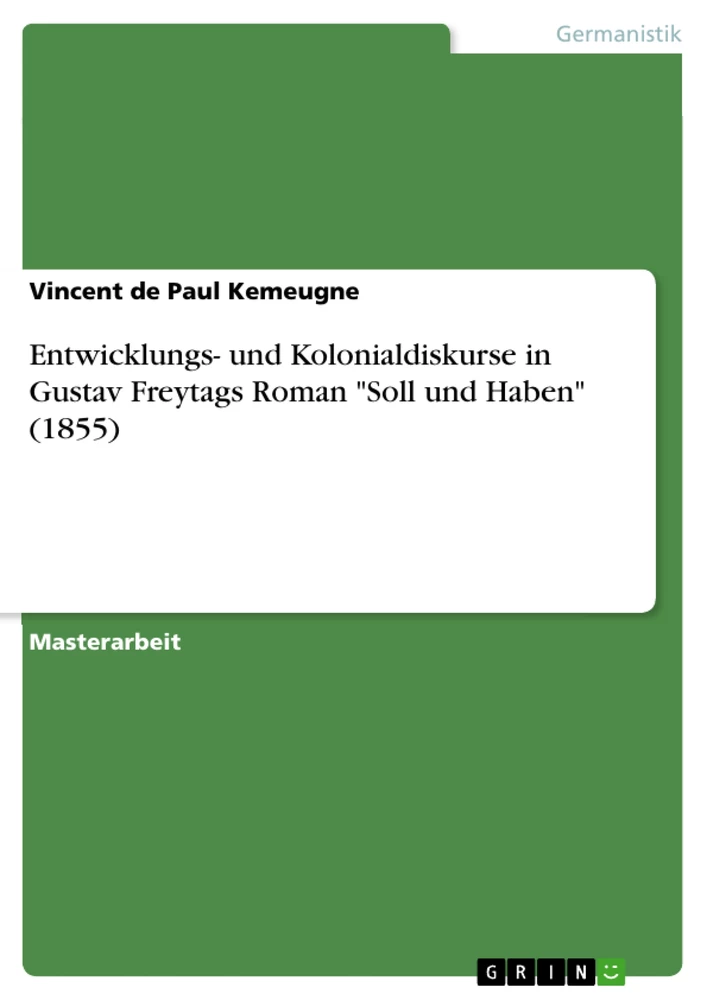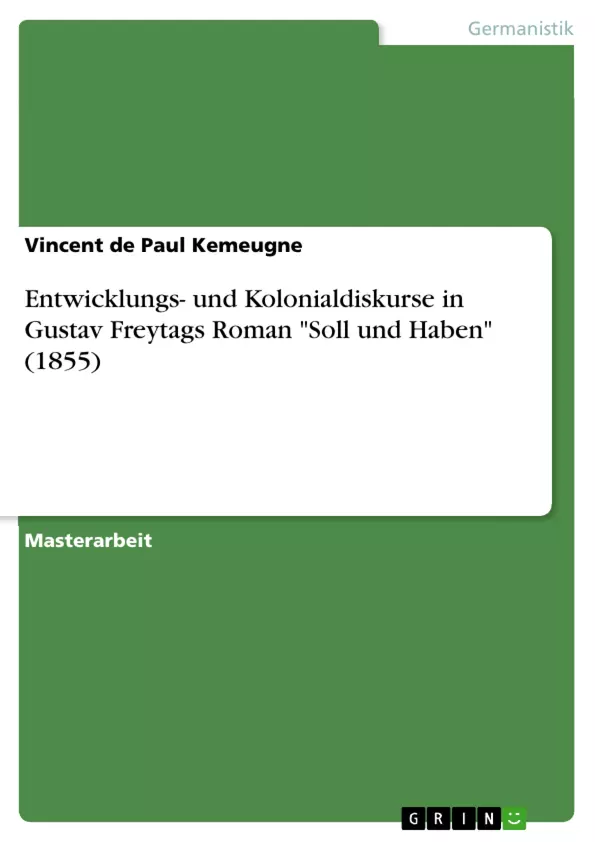Es mag verwundern, dass sich ein afrikanischer Germanist an einem Autor wie Gustav Freytag, dessen Werk „Soll und Haben“ wegen nicht unbegründeten Verdachts von Antisemitismus und Diskriminierungsapologie nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Kanon heraustritt und demzufolge in Vergessenheit geriet, interessiert. In der Tat werden im Zuge der neueren Paradigmen wie etwa der cultural studies manche als nicht mehr interessant gesehenen Werke mit ganz neuen Blicken wieder gelesen. So kann der Leser anhand mancher damit verbundenen spezifischen Theorieansätze und Lektüremodelle ein neues Licht auf solche Werke werfen. Diese Arbeit verschreibt sich demzufolge der Tendenz, in alten und als vergriffen betrachteten Texten ganz aktuelle Forschungsgegenstände mit ganz neuen Analyseperspektiven herauszuarbeiten.
Die Problematiken „Entwicklung“ und „Kolonisation“, die den Forschungsgegenstand der vorliegenden Studie bilden, stellen aktuelle Themenschwerpunkte dar, die den aktuellen gesellschaftlichen, medialen, politischen, ökonomischen und literarischen Raum in Afrika weiterhin besetzen. Es ist demzufolge interessant zu sehen, wie sie in einem Werk der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, einer Epoche tiefergehender sozialer Umgestaltungen und sprunghaften ökonomischen Fortschritts im Zuge der Industriellen Revolution, literarisiert werden. Diese Problematiken in ihren sozialgeschichtlichen Kontext des Wilhelminischen Zeitalters zu setzen und sie einer diskursanalytischen Perspektive zu unterziehen, stellen deutlich den Vorteil dar, nicht nur die inszenierten Diskurse herauszustellen, sondern auch und vor allem zu untersuchen, welcher Diskurs von den jeweils handelnden gesellschaftlichen Akteuren vertreten wird.
Diese Untersuchung wird auf der folgenden Leitfrage aufgebaut: welche ideologischen Denksysteme und kulturellen Ideologeme liegen den jeweiligen inszenierten Diskursen der dargestellten Sozialgruppen zugrunde? Diese Studie setzt sich als Ziel, im Roman Freytags „Soll und Haben“ die jeweiligen inszenierten diskursiven Konstruktionen über die Problematiken „Entwicklung“ und „Kolonisation“ zu analysieren. Darüber hinaus gehören die Diskursstrategien, die Positionierungen und die Modalitäten der Konstitution der jeweiligen Diskurse sowie die Beziehungen zwischen den dargestellten gesellschaftlichen Akteuren zu meinen Erkenntnisinteressen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Theoretischer Bezugsrahmen
- 1-1: Zum Stand der Diskussion um den Begriff „Entwicklung“
- 1-1-1: Die Modernisierungstheorie
- 1-1-1-1: Die wachstumstheoretische Denkrichtung
- 1-1-1-2: Die Denkrichtung des sozialen Wandels
- 1-1-2: Zur Dependenztheorie
- 1-1-3: Zu den postmodernen Entwicklungsansätzen
- 1-1-1: Die Modernisierungstheorie
- 1-2: Zum Begriff „Kolonisation“
- 1-3: Zu den Begriffen „Entwicklungsdiskurs“ und „Kolonialdiskurs“
- 1-4: Zur diskursanalytischen Literaturwissenschaft
- 1-4-1: Zum Stand der diskursanalytischen Richtungen in der Literaturwissenschaft
- 1-4-1-1: Zur psychologischen Orientierung
- 1-4-1-2: Zur semiotischen Richtung
- 1-4-1-3: Zur philologischen Variante
- 1-4-2: Zum theoretischen Modell der Arbeit
- 1-4-1: Zum Stand der diskursanalytischen Richtungen in der Literaturwissenschaft
- 1-1: Zum Stand der Diskussion um den Begriff „Entwicklung“
- Kapitel 2: Zur diskursiven Konstruktion des bürgerlichen Entwicklungsmodells
- 2-1: Zur Romanumwelt
- 2-1-1: Zur soziokulturellen Umwelt der Romanhandlung
- 2-1-2: Zur Erzählstruktur des Romans „Soll und Haben“
- 2-2: Das bürgerliche Entwicklungsmodell als kultureller Modernisierungsprozess
- 2-2-1: Globalisierung als kultureller Prozess
- 2-2-1-1: Zur poetischen Triade Bürgertum-Ware-Fremde
- 2-2-1-2: Wohlfart als globalisierungs- und entwicklungsfähiges Subjekt
- 2-2-2: Zur Konstruktion einer bürgerlichen Modernisierungskultur
- 2-2-2-1: Zum Stellenwert der sozialen Mobilität im bürgerlichen Gesellschaftsmodell
- 2-2-3: Der bürgerliche Arbeitsdiskurs als Konstruktion eines kulturellen und nationalistischen Bewusstseins
- 2-2-3-1: Die gesellschaftliche Modernisierung durch neuere Arbeitsprozesse
- 2-2-3-2: Die Arbeit als soziokulturelle Institution
- 2-2-3-3: Die Tüchtigkeit in der bürgerlichen Identitätskonstruktion
- 2-2-4: Bildung und kulturelle Modernisierung
- 2-2-5: Zur Funktion von Ethik und Humanismus im bürgerlichen Kapitalismusdiskurs
- 2-2-5-1: Moralisierung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und Humanismus
- 2-2-1: Globalisierung als kultureller Prozess
- Kapitel 3: Zur Analyse des adligen Gesellschaftsmodells und des Diskurses der bürgerlichen Entwicklungsmission
- 3-1: Zur Analyse des adligen Gesellschaftsmodells
- 3-1-1: Zur hedonistischen Denkweise im Adelsdiskurs
- 3-1-2: Die idealistische Weltsicht im Diskurs des Adels
- 3-1-3: Die ökonomische Irrationalität im Denksystem des Adels
- 3-2: Zur Analyse der bürgerlichen Entwicklungsmission
- Die Konstruktion des bürgerlichen Entwicklungsmodells als kultureller Modernisierungsprozess
- Die Analyse des adligen Gesellschaftsmodells und seiner Opposition zum bürgerlichen Entwicklungsmodell
- Die Rolle von Globalisierung und Arbeit im Kontext der Entwicklung
- Die Bedeutung von Bildung und Moral im bürgerlichen Kapitalismusdiskurs
- Die Darstellung der Kolonialisierung und ihrer Auswirkungen auf die Figuren und Handlung des Romans
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Entwicklungs- und Kolonialdiskursen im Roman „Soll und Haben“ von Gustav Freytag. Sie zielt darauf ab, die Diskurse im Kontext des bürgerlichen Entwicklungsmodells und des adligen Gesellschaftsmodells zu analysieren und zu verstehen, wie diese die Handlung und die Figuren des Romans beeinflussen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Relevanz der Analyse von Entwicklungs- und Kolonialdiskursen im Roman „Soll und Haben“ heraus.
Kapitel 1 legt den theoretischen Bezugsrahmen der Arbeit fest. Es beleuchtet verschiedene Theorien und Ansätze zur Interpretation der Begriffe „Entwicklung“ und „Kolonisation“.
Kapitel 2 analysiert die diskursive Konstruktion des bürgerlichen Entwicklungsmodells im Roman. Es untersucht die Rolle von Globalisierung, Arbeit, Bildung und Moral im Kontext der bürgerlichen Modernisierungskultur.
Kapitel 3 widmet sich der Analyse des adligen Gesellschaftsmodells und des Diskurses der bürgerlichen Entwicklungsmission. Es untersucht die Denkweise und die Weltanschauung des Adels im Vergleich zum bürgerlichen Entwicklungsmodell.
Schlüsselwörter
Entwicklungsdiskurs, Kolonialdiskurs, bürgerliches Entwicklungsmodell, adliges Gesellschaftsmodell, Globalisierung, Arbeit, Bildung, Moral, „Soll und Haben“, Gustav Freytag, Romananalyse, Diskursanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Gustav Freytags "Soll und Haben"?
Die Arbeit untersucht die im Roman inszenierten Diskurse über "Entwicklung" und "Kolonisation" im Kontext des 19. Jahrhunderts.
Was charakterisiert das "bürgerliche Entwicklungsmodell" im Roman?
Es zeichnet sich durch Arbeitsethik, Tüchtigkeit, Bildung und sozialen Aufstieg aus, was als kultureller Modernisierungsprozess dargestellt wird.
Wie wird der Adel im Vergleich zum Bürgertum dargestellt?
Der Adelsdiskurs wird oft als ökonomisch irrational, hedonistisch und idealistisch beschrieben, was im Kontrast zur bürgerlichen Leistungsgesellschaft steht.
Welche Rolle spielt die Kolonisation in Freytags Werk?
Die Arbeit analysiert die "bürgerliche Entwicklungsmission" und wie koloniale Bestrebungen als Teil der nationalen Identitätskonstruktion literarisiert werden.
Welche Theorien werden für die Diskursanalyse herangezogen?
Die Arbeit nutzt unter anderem Modernisierungs- und Dependenztheorien sowie literaturwissenschaftliche Diskursanalysen.
- Citation du texte
- Vincent de Paul Kemeugne (Auteur), 2012, Entwicklungs- und Kolonialdiskurse in Gustav Freytags Roman "Soll und Haben" (1855), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300654