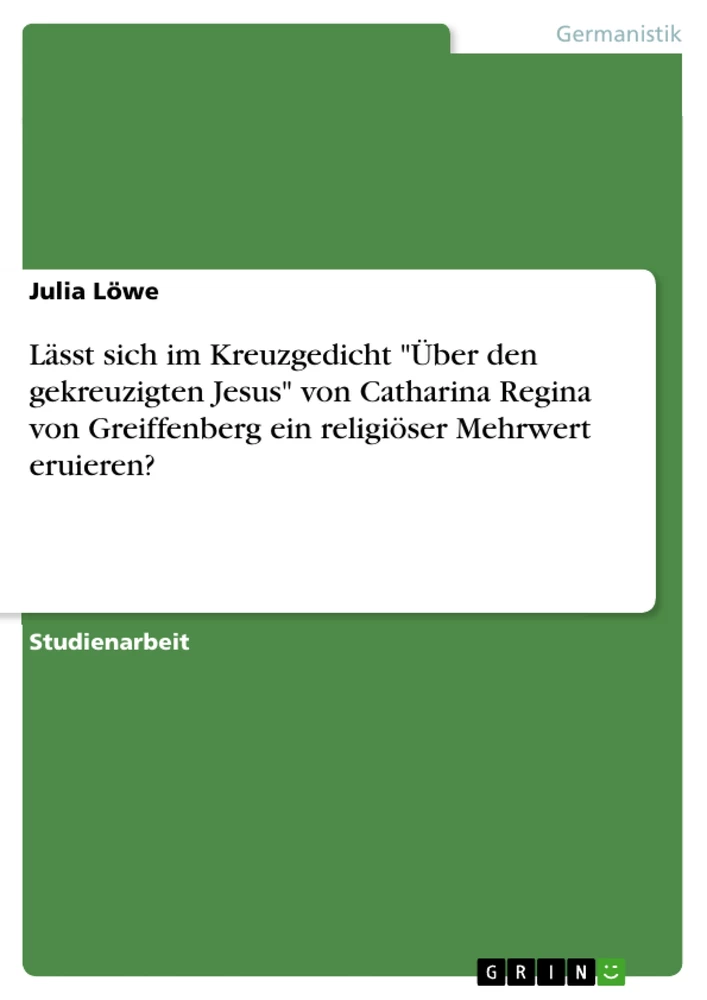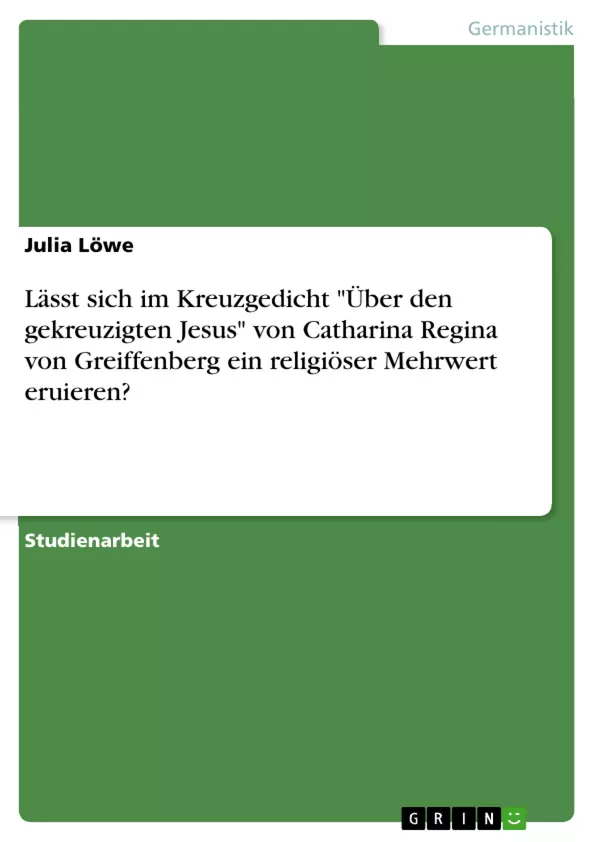Bereits beim Lesen meines Titels könnte die Frage aufkommen, warum ich mich gerade auf das Kreuzgedicht einer häufig übergangenen Dichterin des Barocks beziehe. Zur Erklärung meiner Wahl möchte ich mich auf Peter Maurice Daly berufen, der die Dichterin wie folgt charakterisiert: „Was die «meist übersehene» Dichterin anbelangt, so hat sie dieses Schicksal nicht verdient, denn sie darf wohl als vorbildliche Repräsentantin des hochbarocken Geistes gelten.“
Aus diesem Grund beschäftigt sich die nachfolgende Hausarbeit im Besonderen mit der Frage nach dem religiösen Mehrwert in der handschriftlichen Fassung des Kreuzgedichts über den gekreuzigten Jesus der Dichterin Catharina Regina von Greiffenberg.
Um eine umfassende Analyse bezüglich des religiösen Mehrwerts dieser Poetik zu verwirklichen, müssen zunächst Hintergrundinformationen über die Autorin und die Zeit in der sie lebte, geklärt werden. Demzufolge beschäftigt sich das zweite Kapitel mit den grundlegenden Fakten über das Leben von Catharina Regina von Greiffenberg und epochentypischen Elementen des Barocks, die einen essentiellen Einfluss auf die Dichterin ausübten, sowie der neuen Form der Lyrik, dem Figurengedicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Biographie und epochentypische Aspekte im Leben der Catharina Regina von Greiffenberg.
- Analyse des Kreuzgedichtes
- Form und Aufbau.
- Übereinstimmung von Form und Inhalt.
- Symbolik und Metaphorik.
- Besonderheit.
- Ermittlung des religiösen Mehrwertes – Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Literaturverzeichnis.
- Primärliteratur.
- Sekundärliteratur.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Kreuzgedicht von Catharina Regina von Greiffenberg und untersucht, ob sich darin ein religiöser Mehrwert eruieren lässt. Die Arbeit analysiert die Form, den Inhalt und die Symbolik des Gedichts im Kontext der Biografie der Autorin und der Epoche des Barock.
- Die religiöse Entwicklung der Dichterin im Kontext des Pietismus.
- Die Bedeutung des Kreuzgedichts als Ausdruck der Frömmigkeit im 17. Jahrhundert.
- Die Verbindung von Form und Inhalt im Kreuzgedicht als Ausdruck des religiösen Mehrwerts.
- Die Rolle von Symbolen und Metaphern in der Vermittlung religiöser Botschaften.
- Die Bedeutung der Figurengedichte im Barock.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem religiösen Mehrwert im Kreuzgedicht von Catharina Regina von Greiffenberg. Das zweite Kapitel beleuchtet die Biografie der Dichterin und ihre Zeit, wobei die Besonderheiten des Barock, die Bedeutung des Pietismus und die Entstehung der Figurengedichte hervorgehoben werden. Das dritte Kapitel analysiert das Kreuzgedicht anhand seiner Form, seines Aufbaus, seiner Symbole und Metaphern sowie seiner Besonderheiten. Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Catharina Regina von Greiffenberg, Kreuzgedicht, Barock, Pietismus, Figurengedicht, religiöser Mehrwert, Form und Inhalt, Symbolik und Metaphorik, geistliche Dichtung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Catharina Regina von Greiffenberg?
Sie war eine bedeutende österreichische Lyrikerin des Barock, bekannt für ihre tiefreligiöse geistliche Dichtung und ihre kunstvollen Figurengedichte.
Was ist ein Figurengedicht?
Ein Figurengedicht ist eine lyrische Form, bei der der Text so angeordnet ist, dass er optisch die Gestalt des besungenen Gegenstandes (z. B. ein Kreuz) darstellt.
Worin liegt der "religiöse Mehrwert" des Kreuzgedichts?
Der Mehrwert ergibt sich aus der Einheit von visueller Form (Kreuz) und spirituellem Inhalt, die zusammen eine tiefere meditative Erfahrung der Passion Christi ermöglichen.
Welchen Einfluss hatte der Barock auf ihr Werk?
Typische Barockelemente wie die Vanitas-Thematik, die starke Metaphorik und das Streben nach einer Verbindung von Kunst und Glauben prägen ihre Poesie.
Welche Rolle spielt der Pietismus in ihren Texten?
Die subjektive, herzliche Frömmigkeit und die persönliche Beziehung zu Gott, die für den frühen Pietismus kennzeichnend sind, finden in ihrem Werk deutlichen Ausdruck.
- Quote paper
- Julia Löwe (Author), 2014, Lässt sich im Kreuzgedicht "Über den gekreuzigten Jesus" von Catharina Regina von Greiffenberg ein religiöser Mehrwert eruieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300742